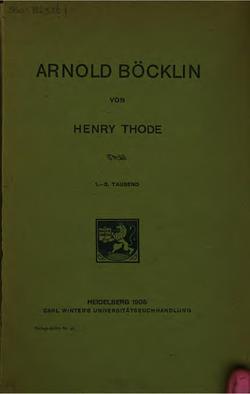Arnold Böcklin (Gedenkworte)
Verlags-Archiv Nr. 40.
[2]
Diese «Gedenkworte» erschienen zuerst in den «Bayreuther Blättern»
1901.
Alle Rechte, besonders das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen, werden vorbehalten.
Der Seligkeit Fülle, die hab ich empfunden!
Die Schönheit besaß ich; sie hat mich gebunden;
Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an.
Sie erkannt ich, sie ergriff ich; da war es getan.
Wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn,
Sie zog mich der Erd’ ab, zum Himmel hinan.
— — — — — — — — — — — — — — —
Sie steiget hernieder aus tausend Gebilden,
Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilden;
Nach heiligen Maßen erglänzt sie und schallt.
Und einzig veredelt die Form den Gehalt,
Verleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt. —
(Goethe, Pandora.)
Wenn das Auge eines Meisters sich schließt, dann muß es uns im ersten Augenblicke wohl scheinen, als verschlösse sich mit ihm im Dunkel die Welt der Erscheinungen, und wie Erblindete suchen wir im Inneren jene andere zu schauen, die der uns Entrissene, als er noch im Sonnenlichte wandelte, geschaffen und unserer Phantasie geschenkt hat. Denn was aus innerer Kraft hervorging, wird auch dem Anderen wieder zum inneren Besitz: jeder große Künstler prägt unserer Seele das Abbild der Welt ein, das er selbst sich geformt, und so Viele uns mit ihren Anschauungen durchdrungen haben, so viele Weltbilder sind in uns lebendig und wirksam.
[4] Hier liegt ein Geheimnis verborgen. Der geniale Bildner offenbart uns in der Natur ein allgemeinsam Verständliches, denn sonst würden seine Hervorbringungen uns Anderen ewig fremd und unfaßlich bleiben, und doch ist seine Vorstellung eine höchst persönliche, sondergeartete, denn sie unterscheidet sich von jeder anderen. Nur indem er, ganz der Anschauung hingegeben, sich seiner selbst entäußert, wird er zum Schöpfer, und doch wird sein Werk zum stärksten Ausdruck seiner Persönlichkeit. Die Ahnung, wie dieser Widerspruch sich aufheben lasse, dürfte einzig Dem zuteil werden, welcher die Erkenntnis sein eigen nennt, daß die Welt unsere Vorstellung ist; aber freilich indem er nicht streng an der ästhetischen Ideenlehre Schopenhauers festhält, so unumstößlich ihm auch ihre metaphysischen Grundtatsachen dünken müssen. Wäre das künstlerische Schauen ein Schauen der Ideen selbst, so bliebe es unerklärlich, wie jeder große Künstler eine nur ihm eigene Anschauung hat und ihr eine nur ihm eigene Gestaltung verleiht; dann in der Tat müßte das Persönliche ganz aufgehoben erscheinen, denn die Ideen sind unveränderlich und unwandelbar sich gleichbleibende, und die Schöpfungen aller Genies müßten ununterscheidbar sein. Beschränken wir uns aber darauf zu meinen, daß der künstlerischen Auffassung das Vermögen wesentlich ist, in der unendlich zersplitterten Vielheit der Einzeldinge die Einheit und damit in dem scheinbar Willkürlichen das Notwendige, in dem Ungebundenen das Gesetzmäßige zu gewahren, so erscheint auch die Möglichkeit einer immer neuen individuell verschiedenen Gestaltung dieser Einheit gegeben, denn unendlich reich ja sind deren Erscheinungsformen. Welche unter [5] ihnen dem Einzelnen sich offenbart, das liegt in der besonderen Anlage seiner Sinnlichkeit, seines Gefühles und seiner Phantasie vorgebildet — welche Harmonie in ihm erklingt, das hängt von der Stimmung der Saiten in ihm ab. Und diese eben ist das Persönliche: es bleibt lebendig wirksam auch dann, wenn der künstlerische Akt der Selbstentäußerung, welcher ja doch nur auf das egoistische Begehren und Wollen sich bezieht, eintritt, ja das Persönliche gelangt erst hierdurch zur reinen und starken Betätigung. So bezeichnet denn der künstlerische Vorgang die Befreiung des Persönlichen vom Egoistischen, und damit die Harmonisierung des Persönlichen, dessen reines, in die Erscheinungswelt hinausgeworfenes Spiegelbild das Kunstwerk ist. Hieraus wird uns aber weiter nun auch ersichtlich, wie in unserem, der Empfangenden Inneren so verschiedene Weltenbilder, die wir den verschiedenen Genies verdanken, d. h. so viele Veranschaulichungen der Einheit sich miteinander vertragen, wie eine neben der anderen ihr Recht behält und jede eine ganze, in sich abgeschlossene Natur- oder Lebensanschauung bedeutet. Eben weil diese Vorstellungen alle nur Brechungen eines und desselben Lichtes, nämlich Erscheinungsformen des Weltenwesens sind, welches selbst zu erkennen den sterblichen Sinnen versagt ist.
Wieder ist uns ein Abglanz von ihm, wieder eine Naturanschauung durch eine starke Persönlichkeit geschenkt worden. Der Eindringlichkeit, mit der sie uns eingeprägt wurde, der Bestimmtheit, mit der sie in uns verharrt, der abgeschlossenen Gesondertheit, die sie auszeichnet, ist zu entnehmen, daß wir sie einem genialen Schauen verdanken. Der Name Böcklin [6] begreift ein Bereich von Vorstellungen in sich, deren Gewalt sich Niemand auf die Dauer hat entziehen können. Nun, da das Auge des Meisters sich geschlossen, da die seit Jahren zitternde und immer doch schaffenskräftige Hand den Pinsel nicht mehr führt, verlangen wir, uns über die Bereicherung, die unsere Seele durch ihn erfuhr, klar zu werden.
Nicht auf eine schon oft gegebene Analyse der seiner Kunst eigentümlichen Elemente in Form, Farbe und Technik kann es uns da ankommen, so bedeutungsvoll sie sind. Aus ihnen, vor allem aus der Gewalt der Farben und der Intensität des Lichtes, in der er die Natur sah und uns sehen lehrte, möchten wir vielmehr schließen auf dasjenige, was durch solche Faktoren ausgedrückt wird, was ihnen zugrunde liegt, was sie bedingte. Denn dieser große Maler war mehr als ein Schilderer, er war ein Deuter und ein Dichter der Natur, ein Erfinder. Alle Eindrücke, welche seine starke Sinnlichkeit empfangend schuf, verwandelten sich in gleich starke Gefühlsstimmungen, und deren Erklingen weckte vor dem geistigen Auge seiner Phantasie neue, ungesehene Bilder, die sie schöpferisch gestaltete. Jedes Werk der Ausdruck einer solchen Stimmung, das Bekenntnis psychischer Herrschaft über die Erscheinungswelt, die Verkündigung dichterischer Souveränität! Nicht ein Sklave, sondern ein Freier tritt er der Natur gegenüber, denn er weiß sich ein Teil von ihr und ihre Schöpferkraft fühlt er in sich. Auch die Hervorbringung seines Geistes ist ein natürliches Produkt und trägt als solches ihre Berechtigung, ja Notwendigkeit in sich. Weil er sich im Einklang weiß mit der Natur, darf er die Möglichkeiten, die in ihr schlummern, weiter entwickeln, [7] ihre Elemente zu neuen Bildungen vereinigen, ihre Erscheinungsformen steigern, dessen sicher, daß er dem Gehalt durch die Form «höchste Gewalt» zu verleihen vermag. Nur der von aller Konvention Losgelöste, welcher als Natur der Natur tiefinnig verbinden ist, wird mit solcher Freiheit begnadet — keine frevelhafte Willkür ist von ihm zu befürchten, die Heiligkeit der Lebensgesetze wohnt in seinem Busen. So, wie er, steht ein ursprüngliches Volk mitten innen in der Schöpfung, so wie er macht es dichtend und gestaltend seine Menschenrechte auf sie geltend. Und so entsteht bei ihm wie bei dem Volke die Mythenbildung. So erschließt er, der Unabhängige, aus den engen Schranken einer künstlichen Zivilisation und einer ängstlichen Kunstregel uns mit sich fortreißend, die Wunder eines herrlichen vollen Daseins. Mit ihm, der in solchem grenzenlosen Bereiche daheim ist, sollen wir, nicht die zage Sehnsucht, nicht das scheue Entzücken, nicht die sanfte Schwärmerei des Wanderers, welcher der Natur nur an einem Feiertage sich anvertraut, empfinden, nein, in frohlockender Sicherheit unseres eigenen Wesens die feurige Kraft unlöslicher Gemeinschaft mit Himmel und Erde, Wolken und Wasser in uns wirken fühlen.
Nur die seltenste Glut der Sinne und des Gefühles aber vermag uns in solcher Weise der Natur zu verbinden — dem Schwachen entzündet sich nicht der göttliche Funke zwischen Wesen und Erscheinung in den Sinnen, in denen inneres Sein und äußere Welt miteinander in Berührung treten. Wie eine Flamme aber lodert die Empfindung in dem Auge, das Gefühl in der Seele dieses Künstlers auf, [8] wenn sein Blick die Natur trifft. Eine höchste Betätigung seines leidenschaftlichen Wesens schafft den Eindruck. Fast gewaltsam erscheint der Akt des Empfangens, als eine Bewältigung des Stärksten, was von der Erscheinung den Sinnen dargeboten werden kann — oder, richtiger gesagt, da das Empfangen ja eben eine Tätigkeit ist, als das Ausstrahlen einer unbändigen Energie in die Außenwelt.
Nun steht die Welt entflammt, von glühendem Lichte durchdrungen, nun leuchten alle Farben in heißem Drange auf, nun türmen sich in schroffer Starrheit die Felsen empor, nun ballen sich die Wolken zum vernichtenden Angriff, nun bäumt sich drohend die Welle, nun läuft ein Zittern durch die tausend Blätter des Baumes, nun zieht, süße Liebe weckend, der Frühlingswind über die blühenden Fluren, nun atmet die feuchte Erde Kühlung in heimlichen Schatten aus, nun grüßen die Sonnenstrahlen die fernen Höhen, nun senkt sich die Nacht in bangen Schauern — alles, selbst das Schweigen des Waldes, selbst die Regungslosigkeit ragender Zypressen, selbst die Meeresruhe wird zu einer Handlung der Natur, zu einem Vorgang, dessen Geheimnis in der leidenschaftlichen Seele dieses Dramatikers sich verbirgt. Mit jedem Worte ruft er uns zu: die Natur ist nur, weil ich sie fühle, und sie ist, wie ich sie fühle.
Unter dem weiten Himmel,
Auf der unendlichen Erde,
Alles, was mich je erquickt von Wonnegefühl,
Was in des Schattens Kühle
Mir Labsal ergossen,
Der Sonne Liebe jemals Frühlingswonne,
Des Meeres laue Welle
Jemals Zärtlichkeit an meinen Busen angeschmiegt,
Und was ich je für reinen Himmelsglanz
Und Seelenruhgenuß geschmeckt —
Das all all — — meine Pandora!
So liebt der Starke die Starke mit Sinnen- und Seelengewalt. Wenn er im Widerstreit üppig gesättigter Farben deren Wahlverwandtschaft entdeckte und sie zum Bunde einander zuführte, wenn er den Kampf zwischen dem auflösenden Licht und dem in sich gefestigten Körper suchte, um ihre Versöhnung in räumlicher Klarheit zu bewirken, wenn er Strenge, ja Herbheit der Form mit Anmut und Zartheit der Bewegung zum Einklang zwang, wenn er jauchzenden Übermut und träumerische Versunkenheit zusammentönen ließ, wenn er mit einem Worte gerade das Gegensätzliche in[1] höherer Einheit auflöste, so erscheint er uns wie ein stolzer Werber, welcher sich nur einer Geliebten hingibt, die seinem Freien mit der gleichen Kühnheit hohen Selbstbewußtseins und wogender Kraft begegnet. Angesichts der Vereinigung selbst erleben wir schauend noch das Ringen mit, das ihr vorangegangen — die Erregung zittert in uns nach. Wie kann es uns da wundernehmen, daß wir häufig, namentlich in den Werken aus der späteren Zeit des Meisters, von dem Gefühl beunruhigt werden, solche Verbindung sei auf die Dauer nicht denkbar, sie sei nur das Werk eines höchst gesteigerten Augenblickes!
Alle Kraft leidenschaftlichen sinnlichen Empfindens und seelischen Fühlens, wie das in ihr begründete Verhältnis Böcklins zur Natur, gewann Gestaltung nicht minder persönlicher [10] Art in seiner dichtenden Phantasie. Aber die in ihr wachgerufenen Vorstellungen wurden, ein so besonderes Gepräge sie trugen, doch stark bedingt und bestimmt durch Bilder, die nicht aus unmittelbaren anschaulichen Eindrücken, sondern aus der Dichtung vergangener Zeit gewonnen waren. Einem Geist, der wie der Böcklinsche, die Einheit des Natürlichen und Menschlichen suchte, konnte nur die griechische oder die germanische Mythologie befriedigenden Vorstellungsstoff geben. Daß ihm, dem doch so germanischen Wesen, nicht die nordische Sage, die zu gleicher Zeit ihre wunderbare Auferstehung und höchste künstlerische Ausgestaltung in der Tragödie Richard Wagners fand, Quell der Inspiration ward, könnte befremden, läge die Erklärung nicht sehr nahe. Eben zur Zeit, als er sein Ideal sich zu bilden begann, vollzog sich ja erst in der Schöpfung des «Ring des Nibelungen» die Verdichtung des formlosen germanischen Mythos zur plastischen Klarheit, enthüllte sich aus dem Nebel unserer weit entrückten Vergangenheit Gott und Held als vollendetes Abbild unserer Natur. Dem nach dem Schönen sich sehnenden Maler hatte sich aber schon der strahlende unvergängliche Tag griechischen Sehergeistes erschlossen, und während er sich den Eindrücken der Natur hingab, fällte sich seine Einbildungskraft mit den Gestalten Homers. Die Dichtungen, in deren Nacherleben er, mehr als in allen anderen, sein ganzes Leben hindurch das tiefste Genüge gewonnen hat, sind die Ilias und die Odyssee gewesen. Hier fand seine Einbildungskraft die Nahrung, aber nicht in dem Sinne, welcher den antikisierenden Künstlern der älteren deutschen Generation vor ihm verhängnisvoll geworden war, [11] nicht in dem Entlehnen bestimmter Stoffe und individueller Gestalten aus der antiken Mythologie und Geschichte, auch nicht in einer Reproduktion der alten Formensprache, sondern in großen Vorstellungen von Natur und Mensch, welche sein Gefühl auf das Erhabene stimmten. Zu ihnen gehörten neben den landschaftlichen die ewig lebendigen Naturpersonifikationen allgemeiner Art: die wildfreudigen Mischgestalten, die auf hoher Meeresflut und in kalter Bergesöde daheim, die zarten Geister von Busch und Hain; Alles, was namenlos und ranglos das freischweifende Leben dem Sitz auf goldenen Thronen und dem Herrschen durch Arbeit und Taten vorgezogen hat, da es die Tat nur im Leben selbst findet: Kentauren, Faune, Tritone, Nereiden, Nymphen, aber auch eine leicht wandelnde, nur von durchsichtigen Schleiern umflossene städtefremde Menschenart, ein Priestertum der Natur, drängte sich vor sein inneres Gesicht und machte sich heimisch in dem Landschaftsreiche seiner Phantasie.
Schauend lauschte er dem Zauber des Peneios:
Rege dich, du Schilfgeflüster,
Hauche leise, Rohrgeschwister,
Säuselt, leichte Weidensträuche,
Lispelt, Pappelzitterzweige,
Unterbrochnen Träumen zu!
und seine Antwort klang:
Ich wache ja! O laßt sie walten,
Die unvergleichlichen Gestalten,
Wie sie dorthin mein Auge schickt.
So wunderbar bin ich durchdrungen!
Sind's Träume? Sind's Erinnerungen?
[12] So waren es «Geistertöne», die seiner feurigen Liebe zur Natur als Brautlied erklangen, und die Gestalten, die er schuf, waren ihre Verkörperung. Von zwei Hauchen ward sein inneres Saitenspiel bewegt: von der lebendigen Natur und vom antiken Dichtergeist, und die Schwingungen flossen ineinander zu einer geheimnisvollen Harmonie. —
War es denn aber wirklich eine Harmonie? Ward der Traum so vieler Edlen hier zur künstlerischen Wirklichkeit? Man möchte eine solche Frage lieber nicht gestellt wissen. Und doch führt nur ihre Beantwortung zur Erkenntnis des Wesens der Böcklinschen Kunst und schließt die Beantwortung unserer Frage: welche Vorstellungen von Natur und Mensch er uns geschenkt, in sich.
Dasselbe Problem, das uns schon bei Betrachtung seiner Naturanschauung entgegentrat, das Aufsuchen von Gegensätzen und das Verbinden begegnet uns wieder. Hier aber stellt sich uns der zu schlichtende Widerspruch dar als einer zwischen moderner und antiker Naturanschauung — in einem ganz weiten Sinne gefaßt, als einer zwischen Landschaft und Mensch, zwischen allgemeiner zerfließender Seelenstimmung und gesammeltem Lebensbewußtsein, zwischen dem Unermessenen und dem Begrenzten. Durch welche Mittel ward die Aussöhnung zu erreichen gesucht? Jedes einzelne Werk belehrt uns darüber, selbst solche, in denen keine antikische, sondern eine religiöse Vorstellung oder eine romantische, mochte sie der mittelalterlichen Dichtung oder der freien Erfindung entstammen, Gestaltung gewann, denn das antike Ideal spielt auch in sie hinein.
Als moderner Maler mußte Böcklin vor allem Landschaftsmaler [13] sein. Wohl nahm er die menschliche Gestalt in seine Konzeption von vornherein mit auf, doch ward sie einem Ganzen der Natur eingefügt, und dieses Ganze bestimmte ihren Charakter. Sollte aber dem Landschaftlichen der aus griechischem Geiste erfundene Mensch sich harmonisch anschließen, so ergab sich dem genialen Blick zweierlei ganz von selbst: erstens die Wahl der strahlenden offenen Natur des Südens und zweitens die klare und bestimmte Hervorhebung der landschaftlichen Einzelheiten: der Berg, der Fels, der Baum, die Wolke, die Welle, ja die Blume, jegliches erhielt durch scharfe kontrastierende Abhebung in Form und Farbe von der Umgebung eindrucksvolle Sonderexistenz. Durch die Individualitäten, in welche die Landschaft aufgelöst wurde, ward diese der plastisch bedeutungsvollen menschlichen Erscheinung angenähert, durch die Individualisierung der Übergang vom Naturganzen zur vereinzelten menschlichen Gestalt erzielt. So wird dem Felsen, dem Baum fast gleicher räumlicher Wert wie dem Menschen verliehen, so erhält alles schlank Aufragende und sich deutlich vom Anderen Abgrenzende: die Zypresse, die Pappel, ihre besondere Aufgabe. So wird im Drange, den antiken Menschen sich einzuverleiben, ohne in Widerstreit mit dem Abgeschlossenen, Vollendeten seiner Erscheinung zu gelangen, die Landschaft bei Böcklin eminent plastisch. Das Licht, von dessen Fluten die Einzelgebilde der nordischen Stimmungslandschaft verschlungen worden waren, dient hier nur zur starken Hervorhebung des Gesonderten, wie zugleich die Farben in ihren Kontrasten diese Individualisierung verstärken. Das so in seine Bestandteile zerlegte Ganze uns dennoch [14] aber wieder als Einheit fühlbar zu machen, konnte dem Meister nur gelingen, wenn er den räumlichen Zusammenhang auf das klarste veranschaulichte und zugleich eine stärkste koloristische Harmonie erzwang, welche alle Einzelgestalten umspannt. Diese mächtige Farbenwirkung ist es, die am entschiedensten die Stimmung in uns hervorbringt, und so dürfen wir den zwischen Antikem und Modernem im Landschaftlichen hergestellten Kompromiß darin sehen, daß die antike Auffassung den plastischen, die moderne den farbigen Charakter der Landschaft bestimmte, und daß durch solches Verhältnis die äußerste Steigerung einer Koloristik, die in Kontrasten wirkt, bedingt wurde. Beides: die wunderbare Erregung, in welche uns diese Naturdarstellung versetzt, wie die Härte und Gewaltsamkeit, die ihr häufig eigentümlich ist, wird uns erklärlich. Was wir in der früheren Betrachtung als die Äußerung feuriger Sinnlichkeit und leidenschaftlichen Gefühles erkannten, tritt uns nun, von der anderen Seite der Phantasietätigkeit her betrachtet, als das Ergebnis der Durchdringung antiker und moderner Vorstellungen entgegen.
Lernten wir im vorausgehenden die Anpassung gleichsam der neueren Naturauffassung an die hellenische Menschenverherrlichung kennen, so beschäftigt uns nun die Frage: wie war der antike Mensch der modernen Landschaftsstimmung anzupassen? Was hatte er aufzugeben, um zu einem integrierenden Teil des Naturganzen zu werden? Es ist der entgegengesetzte Vorgang, der uns hier vor Augen tritt, und wie dort machen sich zwei Erscheinungen geltend. Die erste, wiederum auf südlichem Boden, in Italien, unter Einwirkung [15] von Lebenseindrücken sich vollziehende ist die Beseelung des antiken Menschen mit modernem Empfinden. Sie zeigt sich als eine Milderung des Strengen in der griechischen Auffassung, als eine stärkere Verdeutlichung des Gefühlslebens in der Erscheinung, als eine Steigerung des sinnlich Reizvollen und des drastisch Wirksamen. Es ist bezeichnend, daß diese Umwandlung sich im wesentlichen an der Frau und an dem antiken Fabelwesen vollzieht, nicht in gleichem Grade an dem Mann, der nur im Knaben- und früheren Jünglingsalter dem Wunsche des Künstlers, Stimmung auszudrücken, entgegenkommt. Denn eben die gemütliche Bewegung ist es, durch welche der so beseelte antike Mensch in die moderne Naturstimmung einbezogen werden kann. Zweierlei Charakter aber, wenn wir ganz im allgemeinen unterscheiden und die Übergänge unberücksichtigt lassen, kann dieser zu eigen sein: Friedlichkeit oder Erregung, Ruhe oder Sturm. Der erste gewinnt seine menschliche Erscheinung in den zarten weiblichen, den jugendlichen und kindlichen Elementen, der zweite in dem ungestüm wilden, dämonischen Wesen der Kentauren und Tritonen. Dort Träumerei, Ahnen, Schwermut, aber auch zarte helle Lust und seliges Genießen aufblühenden Matten, in lauschigen Gründen, an sanftem Wasserspiegel, bei sprudelnder Quelle, in lautlosen Zypressenhainen, auf einsamen Bergeshöhen, in dämmerndem Walde, auf spielenden Meereswogen — hier Taumel, Leidenschaft, Kampf, Verzweiflung in donnernder Wogenbrandung, in brausendem Sturme, in entflammten Burgen, unter jagenden Wolken.
Da muß das griechische Wesen vom Germanischen [16] sich durchdringen lassen, Helena Faustens Sprache lernen. Des Deutschen Schwärmerei in Sehnsucht und Träumen, des Deutschen Phantastik in Humor und in Leidenschaft bemächtigen sich der antiken Schönheit — nur so verwandelt konnte sie in dem Naturbilde, das vom Modernen zum Spiegel der Seele gemacht ward, aufgehen. Welch wundersame Mischung von Naivität und Empfindsamkeit, von Unbewußtsein und Bewußtsein, von Natürlichkeit und Absichtlichkeit in diesen Geschöpfen, die, nach Jahrtausenden auferweckt, zugleich in Vergangenem und im Gegenwärtigen zu leben genötigt sind!
Wie dem Wesen, so hatte aber auch der Erscheinung nach der antike Mensch sich zu verwandeln, sollte er nicht von dem modernen Landschaftsstimmungsbilde als ein Heterogenes ausgeschlossen bleiben. Dies ist das andere Phänomen, das mit dem soeben geschilderten zwar innig verbunden ist, aber doch besonders betrachtet sein will. Erkannten wir früher, daß das Landschaftliche, um dem antiken Menschen angenähert zu werden, plastisch werden mußte, so zeigt sich nun die in Böcklins Ideal begründete Notwendigkeit, das plastische Wesen der griechischen Gestalt dem Malerischen der neueren Naturauffassung anzunähern. Hatten, wie die antiken Dichtungen, so auch antike Bildwerke die Phantasie des Künstlers während seines ersten italienischen Aufenthaltes inspiriert, «erkannte», «ergriff» sein verlangendes Gefühl in ihnen die Schönheit, vor welcher «wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn», so mußte sein schöpferischer Sinn in ihr doch nicht ein starres Unveränderliches, sondern ein immer neu zu Gestaltendes gewahren. Er, der Maler, erblickte den [17] schönen Menschen nicht in Vereinzelung, wie der Bildner der Statue, sondern im Zusammenhange mit der schönen Natur: «im Frühlingsgefolge» sah er die Schönheit herrlich antreten:
Sie steiget hernieder in tausend Gebilden,
Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilden.
Nur eine ihrer Erscheinungen unter vielen war für ihn der Mensch; mit Vielem mußte dieser sich zu einem Ganzen verbinden. Wie hätte er sich da in seiner scharf abgegrenzten Abgesondertheit, in seiner plastischen Bestimmtheit, in dem ganzen Reichtum seines Lebensorganismus erhalten können? Die äußerste Geschlossenheit und Festigkeit der antiken plastischen Form mußte einer Betonung der malerischen Werte weichen; es vollzieht sich eine Abschwächung im Knochengefüge, eine Verflüchtigung der starken Linienbegrenzung, eine Erweichung der Formen, eine Verallgemeinerung des organischen Zusammenhanges der Teile. Die Gewandung der Frauen verfeinert und entstofflicht sich bis zu durchsichtigen, wie sanftes Wellenspiel sich faltenden zartesten Geweben, sinnlicher Reiz umschimmert ihre Gestalt, strömt aus dem schmelzenden Blicke großer Augen, atmet aus träumerischen Gebärden und Mienen; wie andererseits Sinnengewalt, zu animalischer Willkür entfesselt, in Verlangen, Genießen und Kämpfen das Leben der zottigen, ungeschlachten, begehrlichen Mischwesen beherrscht.
Und was bedeutet denn diese Umwandlung des antiken Menschen und Tiermenschen, dessen große Erscheinung in den Böcklin’schen Figuren noch wie durch eine Verkleidung hindurch sich geltend macht, was bedeutet sie Anderes, als eine [18] Zurückführung höchst entwickelter Organismen näher an die vegetabilischen und elementaren Gestaltungen der Natur? Seiner einsamen Herrscherstellung beraubt, wird der Mensch wieder zu einem Geschöpf der Natur, wie es die anderen auch sind. Jugend und Weiblichkeit findet in Blumen, Halmen und schlanken Bäumen ihre Verwandten, vegetierend wie sie; sie vergleicht sich wiegend der Welle, die sie trägt. Tierische Formen annehmend, das Geistige abstreifend aber nähert sich männliche Kraft und Begier dem dunklen Drange, der im Wogensturze, in Gewitterbrunst, im Beben der Erde sich äußert. So verliert sich der Mensch wieder hinein in die Natur. Die Hellenen hatten ihn emporgetragen zu olympischen Höhen; germanisches Sehnen lockt ihn in die Tiefen allgemeinsamen Daseins zurück.
Der Bund ist vollbracht: Germanisches und Griechisches hat sich vereinigt. Die moderne Landschaft hat den antiken Menschen in sich aufgenommen. Damit es möglich werde, nahm die Landschaft, aus den Elementen südlicher Natur gebildet, soweit es ihr möglich, plastische Formung an, ließ der antike Mensch, vom Hauche modernen Empfindens zu Stimmungen bewegt, von seinen hohen Rechten und schmiegte sich, dem malerischen Stimmungsbedürfnis willfahrend, den niederen Geschöpfen und den Kräften der Natur an. So erstrebten, so erreichten die beiden Welten ihre gegenseitige Durchdringung. — Haben sie diese wirklich erreicht? Die Frage kehrt wieder.
Wäre dieser ganze künstlerische Akt ein Werk der Reflektion gewesen, so bliebe von vornherein nur eine verneinende Antwort übrig. Was wir uns verstandesgemäß [19] klar machen mußten, ging aber in der Phantasie des Künstlers reflektionslos einzig aus dem Zusammenwirken von Natureindrücken und dichterischen Bildern hervor. Es war das Werk der innigst verbundenen Betätigung einer starken Sinnlichkeit, einer leidenschaftlichen Gefühlskraft und einer schöpferischen Phantasie. Aus innerer Notwendigkeit also ward das Ideal dieser Kunst erzeugt und daher ist es, als der vollkommene Ausdruck einer bedeutenden Persönlichkeit, ein in sich selbst begründetes und abgeschlossenes, welches seine besondere Gesetzmäßigkeit besitzt.
Von einer anderen Seite her aber, von dem Standpunkte einer allgemeineren ästhetischen Auffassung aus betrachtet, stellt sich das Problem in verschiedenem Lichte dar. Bei aller rückhaltlosen, ja leidenschaftlichen Bewunderung für die Gewalt, mit welcher Modernes und Antikes von diesem Geiste zusammengeschweißt wird, läßt uns gerade diese Gewalt darauf schließen, daß solcher Bund doch ein erzwungener, nicht ein natürlich sich ergebender war. Erschien uns früher das Werben des Meisters um die Natur fast wie ein Kampf, so haben wir nunmehr die Erklärung hierfür gewonnen: die Welt der Erscheinungen, die er sich künstlerisch zu eigen machen wollte, war eine zwiespältige. Sie setzte als solche seinem Streben, sie als eine Einheit zu erfassen, Widerstand entgegen. Nur durch eine unerhörte Anspannung der Kraft der Farben und damit der Sinnenkraft im Schauen konnte er den Widerstreit bändigen. Eine Überwältigung unseres Gesichtssinnes muß das Dilemma lösen und täuscht den Maler und uns über den Widerspruch hinweg. Aber dieser bleibt dennoch bestehen, gibt es auch [20] Werke, in denen er fast vollständig gehoben scheint. Er offenbart sich allgemein in Härten und Schroffheiten, in brennenden, beängstigenden Farbenwirkungen, in grellen koloristischen Kontrasten und im besonderen bei dem Figürlichen in Übertreibungen des Charakteristischen, welche sich in den Frauengestalten nach der Seite des Überzarten und Sentimentalischen, in den Mischwesen und in den Tieren nach jenen des Grotesken geltend machen. Wir mögen die Genialität, die gerade in diesen Erscheinungen erstaunlich sich äußerte, mit hohem Staunen verehren, gerade im Übertreibenden des Ausdrucks, in dem innig Träumerischen, wie in dem bald Humoristischen, bald Dämonisch-Phantastischen der Gestalten die echtesten Wesenseigentümlichkeiten des Germanen mit Freudigkeit begrüßen — unser Eindruck ist kein ganz reiner; mächtig von diesen Werken angezogen und in seelische Erregung versetzt, werden wir doch des Gefühles nicht ledig, einem Fremdartigen gegenüberzustehen, in das wir uns nicht ganz zu verlieren, das wir uns nicht ganz zu eigen zu machen vermögen. Was sich uns so unwiderstehlich sinnlich aufdrängt, scheint doch wieder ins Unerreichbare zu entfliehen, was uns so natürlich dünkt, ist doch zugleich ein Geisterhaftes. Wie könnte es anders sein? Auch der Stab des größten Zauberers kann in unsere Welt nur Schatten aus den elyseischen Gefilden des Griechentums hervorlocken; so stark er ihnen den Schein neuen Lebens verleiht, es bleiben Geister!
Daß Arnold Böcklin aber ein solcher Zauberer war, wer möchte das leugnen — ferne lag es uns, in dem vorhergehenden eine Kritik haben geben zu wollen, nicht Kritik, [21] nur eine Deutung seiner genialen Kunst und ihres Problemes, die uns zu dem so rätselvollen Grunde eines Meisterschaffens führte. Wir haben in ihn hinabgeschaut: im Persönlichen das Ideal, im Ideal das Persönliche gewahrt. Dürfen wir uns nun auch den Eindruck dieser Werke und die Naturanschauung, welche uns diese Persönlichkeit geschenkt, deuten? Dürfen wir sagen, daß das Große, das unwiderstehlich Fesselnde des uns erschlossenen Zauberreiches in seiner Wirkung auf uns als ein Geheimnisvolles beruht, weil in der Fülle der sinnlichen Kraft der Natur uns das Dämonische geoffenbart wird? Als geheimnisvoll aber auch in der Veranschaulichung des Verhältnisses des Menschen zur Natur, denn der Mensch wird uns gezeigt als ein Wesen, das nach seinem Gefühle und Sinnenleben nur ein Teil dieses Dämonischen und der Natur ewig unterworfen ist, an sie gekettet durch Wonne und Weh, aber eben nur seinem sinnlichen Wesen nach ihr angehörig und nur durch den Verzicht auf geistige Autonomie der Allgemeinsamkeit sinnlichen Lebenswirkens ganz teilhaftig! So wird im Augenblick eines selig gehobenen Empfindens aller Fülle und Herrlichkeit der Natur in uns ein schmerzliches Sehnen nach einer immer möglichen Heimkehr in ihr Reich geweckt, und in Schwermut verklingt des Schauens Rausch.
Unwillkürlich ruft sich da die Phantasie die Bilder unseres anderen großen Malers, der die Einheit von Natur und Mensch verherrlicht hat, hervor: Hans Thoma’s! Ein verwandtes Ideal zeigt sich, aber wie verschieden seine Gestaltung, wie verschieden die Wirkung! Wie erklärt es sich doch, daß Thoma’s Werke kein so zwiespältiges Gefühl, sondern reine [22] Harmonie und tiefinnere Befriedigung in uns hervorbringen? Einzig daraus, daß sich kein Ideal längst vergangener Zeit zwischen die Seele des Künstlers und die Natur drängte, daß er, unbeeinflußt von der Schönheit der Antike, unverrückbar im heimischen Boden wurzelnd, aus germanischem Gefühl und Phantasie seine Kunst sich entfalten ließ. Auch er der Schöpfer einer neuen malerischen Naturanschauung, auch er ein Entdecker einer neuen Farbenharmonie in der Welt, auch er ein Dichter, dem Stimmungen zu Gestalten werden, aber als solcher ein Friedensverkündiger, der uns von aller Schwermut des Lebens befreit, indem er uns traulich der Natur als der allezeit nahen beseligenden Freundin zuführt, das Paradies uns in jedem Augenblick und rings uns umgebend offen zeigt!
Auch solchem Vergleiche dürfen wir wichtige Belehrung entnehmen, setzt doch das eine künstlerische Schaffen das andere in helleres Licht. In dem so verschiedenen offenbart sich ein tief Gemeinsames — es wurzelt in gleichem Grunde: im deutschen Wesen. Denn von diesem künden trotz allem die Böcklinschen Schöpfungen nicht weniger als diejenigen Thoma’s. Nur eine andere Seite erschließen sie uns. Oder wäre die leidenschaftliche Sehnsucht Faustens nach Helena nicht ein unausrottbares Bedürfnis deutscher Seele? Und was anderes hat der Meister, dessen Gedächtnis wir in Verehrung feiern, geheimnisvoll und wunderbar in uns durch seine feurigen Gebilde wachgerufen, als jenes Schauspiel, welches Goethe-Faustens verzaubertem Blicke auf den pharsalischen Feldern, an den Gewässern des Peneios und in Felsbuchten des ägäischen Meeres sich darbot? Haben nicht [23] auch ihm Greifen und Sphinxe ihre Weisheit zugeraunt, nicht die Sirenen ihm gesungen, zogen nicht Nymphen und Schwäne vor ihm auf dunklem Wasserspiegel, hielt er nicht Zwiesprache mit Chiron, der die schönste der Frauen auf seinem Rücken trug, fühlte er nicht des Seismos Gewalten, rief er nicht mit Anaxagoras Diana Hekate, die «Gewaltsaminnige» an, umrauschten ihn nicht Telchinen, Tritonen und Nereiden? Auch aus ihm erklang es:
Heil dem Meere, Heil den Wogen,
Von dem heiligen Feuer umzogen!
Heil dem Wasser! Heil dem Feuer!
Heil dem seltnen Abenteuer!
Heil den mildgewognen Lüften!
Heil geheimnisreichen Grüften!
Hochgefeiert seid allhier,
Element’ ihr alle vier!
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Vorlage: iu