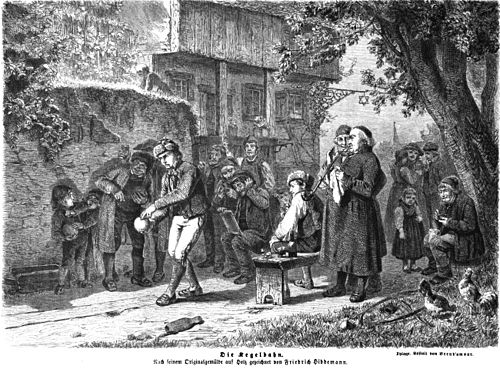Die Gartenlaube (1864)/Heft 5
[65]
| No. 5. | 1864. | |
Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.
Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 15 Ngr. zu beziehen.
Die Hochherzigkeit des deutschen Volkes von 1813 will in unsern Tagen sich erneuen. Herz und Hand der ersten deutschen Frauen und Jungfrauen brachten damals dem Vaterlande und der Freiheit die theuersten Opfer, und selbst vom liebsten Schmuck trennten sie sich, wenn es galt, ihn auf den Altar des Vaterlandes niederzulegen.
Von deutscher Frauenhand – ich weiß nicht, ist’s eine reiche oder arme – ist mir der erste goldene Schmuck für Schleswig-Holstein geopfert worden mit der Bitte, ihn zu verwerthen für die uns Allen heilige Sache. Ich danke der edlen Frau, deren Namen ich nicht einmal kenne, hierdurch öffentlich, da ich es brieflich nicht vermag. Ihr Wunsch soll in Erfüllung gehen, aber nicht auf dem kurzen Wege des Verkaufs, sondern vor dem ganzen deutschen Volke auf dem der Versteigerung! Der Goldwerth dieses Schmuckes (Broche) ist auf 5 Thaler abgeschätzt, der geschichtliche Werth, den er als erstes Kleinod erhielt, das in unserer verhängnißvollen Zeit für das Vaterland dargebracht ward, ist unschätzbar.
An Alle, die der Himmel mit den Gütern des Lebens gesegnet und die ein Herz für die Sache des Vaterlandes haben, richte ich nun die freundliche Bitte, ihre Angebote auf den Schmuck einzusenden. Dem Höchstbietenden wird der Schmuck zufallen, der Erlös aber als eine Separatgabe in die Hände der Herzogin Adelheid von Schleswig-Holstein zur Verwendung für patriotische Zwecke niedergelegt werden.
Möge die Gabe der edlen Frau und meine Bitte ein von der Heiligkeit der Sache durchdrungenes Gemüth finden!
Durch das Abnehmen des Kranzes war die Malerei und die Schrift auf dem Täfelchen mehr sichtbar geworden, und unwillkürlich las Sabine den am Ende angebrachten frommen Spruch:
„Bedenk’ es wohl, mein lieber Christ,
Weißt nie, wie nah’ das Sterben ist!“
Sie hatte diese Worte wohl schon unzählige Male gelesen, ohne davon einen besonderen Eindruck zu erhalten; diesmal aber dröhnten sie ihr in Ohr und Herz wie ein in nächster Nähe vernommener unvermutheter Glockenschlag. Welch’ furchtbare Mahnung lag in diesen einfachen Zeilen, zumal an diesem Orte, wo sie durch den Sturz des Jägers schon einmal eine so schreckliche Bestätigung gefunden und sich heute wieder erprobt hatten, denn auch dem Gefangenen war der Tod nahe und war unerwartet an ihn herangekommen, wie ein Fall aus heiterer, sonniger Höhe.
Wie nahe mochte vielleicht ihr selbst das eigene Ende sein?
Und wenn es unvermuthet – vielleicht noch in dieser Stunde an sie herantrat, wie war sie auf den ernsten Augenblick bereitet? Konnte sie dem Knochenmanne unerschrocken in die leeren Knochenhöhlen der Augen sehen, und nicht erzittern vor dem Schwung seiner Sense? Wenn sie in dieser Zeit abgerufen wurde, hinzutreten vor den Thron Gottes, vor das Sonnenauge des allwissenden Richters, vor dem die Falten aller Geheimnisse sich auseinander legen – zu dem sie so oft gebetet hatte um Gnade „jetzt – und in der Stunde des Absterbens“ … konnte sie vor ihm den Blick erheben? Konnte sie auf Gnade hoffen mit ihrem Herzen, erfüllt von Gedanken des Hasses und der Rache? … Wehe, wenn der ewige Richter ihr zumaß mit dem Maße, mit dem sie ausgemessen hatte … wehe, wenn er ihr vergab, wie sie vergeben hatte ihren Schuldigern!
Mit ungeheurer Angst überfiel sie das Bewußtsein, daß sie von nun auch den Tod eines Menschen auf sich haben werde – eines Menschen, der, wenn auch für sich schuldbeladen, ihr nur Liebe gezeigt, nur Vertrauen erwiesen hatte, und den sie dafür mit Verrath belohnt, ihm einen Stein gegeben hatte statt des Brodes!
Sie kam zu keinem Entschlusse, aber von innerer Unruhe gegeißelt, eilte sie aus der Schlucht, zur Straße hinab – sie mußte wissen, wie es um den Verrathenen und Gefangenen stand.
Die Straßenbeugung, wo der Verhau angebracht war, war schnell erreicht, durch ein Gebüsch an der Anhöhe verdeckt, konnte sie das ganze Bollwerk überblicken. Es war dicht mit Bewaffneten besetzt, denn wenn auch die ersten Vertheidiger sich ermüdet zurückgezogen hatten, waren sie durch doppelt so viele Neuangekommene ersetzt; hatte sich doch der Lärm verbreitet und die ganze Burschenschaft der Gegend in Waffen herbeigeführt. Der eisgraue Kopf [66] des Vetters war nicht sichtbar; Lipp aber stand mit Einigen beisammen, in eifrigem Gespräch und unverkennbar die Ereignisse der Nacht erzählend.
Der Gefangene war nirgends zu erblicken, er mußte also schon fortgeführt worden sein oder war in der Kohlhütte untergebracht, es gab sonst keinen Platz ihn zu verwahren.
Behutsam schlich das Mädchen näher und hatte auf einem Umwege durch den Wald rasch die Hinterseite der Hütte erreicht, an welcher, gegen den Wald ausmündend und abgewendet von dem Verhau und seiner Besatzung, eine Hinterthüre und neben dieser eine kleine Fensterluke angebracht war.
Sie rollte ein Baumstück herbei und stieg hinauf, um hinein sehen zu können.
Es war beinahe dunkel in dem engen, modrigen Raume – nur in schwachen Umrissen war in der Ecke ein Haufe dürrer Blätter zu erkennen, die als Laubstreu für den kommenden Winter zusammengerecht waren. Auf demselben lag die stattliche Gestalt des Vomper-Hans, zusammengekauert und mühselig, denn die noch immer auf den Rücken gebundenen Hände hinderten ihn eben so an freier Bewegung, als an bequemer Ruhe und Lagerung. Hastig und gewaltsam warf er sich hin und her, einzelne Laute, die er dabei ausstieß, ließen es unklar, ob er nur unverständlich vor sich hinmurmelte, oder ob es die Erregung des Fiebers war, welche unklar aus ihm sprach. Das Letztere war nicht unmöglich, denn die durch das Binden wieder gereizte und blutende Armwunde mochte wohl die Schmerzen bis zur Betäubung gesteigert haben.
Mit angehaltenem Athem lauschte Sabine den Reden des Gefangenen; was sie davon vernahm und verstehen konnte, waren nur einzelne Worte – Worte der Ergebung und des Gebets, um so ergreifender, je kräftiger die Persönlichkeit des Klagenden, und je hülfloser die Lage war, in der er sich befand. „… Nein!“ rief er jetzt vernehmlicher, „… ich will mir die Augen nit verbinden lassen – ich will selbst Feuer commandiren! …“ Eine Pause trat ein, nur von schweren Athemzügen unterbrochen. „… Eine letzte Bitte?“ flüsterte er dann wieder, als ob er eine nur von ihm vernommene Frage beantwortete … „Ich hab’ keine … laßt mich noch ein Vaterunser beten – für meine Mutter selig … Nein, die ist lang im Himmel, die braucht mein Beten nimmer … ein Vaterunser für mich selbst … und für den Jäger … und für …“
Das Weitere verlor sich in unverständliches Gemurmel.
Sabine vermochte nicht länger an sich zu halten. Die ganze trotzige Kraft ihres Wesens war gebrochen und erweicht, wie der Schnee im Frühling, den die innere Erdwärme mürbe macht, noch ehe die senkrechte Sonne seine schimmernde Decke schmilzt. Sie wollte weinen, aber sie konnte nicht, es kamen keine Thränen mehr, nur ein wildes, schmerzliches Schluchzen erschütterte hörbar ihre Brust.
Der Gefangene richtete sich etwas auf und horchte.
„Ist Jemand da?“ rief er, und als keine Antwort kam, fuhr er fort: „Wenn Jemand da ist … bitt’ ich um einen Trunk Wasser … ich muß verschmachten sonst …“
Sabine antwortete wieder nichts – aber sie eilte zum Lagerplatz, wo sie im Rücken des Landsturms einen großen, irdenen Krug stehen sah, ergriff ihn und eilte damit zur Thüre. Sie war nicht mit einem Schlosse versehen, und daher nur die Klinke mit Stricken festgebunden. Sie löste dieselben, öffnete und die Thüre wieder hinter sich anziehend, wankte sie, kaum ihrer Sinne mächtig, in den dunklen Raum. Hans hatte sich aufgesetzt, mit beiden Händen, das Gesicht abgewendet, hielt sie ihm wortlos den Krug an den Mund.
Er trank gierig und athmete tief auf.
„Wer’s auch ist … vergelt’s Gott tausendmal …“ sagte er und wollte sich wieder auf das Lager zurücklegen, aber die Bewegung brachte in der Wunde einen stärkeren Schmerz hervor, daß er zusammenzuckte und unwillkürlich einen Laut des Schmerzes ausstieß.
Sabine gab keinen Laut von sich, mit fliegendem Athem und glühendem Gesicht kniete sie hinter seinem Rücken nieder und löste die Stricke von seinen Händen. „Vergelt’s Gott noch einmal,“ sagte er, während sie mit bebenden Händen die Einschnitte der Stricke befühlte, die Schürze abriß und sie mit Wasser befeuchtet um die geschwollenen Hände und den wunden Arm schlang. „Ich versprech’ Dir heilig, daß ich nit davon laufen will – es hat nit Noth, daß man mich gebunden wie ein Kalb zur Schlachtbank führt … aber wer ist es denn,“ fuhr er, sich umwendend, fort, „der sich so annimmt um mich …“
„Du?“ rief er, Sabinen erblickend und erkennend, die mit gesenktem Blick in ihrer knieenden Stellung verblieb, aus der sie vor Zittern sich nicht zu erheben vermochte. Er fuhr etwas zurück und sah sie dann lange schweigend mit einem durchdringenden Blicke an, in welchem Staunen und Entrüstung mit einem mildern Gefühle rang. „Du bist’s?“ wiederholte er. „Du kommst zu mir? Das muß ich sagen, Du bist ein unbegreifliches Geschöpf! Erst bist Du gut mit mir und freundlich – dann verräthst Du mich, und jetzt kommst Du wieder zu mir und thust, als ob Du mir gut wärst und als wenn’s Dir leid thät’ um mich … Du hast zwei Gesichter, Madel … welches davon ist das falsche?“
„Das kommt,“ sagte sie halblaut, „weil Du zuerst ein doppeltes Gesicht gezeigt hast … ein redliches, dem man wohl trauen möcht’ … und ein schreckliches, vor dem einen schaudert!“
„Schaudern? Wer weiß!“ erwiderte er. „Vielleicht thätst eher weinen und mich bedauern, wenn Du Alles wissen thätst … Und Du sollst es auch wissen! Ich hätt’ Dir schon oben auf der Alm Alles gesagt, aber es hat nit heraus gewollt aus mir, vor den vielen Leuten … Ich mein’, es müßt’ mir leichter werden, wenn ich’s Jemanden sagen kann – und vor Allen Dir …“
Sabine kauerte seitab im Dunkel auf der Laubstreu, während er begann.
„Ich bin ein wilder Bursch gewesen selbige Zeit … meine Mutter selig hat mir wohl oft zugeredt, aber es hat nichts geholfen, ich hab’ das Wildschießen nit lassen können, und das Herumsteigen auf den Bergen war mir lieber, als daheim die Arbeit und die Kümmerniß in der engen, rauchigen Hütten. In Tirol drinnen war nit mehr viel zu machen mit der Jagerei – dafür hat’s herüben in Baiern desto mehr Hirschen gegeben und Gams, das hat mich verlockt, und ich hab’ mich herüber verdingt in’s Bairische. Da war ich in mein’ Element, und wenn ich frei gewesen bin, sind wohl wenig Nächt’ gewesen, in denen ich nit draußen war im Wald und bin dem Wildpret nachgestiegen. Ich hab’s verwegen ’trieben, die Jäger haben mich bald gespürt und sind mir wie wüthig auf die Eisen ’gangen von allen Seiten – aber der Vomper-Hans ist schlauer gewesen als sie, und wenn es unten geknallt hat und sie haben ihn unten gesucht, ist er wie der Wind schon zu höchst über ihnen gewesen und hat sie ausgelacht! Einmal …“
Er hielt inne, und es war, als ob er eines Anlaufs bedürfe, um fortzufahren.
„Einmal …“ sagte er dann mit gedämpftem Ton, „… Du weißt ja den Tag – bin ich im Zwielicht herüber auf Deine Alm – ich hab’ einen Hirsch gespürt gehabt, einen prächtigen Sechzehnender, der hat vom Wald herunter gewechselt, und auf den hab’ ich mich anpirschen wollen. Ich bin drum am Gewand’, oben an der Schneid’ von der langen Wand herum, weil ich ihm den Wind abgeh’n wollt’ – ich bin ganz sicher gewesen, denn ich hab’ den Forstner mit seinen Leuten schon lang zuvor heimgeh’n seh’n … Auf einmal, wie wenn er aus der Erden herausgewachsen wär’, ist der Jäger vor mir gestanden … ich begreif’s jetzt freilich wohl, was ihn hergeführt hat … „Halt’, Kerl – oder ich schieß …“ hat er mich angeschrieen und ist da gestanden vor mir, mit der Büchs im Anschlag; ich hab’ mich besonnen, einen Augenblick … zum Auffahren mit meinem eigenen Stutzen war’s zu spät … bis ich ihn an die Backen gebracht hätt’, hätt’s schon lang geschnallt bei dem Jäger – wir sind keine zwanzig Gäng’ von einander gewesen … ich resolvir’ mich also kurz, duck’ mich nieder, mach’ zugleich einen Sprung … unterlauf’ ihm das Gewehr und pack’ ihn um die Mitt’ …“
Sabine machte eine Bewegung, er hielt, selbst ergriffen, inne.
„… Ich hab’ ihm nichts zu leid thun wollen,“ sagte er dann, „ich wollt’ ihn nur verhindern, daß er mich nit niederschießen oder fangen kann … Ich hab’ oft nit an mei’ Mutter gedenkt, in dem Augenblick aber ist sie mir eingefallen, und was sie sagen und aussteh’n thät, wenn sie hören thät’, daß ihr einziger Bub erschossen worden ist oder im Zuchthaus steckt … Ich hab’ nichts gewollt, als den Jäger niederwerfen und dann davonspringen – aber der Jäger ist stärker gewesen, als ich gemeint hab’, er hat sich tüchtig gewehrt, und so haben wir miteinander herum gewürgt, daß es mir schon schwarz und roth geworden ist vor den Augen … Die Knie’ sind mir eingebrochen, in ein paar Augenblicken … ich hab’s gespürt … hätt’ er mich am Boden gehabt … da hab’ ich meinen rechten Arm frei gekriegt und hab’ [67] dem Jäger einen Schlag gegeben … wohin, weiß ich nit … aber er hat meinen Hals losgelassen im Augenblick, hat als wie damisch (betäubt) ein paar Torkeler gemacht und ist rücklings hinuntergetaumelt über’s Gewänd …“
Erzähler und Hörerin schwiegen … „Du sieh’st,“ begann er nach einer Weile wieder, „mein Willen ist es nit gewesen … und wenn ich auch nit auf rechten Wegen gegangen bin … ich hab’s in der Verzweiflung gethan … ich hab’ mich nur wehren wollen …“
Sabine weinte und winkte ihm mit der Hand, zu schweigen; er aber fuhr fort. „Du meinst, es wär’ schon genug?“ sagte er, „aber nein – Du mußt jetzt Alles hören … Du weißt wohl, wie’s geschehen ist, aber nit, was ich ausgestanden hab’ dafür! – Am andern Morgen hab’ ich mein’ Dienst aufgesagt und bin zurück nach Tirol … ich hab’ keinen Stutzen mehr angerührt, sondern Tag und Nacht als Bauernknecht gearbeit’ … bei meiner alten Mutter und für sie … ich hab’ es mir selber aufgethan als Buß … Aber es hat nit geholfen! Ich hab’ keine Ruh’ mehr gehabt – und keine rechte Freud’ … jede Nacht hab’ ich den Jäger im Schlaf geseh’n – ich hab’s geseh’n, wie er stürzt, und hab’ ihn aufhalten wollen und hab’s nit gekonnt – und wie ich hab’ müssen flüchtig geh’n, bin ich diesen Weg herauf … ich hab’ beten wollen an dem Ort … es ist mir gewesen, als wenn mich was bei den Haaren hätt’ und hätt’ mich hergezogen … ich hab’ gehofft, ich könnt’ meine Ruh wieder finden – und ich hab’ mich ja auch nit geirrt: ich hab’ ja Alles gefunden, was ich gewollt hab’ … und noch mehr dazu …“
Sabine weinte still … „Mir ist das Herz zum Zerspringen schwer und voll,“ seufzte sie, „und doch ist es mir ein Trost, daß Du nit so schuldig bist, wie’s den Anschein gehabt hat!“
„Der Schein betrügt,“ erwiderte Hans, „ich hab’s ja auch an Dir erfahren, Madel – Du bist auch nit so hart vom Gemüth, wie Du Dich angestellt hast, und wenn Du mich auch verrathen und ausgeliefert hast … jetzt, wo Du so neben mir sitzest in meinem Gefängniß und bist so gut und herzig mit mir, jetzt weiß ich doch, daß Du nit die Unwahrheit geredt hast, wie ich Dich gefragt hab’, ob Du mir gut wärst – und ob es Dir leid that, wenn sie mich fangen und fortführen zum Erschießen …“
Das Mädchen erwiderte nichts; aber sie duldete, daß er näher rückte, und als er ihre Hand ergriff, entzog sie ihm dieselbe nicht, nachdem ein schwacher Versuch dazu an seinem Widerstande gescheitert war.
„Laß mir Deine Hand …“ sagte er innig . .. „Der arme Bursch, der durch mich hat zu Grund gehen müssen, wird Dir nit bös sein, wenn er vom Himmel herunter schaut und sieht Deine Hand in der meinigen liegen – er wird nit bös sein, wenn Du mir verzeihst, und wiederholst, was Du mir doch schon einmal gesagt hast … Der Todte wird nit eifern mit dem Lebendigen, der ihm bald nachfolgen wird … Thu’s, Madel, Du machst mir den letzten Gang noch einmal so leicht …“
Wie sich plötzlich besinnend sprang Sabine auf. „Nein,“ rief sie, „nein – Du sollst nit sterben – ich will Deinen Tod nicht auf meinem Gewissen haben, unser Herrgott allein soll richten unter uns … Du mußt fort …“
„Fort? Wie wär’ das möglich? Bin ich nicht gefangen und von allen Seiten bewacht?“
Geräusch von Fußtritten und Stimmen tönte herein und unterbrach das Gespräch.
„Du mußt fort,“ flüsterte Sabine, „ich mach’ daß es möglich wird … Sei still … ich komm’ wieder … in einer Viertelstund …“
Sie schlüpfte aus der Hütte und war eilig daran, die Stricke an der Thüre zum Scheine wieder zu verknüpfen. Eben war sie damit zu Ende, als Lipp um die Ecke trat und vor ihr stand, sie mit finstern Blicken musternd und messend. „Du bist da?“ sagte er, „hat’s Dich gar nimmer gelitten droben auf Deiner Alm?
Schaust nach, ob Dein Arrestant wohl verwahrt ist? Sorg’ Dich nit, Binl – der kommt nimmer aus, dafür laß mich sorgen – Du weißt ja, ich hab’s versprochen, daß ich Dir helfen will! … Aber was ist denn das?“ fuhr er auf, als er näher tretend einen Blick auf den Verband an der Thüre geworfen hatte. „Der Strick ist ja wie aufgezogen! … Hoho Madel, steht’s so? Jetzt weiß ich, wie viel’s bei Dir geschlagen hat … Du hast hinein gewollt zu dem Mörder? Es reut Dich wohl gar, was Du gethan hast, und Du willst ihm durchhelfen?“
„Und wenn ich’s wollt’?“ erwiderte sie, sich zusammenraffend und fest. „Ich leugne nichts … ja, ich war bei ihm in der Hütten – ich hab’s hören müssen, wie’s genau zugegangen ist, selbiges Mal am Margarethentag …“
„So? Und jetzt weißt Du’s?“ fragte Lipp lauernd. „Und bist wohl noch wüthiger wie zuvor?“
„Nein,“ sagte sie mit einigem Zögern, „mein Sinn ist mir umgewendt … ich will nit mehr haben, daß er zu Grund geh’n soll …“
Lipp lachte auf; der Zug von Rohheit in seinem Gesichte trat immer unverhohlener hervor. „Was man nit Alles erlebt!“ rief er. „Und warum denn, wenn man fragen darf? Wie ist denn das so schnell ’kommen?“
„… Es ist unchristlich … ich will Alles unserm Herrgott anheim geben – ich will sein Leben nit auf meinem Gewissen haben!“
„Bah … ich nehm’s auf das meinige!“
„Ich will nit, sag’ ich, es ist mein Gefangener – ich hab’ ihn Dir übergeben!“
„Nu ja – eben weil Du ihn mir übergeben hast, ist er mein und soll’s bleiben! Frag’ die Bauern, ob sie den Spion, den Rebellen, den Mörder laufen lassen wollen. Und wenn sie wollten … er soll nit fort, er soll keinen Fuß aus der Hütten, setzen, bis die Franzosen da sind und ihn abholen! So will ich’s haben, und ich weiß warum!“
„Und warum? Rede!“
Lipp sah die Entrüstete höhnisch an. „Warum?“ entgegnete er. „Weil ich besser als Du selber weiß, was in Dir vorgeht … weil ich Deine Gedanken errath’, als wenn Du ein gläsernes Fensterl auf der Brust hätt’st! Weil Du Deinem Verlöbniß untreu geworden bist – weil der fremde Landfahrer Dir gefallen hat, wenn Du auch gesagt hast, Du kannst kein Mannsbild mehr gern haben, das wär’ gar nimmer in Dir! … Du hast gesagt, Du willst mich nit und auch keinen Andern nit … Du hast Dein Wort nit gehalten, desto besser will ich das meinige halten und sorgen, daß kein Anderer Dich kriegt!“
Sabine hatte die Hände vor das erröthende Antlitz geschlagen „Gern haben?“ murmelte sie. „Ich? Den Mörder von meinem …“
„Von Deinem Schatz!“ ergänzte Lipp. „Es ist freilich sonderbar, aber Du hast in Allem eine besondere Weis’ … bei Dir schlagt die Hitz leicht um wie die Kält’ …“
„… So ist es nit …“ stammelte sie, „ich hab’ nur Erbarmniß mit ihm …“
„Erbarmniß?“ rief Lipp noch höhnischer und schwieg, die Blicke fest auf das Mädchen geheftet und unverkennbar über einem Gedanken brütend. „Zeig’ mir, daß es nur das ist,“ sagte er dann rasch – „beweis mir’s, und ich will Dir beisteh’n und will ihm mit Dir forthelfen …“
„Aber wie? wie?“ fragte sie hastig.
„Wie? – Wenn’s wirklich nur das Erbarmen ist, was Dich treibt … wenn Du sonst keine Absicht hast, als den da drinnen vom Tod zu erretten … so mach’ der ganzen Geschicht’ ein End’, gieb Dein Jawort und nimm einen Andern.
Sie machte eine stumme Gebehrde des Abscheus und des Schreckens.
„Thu’s!“ fuhr er näher und dringender fort. „Gieb Dein Gelöbniß auf – ein Loch ist doch schon hineingerissen … nimm einen Andern, Binl … nimm mich …“
Sabine schauderte. „Es wär’ Dein Unglück wie mein’s … flüsterte sie tonlos; „… Du solltest so was nit sagen …“
„Ich wag’s auf das Unglück hin! Geschwind – entschließ’ Dich, Binl! Du hörst, die Bauern kommen näher – Du hast die Wahl, entweder Du sagst Ja … oder ich verrath’s ihnen, daß Du den Rebeller und Mörder willst entwischen lassen, dann ist es gewiß, daß er ihnen nimmer auskommt …“
„Heilige Mutter …“ stammelte Sabine schwankend … „Ist es denn möglich … so weit soll’s kommen mit mir! … Und wenn ich Ja sagen that …“ setzte sie stockend hinzu.
„Dann will ich schweigen und Dir helfen – ich geb’ Dir mein heiliges Ehrenwort darauf! In einer halben Stunde soll er über alle Berge sein … Besinn’ Dich nit lange mehr – da sind die Bauern schon … Sag’ Ja, – sie müssen’s Alle hören, damit Du nicht mehr zurück kannst …“
Die Bauern kamen näher. Es galt eine neue Berathung, ob es nicht geeignet sei, eine Streife gegen den Feind vorzuschicken, [68] um zu erfahren, ob er wirklich im Anzuge sei; das zwecklose Wachestehen am Verhau und die Versäumniß dringender Arbeit war den Leuten verleidet. Der alte Vetter kam vom Dorfe her mit der Nachricht, das französische Piket sei schon im Anmarsch, den Walchensee entlang – das entschied, denn die Verstärkung und Ablösung war damit nahe.
„Ich hab’ auch eine Neuigkeit, Ihr Leut’,“ rief jetzt Lipp, indem er das schweigende, nicht widerstrebende Mädchen an sich zog, „… ich lad’ Euch zum Stuhlfest ein – da steht meine Hochzeiterin!“
„Ist’s wahr?“ rief der alte Vetter freudig und trat zu Sabine, indeß auch unter den Bauern sich eine allgemeine Bewegung der Theilnahme kund gab. „Ist’s wirklich wahr? Nun schau, das ist ein gescheidter Gedanke, daß Du die Flausen und die Faxen aufgegeben hast vom Ledigbleiben! Aber wie ist denn das nur so ’kommen in der Geschwindigkeit?“
„Wie wird’s gegangen sein!“ rief Lipp, dem daran lag, das todesbleich in seinen Armen bebende Mädchen nicht zum Worte kommen zu lassen. „Wie so was halt allemal geht! Die Madel zieren sich Alle am Anfang – jetzt ist sie doch eigens herunter von der Alm, um mir zu sagen, daß sie nit leben kann ohne mich …“
Ein Schuß krachte vom Verhau herüber, und wildes Geschrei begleitete ihn. „Sie kommen!“ hieß es. „Sie sind da! Die Tiroler kommen!“ Auch von der Straße hörte man Büchsenknall und das wirre Geschrei einer anrückenden Menge. Mit wildem Sausen stürmten die Bauern auf den Verhau, nur Lipp sah ihnen, ruhig stehen bleibend, nach.
„Was wartest Du?“ rief ihm Sabine zu. „Gehst Du nit mit den Andern in’s Gefecht?“
„Eilt mir nit,“ antwortete er. „Die Andern werden mit den Tirolern wohl auch ohne mich fertig … ich geh’ mit Dir zurück in’s Dorf …“
„Mit mir? Ich will nit in’s Dorf – hier ist mein Geschäft!“
„Nichts da!“ rief Lipp und faßte sie am Arm. „Nichts hast Du hier zu schaffen – Du gehst mit mir – und das auf der Stelle!“
„Ich geh’ nit,“ rief Sabine, indem sie sich loszumachen suchte … „nit eher, bis ich ihn befreit habe! Jetzt, in dem Getümmel, ist der beste Augenblick dazu! … Lipp, laß mich los!“ schrie sie auf, als er nicht abließ, sie fortzuziehn und sie sogar um die Mitte faßte. „… Bedenk’, was Du mir versprochen hast!“
„Wer weiß was davon?“ rief er mit höhnischem Lachen. „Wer will mich zwingen, daß ich’s halt’? Du bist jetzt doch mein vor allen Leuten, Du kannst nit mehr zurück ohne Schand’ und Spott …“
„Ich kann’s und ich will’s …“ rief die verzweifelt, doch umsonst Widerstrebende. Er aber zerrte sie fort. „Das wollen wir doch sehn, Du Wildfang, Du unbändiger …“ schrie er, „ich will Dich schon zahm machen …!“
Da krachten die Breter der Kohlhüttenthüre zertrümmert zu Boden, und auf der Schwelle stand der Vomper-Hans, – einen Prügel in dem hochgehobenen Arm, sprang er den Beiden mit einem Satze nach und ließ ihn auf den Kopf des Burschen niedersausen, daß dieser lautlos und plump zusammenstürzte.
Sabine stand verwirrt, als faßte sie nicht, was geschehen.
„Ich bin frei,“ rief ihr Hans zu, „frei, Madel – und ich bin’s durch Dich! Ich sag’ Dir Vergelt’s-Gott und Behüt’-Gott zu gleicher Zeit! … O, Madel,“ fuhr er nähertretend mit herzlichem Tone fort … „vielleicht wär’s besser gewesen, wenn ich Dich niemals gesehn hätt’ – aber ich kann’s nit wünschen, ich hab’ Dich ja so gern – so gern wie ich noch Niemand gehabt hab’, so lang’ ich leb’ … und ich muß Dir’s sagen, gerad’ jetzt, in dem Augenblick, wo wir auseinandergehn auf Nimmerwiedersehn …“
Das Mädchen fand hochaufathmend noch immer kein Wort der Erwiderung, aber sie widerstrebte nicht, als er sie in seine Arme zog und fest an sich preßte.
Ihre Lippen vereinigten sich wie willenlos zum langen, innigen Kusse.
Jetzt ließ er sie los, raffte Lipp’s Gewehr vom Boden auf und entsprang gegen den Wald.
„Nit dort hinaus!“ rief Sabine ihm angstvoll nach. „Dort ist die Straße … rechts in das Dickicht …“
„B’hüt’ Dich Gott tausendmal!“ rief er zurück. „Dort sind meine Landsleut’ … dort ist mein Platz!“
Er verschwand. Sabine sank an einem Baumstamme nieder, hinter dem Lipp, noch immer ohne Lebenszeichen, lag. Wie aus weiter Entfernung, mit einer Ohnmacht ringend, vernahm sie das Geschrei der Streitenden und das Krachen der Gewehre, denn drüben am Verhau war ein wüthender Kampf entbrannt. Ein Gebet auf den Lippen, knickte sie zusammen – ein Gebet, das mehr dem Feinde galt, als den Landsleuten und dem einst so geliebten Todten.
Als sie zu sich kam, war das Kampfgetümmel verstummt: als ob, wie sonst, nur die heimischen Bewohner des Waldes in sorgloser Lust unter ihnen gespielt hätten, so friedlich und grün hoben die Tannen über ihr die Wipfel in das Himmelsblau – um sie herum blühten Blumen und duftete das Moos, als habe es frischen Thau und nicht eben Blut getrunken.
Das Gefecht hatte sich rasch entschieden: die zuerst wüthend anstürmenden Tiroler mußten sich zurückziehen, als die erwartete Abtheilung französischer Soldaten eintraf, welche zu beiden Seiten des Verhaus mit gefälltem Bajonnet vordrangen und sie im Rücken zu fassen suchten. Die Bauern waren mit einigen Verwundungen davongekommen – die Tiroler hatten nur einen Todten zurückgelassen. Es war der Vomper-Hans.
Muthig hatte er sich zwischen die Streitenden geworfen, und in dem Bestreben, Frieden zu stiften, war ihm eine Kugel mitten durch’s Herz gegangen.
Der Körper blieb unbeachtet im Grase des Waldrandes liegen, bis Abends Leute kamen und ihn nach Walchensee hinuntertrugen, um ihn neben dem kleinen Kirchlein hart an der Kirchhofwand zu verscharren.
Lange kniete Sabine stumm und thränenlos neben dem Todten. Seitwärts am Walde saß der alte Vetter, ohne sie zu stören, zu fragen oder anzureden: in dem warmen Herzen des Greises dämmerte die Ahnung dessen, was in ihr vorging. Abends trat er hinzu und forderte sie mit liebevollen Worten auf, ihm in das Dorf zu folgen. Sie folgte schweigend.
Am Eingange der Schlucht hielt sie an. „Ich hab’ noch ein kleines Geschäft, Vetter,“ sagte sie, „wart’t auf mich, nur einen Augenblick …“ Sie ging tief in das Gestein, suchte den verschleuderten Tannenkranz und hängte ihn über das Gemälde. –
Lipp kam wieder auf, aber er mied die Gegend am Walchensee und ist im fernen Ungarn verschollen.
Dreiundfünfzig Jahre haben dort die Erinnerung an diese Ereignisse vollständig ausgelöscht. – Sabine blieb bei dem Alten, bis er starb, dann bei seinem Sohne und dessen Kindern, ein stiller, nützlicher, von Allen geliebter Hausgenosse; kaum den Lebenden angehörig, mit Gedanken und Wunsch den Todten zugeneigt, für deren Heil sie betete ohne Unterlaß.
Als die Greisin zu ihnen versammelt wurde, prangte auf ihrem Sarge das Ehrenkränzlein der Jungfräulichkeit. – Auf ihre Bitte ward er ihr nicht mit in die Grube gegeben, sondern von freundlicher Hand über dem Täfelchen aufgehangen.
Er ist lange verdorrt und zerstäubt – auch das Marterl ist verwittert und unkenntlich geworden – nur unter den Betkorallen hat sich der fromme Spruch erhalten und mahnt den Vorübergehenden, wie flüchtig die Stunde ist.
Wer zu Gast nach Leipzig kommt und im „Leipziger Tageblatt“ oder in der „Mitteldeutschen Volkszeitung“ unter den Vergnügungs-Ankündigungen auch eine liest, vielleicht des Inhalts:
„Hôtel de Saxe. Vortrag: 1) Heer- und Wehrpredigt. 2) Gesänge mit Waldhorn-Quartett-Begleitung. 3) Neueste Nachrichten. – Anfang ½8 Uhr. Entrée 2½ Ngr. Ludwig Würkert.“
[69]der gehe nicht gleichgültig über diese bescheidene Einladung hinweg, schließe nicht von den 2½ Ngr. auf einen so geringen Anforderungen entsprechenden Genuß, sondern folge dem Wink. Ich will ihm Führer sein.
Wir kommen durch den Garten an den Eingang in eine Veranda, erhalten hier für unsere 2½ Ngr. statt Einlaßkarte ein auf ein Octavblättchen gedrucktes Gedicht, oder mehrere Gedichtchen, die zugleich die Texte der angekündigten „Gesänge“ sind. Die Veranda bildet eine Vorhalle des Saales, den wir nun betreten.
Es ist ein langer, aber offenbar zu schmaler Raum, um zu Tanzfesten zu dienen; seine Ornamentik, für Beleuchtung berechnet, [70] ist bei den abendlichen Gasflammen von Wirkung; es überkommt Einen leicht eine feierliche Stimmung zwischen den Säulenpaaren an beiden Längsseiten, und die beiden Schmalseiten mit ihren hohen, säulenfreien Spiegelwänden täuschen durch ihre gegenseitige Vervielfältigung des Saalbildes in’s Unendliche den Neuling für Augenblicke über die eigentliche Größe des Raumes. Das fühlt Jeder, daß für ein gewöhnliches Restaurationsleben mit Kartetischen und Alltagsgeschwätz diese ernste Halle zu gut ist, auch wenn die Büsten der großen deutschen Männer, Luther’s und Gellert’s, Guttenberg’s und A. Humboldt’s, Moses Mendelssohn’s und Lessing’s, Schiller’s und Goethe’s, welche zwischen je einem Säulenpaar aufgestellt sind, für Manchen immer noch nicht deutlich genug von der bessern Bestimmung derselben zeugen sollten. Dem Veranda-Eingang gegenüber steigt im Saal ein Treppenpaar zu einer dritten Abtheilung der Wirthschaftsräume, dem sog Tunnel, empor. Den Aufgang rechts zu diesem „Tunnel“ versperrt ein Podium, auf welchem nichts als ein einfaches Tischchen zu sehen ist.
Das ist der Raum, und nun zu seinem Inhalt. Wenn nicht die Meßzeit dem Publicum, welches der obigen Einladung zu diesen Vortrags-Abenden im Hotel de Saxe mit fast stammgastlicher Regelmäßigkeit folgt, durch den Fremdenstrom eine unbestimmte Färbung giebt, stellt sie sich in einer sehr bestimmten dar: es ist der in seinen Ansprüchen bescheidene, aber geistig gern und freudig empfangende und strebende Mittelstand, der hier eine treue und dankbare Zuhörerschaft bildet. Da ist der fleißige Handwerker und der niedere Beamte. Sie haben den Tag an der Arbeit zugebracht, zum Zeitungslesen bleibt ihnen keine Zeit, aber wissen wollen sie, wie es in der Welt und insbesondre im Vaterlande steht. Da nehmen sie am Abend die Gattin am Arm, vielleicht auch die großen Kinder dazu, und gehen „zu Würkert“. Der junge, strebsame Geschäftsmann, der Commis aus den verschiedensten Geschäften stellt sich ein, wenn ihn nach besserer Unterhaltung verlangt, als „die Restauration“ im gewöhnlichen Styl sie bietet. Es sind auch bescheidene junge Arbeiter aus Fabriken und sonstigen großen Geschäften, die, vielleicht mit der Zukünftigen zur Seite, ebenfalls da Platz nehmen, aber das Herz haben sie gewiß auf dem rechten Fleck, sonst würden sie zu irgend einem der vielen Tanzvergnügen und nicht „zu Würkert“ gehen. Man sieht, für die Kreise der vornehmen, kalten Kritik ist die Gesellschaft, Gott Lob, zu bürgerlich!
Was giebt es denn nun so gar Absonderliches bei diesem „Würkert“? Zunächst, lieber Freund, Speise und Trank wie in jedem Wirthshaus, und Du siehst, daß all die Gäste nach ihren Mitteln und Bedürfnissen tapfer zugreifen. Ist aber das Leibliche befriedigt und steht das Töpfchen „Coburger“ oder „Lager“ gemüthlich vor den Leutchen, dann kommt der Augenblick, wo trotz der nun erst recht gelösten Zungen plötzlich tiefe Stille in Saal und Veranda eintritt. Auf dem Podium ist der Wirth, der Besitzer dieser stattlichen Kneipe, erschienen, und er ist’s, der mit mächtig durchdringender Stimme durch seinen Anruf: „Geehrte Anwesende!“ die bunteste Unterhaltung in lauschendes Schweigen verwandelt.
Ludwig Würkert legt seinen Vorträgen meist einen dichterischen Ausspruch zu Grunde, oder er giebt den Grundgedanken selbst in dem gedruckten Gedichte, welches wir am Eingang erhalten. Heute beginnt er mit dem Körner’schen Verse:
„Was zieht ihr die Stirne finster und kraus?
Was starrt ihr wild in die Nacht hinaus,
Ihr freien, männlichen Seelen?
Jetzt heult der Sturm, jetzt braust das Meer,
Jetzt zittert das Erdreich um uns her, –
Wir woll’n uns die Noth nicht verhehlen!“
und nennt sofort als den Gegenstand der neuen deutschen Sorge und als die Ursache der drohenden Noth: Schleswig-Holstein und den deutschen Zwiespalt.
Er stellt seinen Zuhörern vor Allem ein klares Bild über den gegenwärtigen Stand dieser deutschen Herzens- und Schmerzenssache vor Augen; er erzählt von dem Befreiungsjubel in Holstein und wie niederbeugend, wie drückend derselbe auf uns in Deutschland wirken müsse, die wir die Lahmheit im Handeln gerade von Seiten des Volks täglich vor Augen sähen. Trotzdem erblicke er die uns drohende Gefahr nicht in einem Kriege mit dem Auslande, und wäre es halb Europa, sondern in dem Frieden, der abermals mit Deutschlands Schmach bezahlt werde, und zwar mit Beihülfe der sogen. „deutschen“ Großmächte, die angeblich aus „europäischen“ Rücksichten zu solch „höherer“ Politik gezwungen seien.
Die Noth könne Menschen und Staaten auf zweierlei Wege führen, auf den der Schande oder auf den der Ehre.
Mit ebensoviel Menschen- als Geschichtskenntniß und politischem Blick greift unser docirender Wirth in die schicksalreichen Nachtseiten des Lebens, um in warnenden Beispielen den Weg der Noth zur Schande Einzelner zu zeigen; dann führt er uns durch die deutsche Fürsten- und Volksgeschichte zu Anfang dieses Jahrhunderts, um den Schandweg zum Rheinbund allen seinen Zuhörern recht deutlich sichtbar zu machen. „Und ist,“ fährt er fort, „wenn Oesterreich und Preußen ihre dermalige Einmüthigkeit noch weiter pflegen, um sich vor allem sogen. „nationalen“ Treiben für immer Ruhe zu verschaffen, – ist dann etwa der Weg zu einem neuen Rheinbund so weit?“ – Darum müsse, selbst einem drohenden Bürgerkrieg zum Trotz, das Volk den Weg der Ehre festhalten, weil er der Weg des Rechtes sei. Wiederum gelte und geschehe hier Einzelnen wie Nationen. „Für die Völker aber sei das segensreichste Wirken der Noth, daß sie zum Zusammenfassen der vorher oft so zersplitterten Kräfte antreibe, und so möchten denn die Mittel- und Kleinstaaten Deutschlands nur fest und treu zusammenstehen und die Fürsten es zum ersten Male seit fünfzig Jahren wieder fühlen, wie mit dem Vertrauen die Macht wachse, wenn man sein treues Volk zu gemeinsamer That bereit hinter sich wisse. Sie sollten fest zusammenstehen, und die Bismarcke und Rechberge der ganzen Welt würden den Deutschen ihr Schleswig-Holstein nicht entreißen und die Nation werde siegen und sollten Millionen Teufel ihr entgegentreten!
Die Versammlung war längst im ganzen Herzen warm geworden und brach hier in lauten Beifallsjubel aus. Der in wahrer Begeisterung für seinen Gegenstand längst zum Predigerton der Rede emporgehobene patriotische Wirth (– mit dem Pathos dieses Predigertons, unseren Lesern später ganz erklärlich, sind, nebenbei gesagt, viele sonst ganz treue Verehrer des Redners nicht immer einverstanden –) beachtet dies jedoch nicht, sondern fährt mit gesteigertem Eifer fort, die Leiden der armen Schleswiger zu schildern. Jeder Schrei des Schmerzes, der Verzweiflung, jeder Fluch über die Nichtswürdigkeit, welche aus kalter Berechnung des Eigennutzes und der Bosheit eines Volkes Herz mit Füßen trete, das Alles werde mit der Kraft des Gebets im Volke wirken und müsse so wirken, wenn Deutschland nicht schmachvoll zu Grunde gehen solle.
„Wir wollen uns die Noth nicht verhehlen!“ ruft er zum Schluß des Vortrags den Gästen zu. „Gerade deshalb muß gegen die Folgen solcher Noth jeder Verständige und Brave sich schon jetzt rüsten, im Haus, in der Gemeinde, im Staat! So thuen auch Sie das Ihre! Aber nicht dadurch, daß Sie für sich allein vorsorgen, Sie, die Sie heute hier anwesend waren! Leider sind Einsicht und Erkenntniß der Zeit und der Pflichten, die sie uns auferlegt, noch so wenig verbreitet, daß wir mit Trauer behaupten können, es gehen in Deutschland noch Millionen nur ihrem Erwerbszweig nach und ahnen nicht, daß der ganze Baum ihrer Existenz in Gefahr steht! Verbreiten Sie Einsicht und Erkenntniß, gehen Sie zum Nachbar links und rechts und theilen ihm mit, wovon Sie heute sich überzeugt haben. Und dann öffnen Sie, wie das Herz, auch die Truhe, den Geldbeutel für den Gotteskasten des Vaterlandes! Sein Triumph wird auch der Ihre, seine Ehre die Ihre sein, und Ihre Kinder werden’s Ihnen einst segnen!“
Damit schloß der Redner, und lauter, dankbarer Beifall von allen Anwesenden belohnte ihn.
Erregt ist sichtlich die ganze Zuhörerschaft. Es sind zündende Gedanken unter sie geworfen, und je nach Begabung und Mundwerk beginnt die Discussion darüber an den einzelnen Tischen. Inzwischen versäumt ein patriotischer Colporteur nicht, die günstige Stimmung für sich zu benutzen: er bietet Karten von Dänemark und den Herzogthümern, Flugblätter, Zeitungen etc. feil, und die Bürgersfrau, die sonst den Groschen zehn Mal umwendet, der für etwas Gedrucktes ausgegeben werden soll, redet jetzt selbst dem Ehegatten zum Ankauf von diesem und jenem, das durch die eben gehörte Rede besonderes Interesse gewonnen hat, zu. Man schlage gerade einen solchen Erfolg dieser Vorträge nicht zu gering an.
Die hohe Gestalt des Wirthes erscheint wieder auf dem Podium. Er schlägt vor, eines der Lieder zu singen, welche wir gedruckt in Händen haben. Ein Waldhornquartett bläst die Melodie erst vor und begleitet dann den Gesang. Aber wer singt denn? Ein Sängerverein? Nein, die ganze Gesellschaft [71] singt, und auch das erfreut des Menschen Herz. Frauen und Männer, Alles singt mit. Dann declamirt wohl Herr Würkert auch ein Gedicht mit Musikbegleitung, und was er für seine Gäste wählt, ist gut, muß veredelnd wirken; zur bloßen Unterhaltung bietet er nichts.
Abermals betritt Ludwig Würkert seinen einfachen Rednerplatz, diesmal mit verschiedenen Zeitungen in der Hand. Aus diesen liest er theils vor, theils erzählt er das Wichtigste aus der Tagesgeschichte. Auch dies geschieht wieder mit der aufmerksamsten Rücksicht für das Fassungsvermögen von Gästen von so außerordentlich verschiedenem Bildungsgrade. Wir bewundern sein Geschick in der Bewältigung solcher Schwierigkeiten, die um so größer sind, als er auch jetzt nicht die Aufgabe eines ruhigen Erzählers löst, sondern auch jetzt ist es ihm Herzensbedürfniß und Mannespflicht, seine Gäste zu erwärmen, zu ermahnen, zur That zu stärken. Mit einem Kraftwort, an welchem Jedes noch Etwas mit nach Hause zu nehmen hat, schließt er gewöhnlich gegen 10 Uhr, der Zeit, wo der Bürger und Arbeiter selbst den Abend zu schließen gewohnt ist.
Das war einer der Vortragabende im Hotel de Taxe, und so haben sie seit 1861 mit immer steigender Theilnahme der Einheimischen und Auswärtigen stattgefunden. Unsere Leser dürfen sich jedoch durch den heutigen Abend nicht zu der Ansicht verführen lassen, als ob hier blos Politik getrieben würde. Das bringt jetzt nur die Zeit so mit sich. Würkert sucht in weniger erregter Zeit seine Stoffe auf den reichen Feldern der Geschichte, der Literatur, der Arbeit und des Verkehrs, des Familienlebens und besonders der rein menschlichen Bestrebungen. Die Abende „bei Würkert“, welche er z. B. dem ehrenden Gedächtniß unserer großen deutschen Männer widmete, gehören offenbar zu den lohnendsten. Er beging keinen Geburts- oder Todestag eines wirklichen Großen, ohne seinen Gästen ein klares Bild von dem Leben und Wirken desselben zu geben. Und wie sehr seine Gäste gerade dafür ihm Dank wußten, das bethätigten sie, indem sie den Saal mit jenen acht Büsten schmückten, die oben genannt sind.
Wer ist nun dieser Ludwig Würkert, der als Bierwirth vor uns steht und wie ein Gelehrter und Redner von Fach zu uns spricht?
Ludwig Würkert mit seiner Kneipe und ihrer doppelten Bestimmung ist eine so seltsame, so außerordentliche Erscheinung, wie sie wohl nur einmal in Deutschland, ja vielleicht in Europa dasteht. Denn dieser Bierwirth ist wirklich nicht blos Wirth, er ist zugleich ein ebenso fleißiger, als tüchtiger Schriftsteller, er ist ausgezeichnet als lyrischer Dichter und im Fache der Novelle, in welchem er sogar einen ersten Preis errang; noch mehr, Ludwig Würkert war einer der gefeiertsten Kanzelredner Sachsens, er gehörte zur höheren Geistlichkeit des Königreichs; und noch mehr, er ist auch Züchtling gewesen, und zwar erster Classe, und hat am Spinnrad gesessen. Und jetzt ist er Wirth und dazu, nicht blos im Kreise der Schriftsteller und des Geschäfts, sondern als Mensch und Mann von Jedem hochgehalten, der ihn kennt.
Diese Andeutungen müssen den Wunsch rege machen, daß L. Würkert seine Erlebnisse in einer ausführlichen Selbstbiographie niederlege; bis dies geschehen, mögen den Leser die folgenden Mittheilungen an jenem Wunsche um so fester halten lassen.
Ludwig Würkert ist ein Krempelfabrikantensohn aus Leisnig in Sachsen, wo er am 16. Decbr. 1800 zur Welt kam. Nachdem er, der als Student zu Leipzig schon als Sprecher der Burschenschaft geglänzt hatte, 19 Jahre lang Diaconus in Mittweida gewesen war, kam er im Jahre 1843 als Oberpfarrer nach Zschopau. Während dieser langen Zeit bis zum Sturmjahr 1848 erfüllte sein Leben sein geistlicher Beruf, eine außerordentliche Schriftstellerthätigkeit (neben wohl 30 Bänden wissenschaftlicher und geistlicher Bücher füllen seine Novellen, unter dem Autornamen Ludwig Rein veröffentlicht, allein 8 Bände) und ein durch die Pflege der Kunst verschöntes, reizendes Familienleben. Auch den Mann verließ der frohe, freie Sinn des Studenten nie ganz, Burschenschafter im Geist blieb er immer. Beides trennte er auch von seiner geistlichen Amtsauffassung nicht; und dies sowohl, wie seine glänzende, von dichterischer Kraft gehobene Beredsamkeit, sowie die vielen Beweise seiner Herzensgüte, seiner redlichen Theilnahme an dem Geschick seiner Mitmenschen, erwarben ihm die Anhänglichkeit seiner großen Gemeinde in einem seltenen Grade.
Daß auf einen solchen Mann, als die Bewegung von 1848 über Sachsen kam, das Auge nicht blos seiner Gemeinde, sondern des ganzen Gebirgs gerichtet war, ist eben so natürlich, als daß in Würkert der alte Burschenschafter über den Priester Herr wurde. Er war der Hauptredner auf allen Volksversammlungen. Sein Name galt Tausenden als ein Zeugniß für die Sache, die man damals verfocht. Und wie Würkert die kirchliche Feierlichkeit der öffentlichen Huldigung für den Reichsverweser geleitet, so hielt er sich auch später für verpflichtet, dem Kampfe für die Reichsverfassung dieselbe geistliche Thätigkeit zu weihen. Dadurch gerieth er in schweren Conflict mit der eigenen Regierung. Denn als es im Mai 1849 zu den blutigen Tagen in Dresden kam, entwickelte er eine verhängnißvolle Thätigkeit für bewaffneten Zuzug zum Kampfplatz, die Sturmglocken dröhnten weit und breit, und auch jetzt den Geistlichen vom Bürger nicht trennend, ermuthigte er die Schaaren durch seine begeisternden Reden und segnete sie und ihre Fahnen öffentlich für den Kampf.
Die Regierung siegte, die Aufständischen flohen, Zschopau ward von den Preußen besetzt, Würkert ward gewarnt und zur Flucht gemahnt, glaubte jedoch nicht an die Gefährlichkeit seiner Stellung, und so stand er an einem Sonntag, den 13. Mai 1849, auf der Kanzel, als gegen das Ende seiner Predigt die Blicke aller auf den oberen Emporen Sitzenden sich nach den Fenstern wandten. Reiter- und Infanteriezüge kamen den Berg herunter. Unruhe und Angst ergriff die ganze Gemeinde. Würkert vollendete seine Predigt. Als er aber die Kanzel verließ und in die Sakristei trat, empfing ihn ein königlicher Commissär mit dem Verhaftsbefehl. Die Kirche war von den Truppen umstellt. Der Gefangene bestieg, nachdem er im Pfarrhause das Nöthigste geordnet, den Wagen, und von einer starken Reiterschaar umringt, setzte sich der Zug auf dem Wege nach der hohen Augustusburg in Bewegung – und weinend und wehklagend folgte dem Zug das ganze Volk, viele Hunderte die drei Stunden Wegs, bis das Thor der festen Burg sich hinter dem Gefangenen schloß.
Wir erzählen das Niemandem zu Leide, denn über jene Tage ist längst eine ernste Zeit gegangen, die nach allen Seiten hin versöhnend gewaltet hat; im Gegentheil, wir wissen ja Alle, daß das sächsische Volk in neuerer Zeit in einer hochwichtigen Angelegenheit des Vaterlandes mit Enthusiasmus und treuer Anhänglichkeit hinter seiner Regierung steht; wir führten das Obige nur an als eine Thatsache, die von der Theilnahme zeugt, die der Mann sich in seinem Wirkungskreise erworben hatte und die sich auch während seiner anderthalbjährigen Untersuchungshaft in der rührendsten Weise bethätigte. Ein Bürger von Schellenberg verpfändete sein ganzes Vermögen, seinen Kirchenstuhl nicht ausgenommen, um dem Gefangenen die Erlaubniß zu verschaffen, bisweilen in den Parkanlagen bei der Burg die Wohlthat des Athmens in der freien Natur genießen zu dürfen; seine Familie und seine Gemeinde unterließen keine Gelegenheit, für ihn zu bitten, und als selbst Harleß, der strengkirchliche Dresdner Hofprediger, sich seiner annahm und Alles aufbot, um eine solche Kraft der Kanzel zu erhalten, machten sich die vier ältesten Männer des Kirchspiels auf den Weg, eisgraue, von mehr als achtzig Jahren gebeugte Greise, um „mit dem einen Fuß bereits im Grabe“ für ihren Oberpfarrer zu zeugen, weil es ihr Gewissen ihnen gebiete. Und wirklich war König Friedrich August von so viel Theilnahme für den Mann ergriffen und geneigt, die Untersuchung niederzuschlagen; durch den Umstand jedoch, daß Würkert beim Beginn der Untersuchung eine Erklärung zu den Acten gegeben hatte, welche durch ihre Schroffheit die Justiz ebenso zu aller Strenge der Gesetzeshandhabung herausforderte, wie sie die Fürsprache von der geistlichen Seite abschwächte, sah sich der König genöthigt, obwohl, wie Harleß erzählte, mit Thränen in den Augen, dem Gesetz seinen Lauf zu lassen.
Würkert wurde zu 8 Jahren Zuchthaus ersten Grades verurtheilt, nach Waldheim gebracht und in das Züchtlingsgewand gekleidet. Nach vier Jahren, von denen er fast drei im Krankenzimmer zubrachte, und in welche Zeit auch sein fünfundzwanzigjähriges Amtsjubiläum und sein fünfundzwanzigjähriges Ehejubiläum fiel, erlöste ihn die Begnadigung.
Wer das innere Leben und Leiden eines solchen Züchtlings kennen lernen will, der lese in der Zeitschrift, die L. Würkert im Jahre 1856 herausgab, in der „Feldkirche“, seinen Gedichtcyklus „Der Gefangene und sein Ring“ – d. i. sein Trauring, den man ihm auf sein inständiges Bitten als einziges Kleinod der Erinnerung [72] an sein glückliches Leben zurückgab und im Zuchthaus zu tragen erlaubte. Er wirkt um so erschütternder, wenn man erfährt, daß all die dort so hoch verherrlichte eheliche Liebe und Treue das Glück dieser Ehe ihm nicht wahren konnte. Der Unstern hatte seinen häuslichen Frieden zerstört; die Ehe ward getrennt.
Arm, ohne Amt, ohne Familie, begann der Mann den neuen Kampf mit dem Leben. Rastlose Arbeit, die sich nun ganz auf das schriftstellerische Feld warf, konnte allein ihn sich und der Welt retten. Nachdem er durch bewunderungswürdigen Fleiß sich wieder ein kleines Vermögen erworben, faßte er den kühnen Entschluß, für seine alten Tage durch Uebernahme einer Wirthschaft in Leipzig zu sorgen. Die „Restauration“ des Hotel de Saxe erschien ihm als die geeignetste für ihn, und er ward ihr Besitzer. Auch einen zweiten Ehebund schloß er, und er beglückt ihn.
Daß Ludwig Würkert kein gewöhnlicher Wirth werden konnte, wußte er wohl selbst, und er hatte gewiß längst im Geiste sich in den schönen Saal eine neue Volkskanzel gebaut, ehe er an die Ausführung des gewagten Schrittes ging. Seine Freunde, namentlich E. A. Roßmäßler, Brehm u. A. erleichterten ihm denselben, indem ersterer in einem Aufsatz im Leipziger Tageblatt „Was werden die Leute dazu sagen?“ das kühne Unternehmen einleitete und die ersten Vorträge hielt, bis Würkert selbstständig und allein seinen Volkshörsaal zu dem ausbilden konnte, was er jetzt ist: ein Unicum in Deutschland: eine deutsche Kneipe für Volksbildung, Volksveredelung, Volksermuthigung.
Wenn bei den großen deutschen Nationalfesten des Jahres 1863 in Leipzig von den Tausenden der Gäste und Festgenossen mit anerkennender Bewunderung die Bemerkung laut wurde, daß Leipzig eine der seltenen Städte der Welt sei, die von sich rühmen könne: „Hier giebt es keinen Pöbel!“ –; wenn die Lern- und Strebelust in den Arbeiterschaaren auch in dieser Beziehung die Stadt vor vielen auszeichnet; – und wenn mehr, wie irgendwo, hier ein aus klarem Verständniß der großen Fragen der Zeit und der gerechten Forderungen des Vaterlandes herausgewachsener Patriotismus im Bürger- und Arbeiterstand sich kundgiebt und zu Thaten und Opfern bereit macht: – so darf man ohne Scheu es aussprechen: Würkert’s Vorträge haben zu diesem Vorzug Leipzigs, der auch ein Stolz Deutschlands ist, ein redliches Theil beigetragen.
Es giebt Erscheinungen in der Geschichte, welche uns an das Fatum der Alten erinnern. So die Geschichte des Geschlechts der Hohenstaufen, so die Schicksale, welche die Familie der Stuart’s verfolgten.
Robert III., der zweite König aus dem Stuartischen Geschlechte, starb im Jahre 1406 aus Gram, seinen Sohn in englischer Gefangenschaft zu wissen. Dieser, Jakob I., wurde erst funfzehn Jahre nachher frei. Er mußte, wider Willen, ein englisches Fräulein heirathen, deren Mitgift sein Lösegeld ward. Im Jahre 1437 starb er, in seinem Bette ermordet. Jakob II. wurde 1460 von einer Kanonenkugel getödtet. Jakob III., sein Sohn, fiel in einer Schlacht, die er 1488 verlor; ebenso endete Jakob IV. bei ähnlicher Gelegenheit 1515. Jakob V. starb 1542 vor Kummer, seine Unterthanen der Ketzerei und dem Aufruhr hingegeben zu sehen. Seiner Tochter, der Königin Maria Stuart, Schicksal, ihre lange Gefangenschaft und ihr schmähliches Ende auf dem Blutgerüste, erregt noch jetzt die allgemeinste Theilnahme. Mariens Sohn, Jakob VI. von Schottland, starb zwar im Bette, aber von aller Welt verachtet. Carl I., dessen Sohn, starb in London auf dem Schaffot, vor den Fenstern seines eigenen Palastes, und bestätigte durch seinen Tod den Wahrspruch, daß Tyrannei ihren Besitzer vernichtet. Jakob II. von England starb 1720 seines Königreichs beraubt und aus ihm verjagt. Sein Sohn war sein ganzes Leben hindurch im Auslande, als Prätendent nur den Namen Jakob III. von England und Jakob VIII. von Schottland führend. Endlich der letzte Prinz dieses unglücklichen Hauses, vorzugsweise unter dem Namen des Prätendenten bekannt, nahm den Titel Carl III. an und starb in Rom kinderlos. So verlosch dieses Königsgeschlecht, nachdem dasselbe durch einen Zeitraum von vierhundert Jahren von ununterbrochenem Unglücke verfolgt worden war.
Die Unglücklichste ihres Hauses aber war unstreitig Maria Stuart. Dem religiösen Fanatismus, dem Parteigeiste und der Leidenschaft und Eifersucht der Königin Elisabeth gelang es, sie bei ihrem Leben und fast zwei Jahrhunderte lang nach ihrem Tode als Gattenmörderin, Buhlerin und Aufrührerin darzustellen, während sie nur das Opfer der Herrschsucht und der Gewaltthätigkeiten des hohen Adels war; sie mußte zur Verbrecherin gemacht werden, um das unmenschliche Verfahren der Königin Elisabeth zu beschönigen.
Die neuere Geschichtsforschung gelangte, wenngleich nicht ohne Widerspruch, zu diesem Resultate, indem der gelehrte Goodall bereits im Jahre 1754 nachwies, daß die Briefe, aus welchen Mariens Einverständniß mit Bothwell hervorgehen und sich der Antheil derselben an ihres Gatten Darnley’s Mord ergeben sollte, unmöglich echt sein könnten; gleicher Ansicht sind mehrere der bedeutendsten englischen Historiker des verflossenen und des gegenwärtigen Jahrhunderts.
Der authentische Bericht über die Hinrichtung der Maria Stuart befindet sich in dem Manuscripten-Nachlasse des am 28. Juli 1587 verstorbenen berühmten trierschen Kanzlers Dr. Johann Wimpheling und enthält, abgesehen von seinen falschen Beschuldigungen, höchst interessante Einzelnheiten über dieses beklagenswerthe Ereigniß. Form und Inhalt lassen keinen Zweifel darüber, daß das Actenstück von der englischen Regierung ausgegangen ist. Der kurtriersche Gesandte schickte den Bericht an den Kanzler Wimpheling, welcher ihn seinem Fürsten, dem Kurfürsten Johann von Trier, vorgelegt hat. Der Bericht wurde, wie aus dem Schlusse desselben hervorgeht, zehn Tage nach der Hinrichtung der Königin abgefaßt und lautet, aus dem Lateinischen übersetzt, wörtlich also:
über die Hinrichtung und den Tod der Maria Stuart, Königin von Schottland, Wittwe des Dauphin von Frankreich, enthauptet in England am 18. Februar 1587 neuen Styls, in dem Castell zu
Die Königin von England, Elisabeth, entdeckte mehrere auf Anreizung des Papstes und einiger anderer ihr feindlich gesinnter Fürsten entstandene Verschwörungen, welche den Zweck hatten, Ihre Majestät nicht allein des Reichs und der Krone, sondern auch des Lebens zu berauben, und sodann die Königin Maria Stuart, die Anhängerin des römisch-katholischen Glaubens und nächste Erbin Ihrer Majestät, welche schon viele Jahre in einer milden Gefangenschaft in England gehalten wurde, auf den englischen Thron zu erheben. Das Parlament oder die Reichsstände von Schottland drangen wiederholt auf Bestrafung der Maria Stuart wegen der Ermordung ihres Gatten, welchen sie erdrosseln, seine Wohnung anzünden und in die Luft sprengen ließ, zu welchem Verbrechen sie sich durch eine strafbare Neigung zu dem Grafen Bothwell, welchen sie auch bald darauf heirathete, hatte verleiten lassen. Aus dieser Ursache wurde sie in Schottland verhaftet, worauf sie zu Gunsten ihres Sohnes Jakob, des jetzigen Königs von Schottland, auf die Krone verzichtete, bald darauf aber aus dem Gefängnisse entfloh und zur Wiedererlangung der Herrschaft ein Heer gegen ihren Sohn in’s Feld stellte. Nachdem dieses Unternehmen unglücklich für sie abgelaufen war, flüchtete sie sich nach England, woselbst sie von den Reichsständen Schottlands (wie bereits bemerkt) als Mörderin ihres Gatten bei Ihrer Majestät angeklagt wurde, von derselben aber das Leben geschenkt erhielt, weil dieselbe nicht Richterin [73] ihrer nächsten Blutsverwandten sein wollte, nicht aber ganz frei gelassen werden konnte, weil sie den Titel einer Königin von England sich beilegte, und Ihre Majestät, sowohl zur Vermeidung von Gefahren für ihre eigene Person, wie des Reichs, so wie auch zur Erhaltung des Religionsfriedens und des Friedens mit Schottland, ihre fernere Gefangenschaft für unumgänglich nöthig erachtete.
Obschon ihr in ihrer milden Gefangenschaft eine ihrem Stande entsprechende Dienerschaft gegeben und ihr selbst die Erlaubniß bewilligt wurde, nach ihrem Belieben die Jagd und den Vogelfang auszuüben, so ruhte sie dennoch nicht, sondern versuchte auf alle mögliche Weise und selbst mittelst des Todes Ihrer Majestät zu entkommen, und verführte zur Erreichung ihrer Zwecke mehrere Edelleute, wie den Herzog von Norfolk, und einige andere Grafen und Herren, welche dieserhalb hingerichtet wurden. Endlich versuchte sie im verflossenen Sommer, Ihre Majestät an Ihrem eigenen Hofe tödten, das Reich von den Ausländern angreifen und die katholische Religion überall einführen zu lassen, wobei sie ihre Anhänger zu überreden suchte, daß sie Alle durch die Ausführung dieses Planes das Himmelreich erlangen würden. Nach Entdeckung aller dieser Verbrechen gestattete endlich Ihre Majestät, zur eigenen und des Reichs Sicherheit, eine Untersuchung gegen die Königin Maria einzuleiten, gebot aber zugleich dem Parlamente, auf Mittel zu sinnen, wodurch das Leben Ihrer Majestät und die Sicherheit des Reichs und des Religionsfriedens außer Gefahr gesetzt, das Leben der Königin von Schottland, Ihrer Blutsverwandten, welche als Fürstin keinem Gerichte unterworfen und deren Hinrichtung fast ohne Beispiel sein würde, aber jedenfalls geschont werden könnte. Das Parlament stimmte jedoch für die Hinrichtung der Königin Maria, indem es nur hierdurch das Leben Ihrer Majestät und die Sicherheit des Reichs und des Religionsfriedens außer Gefahr glaubte.
Ihre Majestät zog den Rath auswärtiger Fürsten, namentlich der Könige von Frankreich und Schottland ein, und obschon die Gesandten dieser Fürsten nicht im Stande waren, genügende Mittel anzugeben, wodurch Ihre Majestät von dieser Sorge und diesem Kummer vollständig befreit würden, so nahmen sie dennoch den größten Antheil an der Königin von Schottland, beriefen sich auf das fast unerhörte Beispiel einer solchen Hinrichtung, und zuletzt gelang es ihren Bitten, Ihre Majestät, welche lang in Ihrem Entschlusse schwankte, dahin zu vermögen, daß Sie die Entscheidung des Parlaments nicht genehmigte und das Leben der Königin Maria zu schonen beschloß. —
Da aber bald darauf abermals neue Verschwörungen, wobei viele Personen aus großen Familien betheiligt waren, entdeckt wurden, und die höchst schändliche Verrätherei Stanley’s vorfiel, wodurch große Unruhen veranlaßt, die Befreiung und Erhebung der Königin von Schottland und die Absetzung Ihrer Majestät bezweckt werden sollten, so beschloß endlich Ihre Majestät, die Quelle und die Ursache aller dieser Uebel zu beseitigen und die Königin von Schottland hinrichten zu lassen. Obschon in Folge dieses Entschlusses das Urtheil von Ihrer Majestät unterschrieben worden war, so hatte Ihre Majestät dennoch bei sich beschlossen, die Sache nochmals zu überlegen; diesem Vorhaben wurde aber durch Ihre Behörden, welche im Besitze des unterschriebenen Urtheils waren, zu Ihrem größten Schmerze (aus welcher Ursache auch Ihr Staats-Secretair Davison in’s Gefängniß gesetzt und viele Andere in die Ungnade Ihrer Majestät fielen, auch legte Ihre Majestät Trauerkleidung an) zuvorgekommen, indem sie den Vollzug des Urtheils sofort anbefohlen hatten. Die Grafen Shrewsbury und Kent hatten durch den Secretair Beale die Vollmacht Ihrer Majestät zur[WS 1] Vollstreckung des Urtheils erhalten und kündigten an dem der Hinrichtung vorhergehenden Tage der Königin von Schottland in Gegenwart mehrerer Statthalter, Ritter, Edelleute und der Gefängniß-Vorsteher Amias Paulet und Drughei die desfallsigen Befehle Ihrer Majestät an.
Die Königin Maria erwiderte denselben, sie sei zu sterben bereit und habe schon lange auf ihren Tod gehofft; zugleich fragte sie, auf welchen Tag ihre Hinrichtung festgesetzt sei, worauf die Grafen ihr entgegneten, daß sie ihr die Bestimmung des Tages freistellten, nur dürfe dadurch der Vollzug der Befehle Ihrer Majestät nicht verzögert werden, und wäre es dieserhalb am besten, den nächstfolgenden Tag, den 18. Februar neuen Styls, dazu zu bestimmen. Die Grafen unterhielten sich hierauf mit der Königin von Schottland und setzten ihr die Gründe auseinander, durch welche Ihre Majestät und das Reich zu diesem äußersten Entschlusse gekommen wären, und baten dieselbe, Alles mit Geduld und Vertrauen auf Gott zu ertragen.
Am folgenden Tage, am 18. Februar, Morgens um 7 Uhr, erschienen in dem Gefängniß zu Fotheringhay die genannten Grafen, Statthalter und Edelleute; einigen Edelen wurde gestattet, zwei Bekannte, den Uebrigen nur einen Freund mitzubringen, so daß ungefähr achtzig bis hundert Personen, mit Ausschluß der zur Umgebung und Dienerschaft der Königin von Schottland gehörigen Personen, so wie der Besatzung des Castells, eingeführt wurden.
Zur Hinrichtung wurde in einer großen Halle eine Bühne von zwölf Fuß Länge, zwei Fuß Höhe mit einer zwei Fuß hohen Einfassung errichtet, welche ganz mit schwarzem Tuche belegt war, in der Mitte stand ein gepolsterter Sessel. Nachdem diese Anstalten getroffen und alle Edelleute angekommen waren, wurde ein Bote zu der Königin von Schottland geschickt, um ihr anzukündigen, daß alle Grafen versammelt wären, und anzufragen, ob sie jetzt bereit sei, wie dieses am vorhergehenden Tage nach dem Frühstücke ihr bekannt gemacht worden. Der Bote fand das Schlafgemach der Königin, worin ihre ganze Umgebung versammelt war, verschlossen. Bald darauf wurde ein anderer Bote mit dem Auftrage entsendet, wenn die Thüre noch verschlossen wäre, anzuklopfen und um Antwort zu bitten; derselbe fand die Thüre geöffnet und richtete seinen Auftrag an eine Person aus der Umgebung der Königin aus, welche ihm die Antwort gab, daß dieselbe noch nicht bereit sei. Nach einer halben Stunde wurde ein dritter Bote entsandt, welcher die Antwort brachte, daß die Königin in einer halben Stunde bereit sein würde. Bald darauf begab sich einer der Statthalter zu der Königin, welche er mit ihrer ganzen Umgebung knieend und betend antraf. Als derselbe der Königin bemerkte, daß die Zeit herannahe, erhob sich dieselbe und erklärte, daß sie bereit sei.
Gestützt auf zwei Männer, verfügte sich nun die Königin in die Vorhalle, woselbst sie ihre ganze Dienerschaft weinend und jammernd fand und dieselbe zur Gottesfurcht und zum Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten ermahnte. Hierauf nahm sie von Jedem einzeln Abschied, indem sie die Frauen küßte und den Männern die Hand zum Kusse reichte, zugleich bat sie dieselben, sich wegen ihres Schicksals keinen Kummer zu machen, sondern vielmehr sich darüber zu freuen und ihrer im Gebete zu gedenken. Von hier wurde sie die Stiege herabgeführt und in der Halle von allen Edelleuten empfangen, worauf der Graf Shrewsbury sie also anredete:
„Herrin, wir sind hier, um die Befehle Ihrer Majestät unserer Königin, welche wir Dir gestern mittheilten, zu vollziehen“ (wobei Graf Kent seine Vollmacht und das Urtheil, mit dem großen Siegel Englands versehen, in der Hand hielt).
Die Königin erwiderte, sie ziehe den Tod ihrem Leben vor. Als sie hierauf, sich umkehrend, ihren ersten Haushofmeister Melvil erblickte, sagte sie zu ihm: „Mein treuer Diener Melvil, obschon Du ein Protestant bist, ich aber eine Katholikin und Deine gesalbte Königin, aus dem Blute des Königs Heinrich VII. stammend, so befehle ich Dir wahrhaft und gleich wie vor Gottes Angesicht, Rechenschaft über mich zu geben und meinem sehr geliebten Sohne zu sagen, daß ich ihn inständigst bitte, Gott zu dienen, die katholische Kirche zu schützen und zu schirmen, in Frieden zu regieren und sich Anderen nicht zu unterwerfen; sollte er den Wunsch gehegt haben, diese Insel mit seinem Reiche zu vereinigen, so möge er davon abstehen und sich hüten, der menschlichen Weisheit zu viel zu vertrauen, indem sie sehr häufig täuscht. Möge er auf Gott seine Hoffnung setzen und der Königin von England nie Veranlassung zu Verdacht und Mißtrauen geben, so wird ihn Gott segnen; und Du, Melvil, sollst mein Zeuge sein, daß ich treu Schottland, treu Frankreich und treu der katholischen Religion, welche ich stets bekannt habe, sterben werde.“
Nachdem die Königin noch mehreres Aehnliche gesprochen, entgegnete ihr Melvil: „Verehrungswerthe und hochverehrte Fürstin, so wie ich bisheran stets ein treuer Diener Deiner Majestät war, so will ich auch jetzt mit Gottes Gnade diese Deine Worte und Befehle dem Könige treu und wahr hinterbringen.“
Die Königin wandte sich hierauf zu den Herren und bat sie zu erlauben, daß ihr Geistlicher zugleich mit ihr das Gerüst besteige, was ihr aber abgeschlagen wurde. Hierauf bat sie, zu gestatten, daß alle ihre Diener bei ihrer Hinrichtung zugegen sein [74] dürften, damit sie dem Könige von Frankreich und Anderen bezeugen könnten, daß sie im katholischen Glauben gestorben sei. Die Herren erwiderten hierauf, daß dieses nicht zugelassen werden könne, damit ihr Gemüth durch die Unruhe und den Jammer der Diener nicht beunruhigt oder durch ihren Aberglauben gestört werde. Endlich wurde ihr doch gestattet, daß fünf ihrer Diener und zwei Kammerfrauen bei der Hinrichtung zugegen sein dürften. Die Königin wünschte ein größeres, ihrem Stande angemessenes Gefolge von Kammerfrauen zu erhalten und versprach, für deren Folgsamkeit einzustehen und sich weder durch ihre Thränen, noch Mitleidsbezeigungen stören zu lassen. Sie bat hierauf noch darum, daß allen ihren Dienern und ihrem Hausgesinde beiderlei Geschlechts die Erlaubniß ertheilt werden möge, in ihr Vaterland zurückzukehren, und daß ihnen dasjenige gelassen würde, was sie ihnen geschenkt habe. Die Königin schloß diese Bitte mit den Worten: „Sie, meine Herren, verpflichte ich, dafür zu sorgen, daß dieser mein Wille vollzogen werde.“
Hierauf wurde die Königin durch zwei Diener des Befehlshabers des Castells auf das Blutgerüst geführt, woselbst sie sich, weil sie nicht bequem stehen konnte, niedersetzte. Die beiden Grafen stellten sich zur Seite der Königin, worauf der Secretair Beale mit lauter Stimme den zur Hinrichtung ertheilten Befehl vorlas. Die Königin trug dasselbe Kleid, worin sie auch vor dem Gerichte erschienen war, nämlich von sehr kostbarer schwarzer Seide; in der Hand hielt sie ein Crucifix von Holz oder Knochen, ein goldenes hing an ihrem Halse, und um den Gürtel hatte sie einen Rosenkranz.
Zunächst bei der Königin stand der Dechant von Peterborough, welcher auf Befehl der Grafen sie ermahnte, an Christum zu glauben und christlich zu sterben. Die Königin unterbrach seine Ermahnung, indem sie mit lauter Stimme betete, und befahl, daß er schweigen möge, indem sie hinzufügte, sie sei ganz zum Tode vorbereitet. Als der Dechant ihr erwiderte, er werde Nichts sagen, außer was ihm anbefohlen worden und Wahrheit enthalte, rief die Königin: „Schweige, Dechant, ich will Dich nicht anhören, ich habe Nichts mit Dir zu thun, Du störst mich,“ worauf derselbe fortan schwieg.
Der Graf Kent sagte hierauf zur Königin: „Herrin, ich beklage Deinen Tod deshalb am meisten, weil ich diesen unnützen und abergläubigen Gegenstand in Deinen Händen sehe,“ worauf die Königin ihm entgegnete: „das Bildniß des gekreuzigten Christus geziemt sich für mich, und erinnert mich an den Herrn.“ – Kent erwiderte, man müsse Christum im Herzen tragen, und fügte hinzu (obschon die Königin sich sträubte ihn anzuhören), er wolle, wenngleich sie diese Gnade Gottes verschmähe, für sie beten, daß der Herr ihr ihre Sünden verzeihe, und sie in sein Reich aufnehmen möge. Die Königin sagte hierauf, daß auch sie darum bitte. Der Dechant kniete während dessen an dem Blutgerüste, und hielt mit heller und vernehmbarer Stimme ein eindringliches und den Umständen angemessenes Gebet, indem er für die Wohlfahrt Ihrer Majestät und des Reichs betete, welches Gebet von allen Anwesenden nachgebetet wurde.
Während dieses geschah, sagte die Königin mit sehr lauter Stimme ihr eigenes lateinisches Gebet, wobei sie das Bild des Gekreuzigten in den Händen hielt. Nach Beendigung des Gebets bat der Henker knieend die Königin um ihre Verzeihung, die sie ihm und Allen, welche bisheran nach ihrem Blute getrachtet, liebevoll und mit Freuden ertheilte, gleichwie auch sie wünschte, daß ihr der Herr ihre Sünden verzeihen möge.
Hierauf verrichtete die Königin knieend und sehr bewegt nochmals ein eifriges Gebet um Verzeihung ihrer Sünden und drückte die Hoffnung aus, daß sie durch den Tod Christi und dessen vergossenes Blut die Seligkeit erlangen würde, wie auch sie ihr Blut freiwillig und mit Freuden für den Gekreuzigten zu vergießen bereit sei. Sodann betete sie für das Heil der Königin von England und wünschte ihr eine lange und ruhige Regierung, und daß sie Gott treu dienen möge; sie betete für die ganze Insel und für die sehr bedrängte Lage der Kirche Christi; sie betete ferner für ihren Sohn, den König von Schottland, damit er in Friede und Gerechtigkeit sein Reich verwalte und durch Bekehrung zur römisch-katholischen Kirche zum wahren Glauben gelangen möge. Endlich flehte sie um die Vermittlung aller Heiligen dieses Tages, wünschend, daß Gott durch seine unendliche Gnade seinen Zorn von dieser unglücklichen Insel abwenden, ihr selbst alle Sünden erlassen, und ihre vom Körper getrennte Seele durch die Hände der Engel in den Himmel aufnehmen möge. Nach Beendigung dieses Gebetes stand die Königin auf und bereitete sich zur Hinrichtung, indem sie ihren Schmuck ablegte, und ihre Tunika mit Hülfe ihrer zwei Kammerfrauen auszog. Als einer der Henker hierbei behülflich sein wollte, sagte sie, sie sei bisheran weder gewöhnt gewesen vor einer solchen Menge ihre Kleidung abzulegen, noch die Hülfe solcher Edelleute dabei in Anspruch zu nehmen.
Die Königin legte das äußere Kleid bis zur Mitte der inneren Tunika ab; der so heruntergelassene obere Theil war am Halse tief ausgeschnitten, so daß derselbe rundum entblößt wurde; das Kleid wurde auf dem Rücken mit Schnüren zusammengehalten, welche sie mit großer Eile auflöste, ihre Kammerfrauen küßte und ihnen Lebewohl sagte. Als die Eine derselben laut weinte, sagte die Königin zu ihr: „Schweige, jammere nicht, habe ich nicht für Euch dafür eingestanden, daß Ihr Euren Schmerz nicht laut werden lassen würdet? Ihr müßt heiter sein.“ Sie segnete Beide und befahl jener, das Blutgerüst zu verlassen.
So zum Tode bereitet, wandte sich die Königin zu ihren in der Nähe knieenden Dienern, machte mit ihrer schönen Hand das Zeichen des Kreuzes über dieselben, befahl ihnen Zeuge zu sein, daß sie als Katholikin sterbe, und bat sie zu Gott um Vergebung ihrer Sünden zu beten. Nach dieser Anrede ließ sich die Königin plötzlich auf die Kniee fallen; sie zeigte fortwährend einen großen und unerschütterlichen Muth, gab nicht das geringste Zeichen von Furcht zu erkennen, und wechselte selbst nicht einmal die Farbe. Die zweite Kammerfrau trat hinzu und verband ihr mit einem Schnupftuche die Augen, während die Königin auf den Knieen mit heller Stimme den 27. Psalm betete: „Auf dich, o Gott, habe ich meine Hoffnung gesetzt“ etc. Hierauf beugte sie mit großer Standhaftigkeit ihren Körper vorwärts, legte den Hals auf den Block und rief mit lauter Stimme: „Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist!“ Während der eine Henker nun ihre Hand hielt, führte der andere mit beiden Händen den Streich mit dem Beile, worauf das Haupt fiel und so das Leben entfloh. Als der Henker hierauf den Kopf in die Höhe hob und den Zuschauern zeigte, riefen Alle: „Gott erhalte unsere Königin, so sollen alle Feinde des Wortes Gottes und Ihrer Majestät sterben!“ – Während aber der Henker so den Kopf der Königin in die Höhe hielt, fiel der Kopfputz herab, und man sah, daß das Haupt schon stark greis, und die Haare unlängst bis auf die Haut abgeschnitten waren. Der Henker erhielt Nichts von den Kleidern und dem Schmucke, wohl aber deren Werth an Geld; Alles, was mit dem Blute der Königin besprengt war, wurde sowohl den Henkern, wie allen Anderen abgenommen und sogleich abgewaschen; selbst die Breter des Blutgerüstes, das mit Blut getränkte Tuch und andere damit benetzte Sachen wurden sogleich verbrannt, damit sie nicht dem Aberglauben dienen sollten. Der Körper der Königin wurde in die Burg zurückgetragen, einbalsamirt und zur Beerdigung bereitet, an welchem Orte derselbe aber begraben werden wird, dies ist bis jetzt noch ungewiß. Dem Hausgesinde und den Dienern der Königin wurde befohlen, in der Burg zu bleiben, damit sie, wenn eine feierliche Beerdigung stattfinden sollte, derselben beiwohnen könnten. Die Königin war ungefähr 44 Jahre alt, eine Fürstin von ausgezeichneter Schönheit, sodaß sie alle Frauen ihres Vaterlandes an Schönheit übertraf. Zuerst war sie verheirathet mit Franz II., König von Frankreich; nach dessen Tod mit Lord Darnley, dem Sohne des Grafen Lennox, einem sehr schönen Jüngling, welchen sie tödten ließ. In dieser Ehe wurde der jetzige König von Schottland geboren. Endlich heirathete sie den Grafen Bothwell, welcher in Dänemark gefangen wurde und geisteskrank starb.
Während der Hinrichtung der Königin war die Burg verschlossen und Niemandem der Austritt gestattet, außer dem Heinrich Talbot, dem Sohne des Grafen Shrewsbury, welcher an den Hof gesandt wurde, und am folgenden Tage die Nachricht von dem Tode der Königin von Schottland nach London brachte. Als die Bürger Londons diese Kunde erhielten, freueten sie sich sehr und läuteten mit allen Glocken; sie freueten sich, daß sie von der großen Gefahr, welcher sie so lange ausgesetzt gewesen, endlich befreit waren. Nur allein die Königin von England legte einen großen Seelenschmerz an den Tag, weil die Hinrichtung gegen ihre Erwartung übereilt worden war und sie beschlossen hatte, dieselbe nochmals in reifliche Ueberlegung zu ziehen.
Seit dem Tage der Hinrichtung bis zum 28. Februar 1587, [75] an welchem Tage gegenwärtiger Bericht abgefaßt wurde, herrscht übrigens hier in England die größte Ruhe; wir hoffen auch ferner auf Frieden und Ruhe, weil der jetzige große Schrecken bei den Feinden der Königin und Ihrer Majestät nicht ohne Wirkung bleiben, und den Fürsten und Herzögen eine Mahnung sein wird, nicht von Gott und der Gerechtigkeit abzuweichen, wenngleich sie auch in dieser Welt sich vor der Furcht der Strafe befreit glauben sollten. — So weit der Bericht.
Wir haben nur noch hinzuzufügen, daß die Königin Elisabeth den Wunsch der Hingerichteten, bei ihrer Mutter in Frankreich begraben zu werden, nicht erfüllt hat. Nach Verlauf von sechs Monaten, Donnerstag den 1. August 1587, wurde die Leiche endlich mit einem königlichen Ceremoniel in der Kathedrale von Peterborough, dem Grabe Katharinens gegenüber, beigesetzt. Zweiundzwanzig Jahre später ließ ihr Sohn, Jakob VI., den Leichnam nach London bringen und in Heinrich’s II. Capelle beisetzen. Ihr prachtvolles Monument daselbst in der Westminster-Abtei ist auch in deutschen Reisewerken schon öfters abgebildet worden.
Rendsburg ist meine liebste Stadt zwischen Elbe und Königsau.
Ich liebe Rendsburg in seiner Geschichte, in seiner Lage,
in seiner charakteristischen Altstadt, in seinen Bürgern. Rendsburg
liegt gerade in der Mitte Schleswig-Holsteins; es ist der Knoten
in der Vertheidigungslinie der Eider, die natürliche Brücke von
Holstein nach Schleswig. In Rendsburg und seiner Umgegend,
welche keinesweges von der Natur so begünstigt ist, wie die üppigen
Districte des Ostens, wohnt mit der edelste Theil der Ureinwohner
des Landes, der Kern des nordalbingischen Sachsenstammes. Von
diesem zwischen Eider und Stör gelegenen Theile Holsteins, welcher
heute das Amt Rendsburg umfaßt, gingen die großen und
historischen Ereignisse des Landes aus. Bei diesem energischen
und kräftigen Menschenschlage fand Karl der Große auf seinen
verheerenden Raub- und Eroberungszügen den kräftigsten Widerstand.
Von hier aus wurden die Dänen nach dem Norden, die
Wenden nach dem Osten zurückgeworfen; die Heldenschaar, mit der
Gerhard der Große das dänische Reich unterwarf, war aus der
Gegend zwischen Eider und Stör.
Seit uralter Zeit war die Eiderinsel, auf der Rendsburg liegt, befestigt. Sie führte den Namen Reinoldesburg. Als Stadt trat Rendsburg mächtig unter den Städten der Herzogthümer hervor unter dem großen Grafen Gerhard, der in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts lebte. Christian der Fünfte erweiterte den Ort auf seine heutige, doppelte Größe, und schuf ihn zu einer Festung um. Und von jeher haben sich die Bewohner von Rendsburg durch ihre kräftige Energie, durch ihre patriotische Gesinnung, durch seltenes, gesundes Urtheil, durch geistiges Leben und edle Bildung ausgezeichnet.
Rendsburg war immer und zu allen Zeiten ein Fels des Landes. An seiner kernigen und muthigen Bürgerschaft brach sich die Macht der Schweden im dreißigjährigen Kriege. Und diese Stadt wurde im Jahre 1851 mit ihren Kriegsvorräthen, welche für eine Armee von 50,000 Mann ausreichen, mit ihrem Feld- und Belagerungsgeschütz so schmählich den Dänen ohne Schwertstreich, ohne Schuß geopfert! — Sie zerstörten alle nach dem Norden gelegenen Festungswerke, bauten zwischen Altstadt und Neustadt die Forts, welche sie zum Hohn Deutschlands „Südjütlands- Brückenkopf“ nannten, und machten sie zu einem Bollwerk dänischer Herrschaft gegen die deutsche Nation. Aber auch rund um die Stadt herum wohnt ein gar gediegener und tüchtiger Bauernstand, ein Bauernstand, der sich durch aufgeweckten, gesunden Verstand, durch seltene Intelligenz, durch kräftigen Unternehmungsgeist, durch gemeinnützige Gesinnung, durch wahrhaft deutschen Sinn auszeichnet. Hier liegen die alten, großen und historischen Dörfer des Landes.
Es sind nun zwei Jahre, daß ich zum letzten Male in Rendsburg war. Die Stadt lag damals voll von dänischen Truppen; dänische Beamten und dänische Polizei unterdrückten alle bürgerliche und individuelle Freiheit. In der Presse knebelte die dänische Regierung die Freiheit des Gedankens und die öffentliche Meinung. Das nationale, deutsche Bewußtsein der Bürger sollte dem Dänenthum weichen. Aber die Energie und die Zähigkeit der Bevölkerung waren stärker, als alle Anstrengungen des dänischen Regierungsmechanismus. Wie ehemals in der Lombardei, wie heute noch in Venetien, setzten Alle einmüthig den Dänen den zähesten Widerstand entgegen. Den Dänen öffnete sich kein deutsches Haus, noch weit weniger ein deutsches Herz. In keiner Gesellschaft hatten die dänischen Beamten und Officiere Zutritt; zu keinem Feste, zu keinem Balle wurden sie geladen; man sprach nicht mit ihnen, man grüßte sie nicht, man saß nicht mit ihnen im Gasthause an demselben Tische. Sie lebten einsam, wie in einer menschenleeren Wüste, nur auf den Umgang mit sich selbst und mit ihren Familien angewiesen. Wer diesen Bann brach, den man um die Dänen gezogen, der war selbst von der ganzen Gesellschaft ausgestoßen. Verachtet ging er ebenso einsam umher. Zwölf Jahre haben die Rendsburger Bürger diesen Widerstand mit einer seltenen Consequenz und Ausdauer durchgesetzt, mit einer zähen Energie, um welche die Lombarden in Mailand und Brescia sie hätten beneiden können. Jetzt sah ich Rendsburg wieder, das von der dänischen Herrschaft befreite Rendsburg. Ich hatte die Heerstraße zu meiner Reise benutzt. Alle Häuser waren mit deutschen und schleswig-holsteinischen Fahnen geschmückt, in den Straßen erklang das Schleswig-Holsteinlied, vor der Hauptwache am Paradeplatze und auf „Südjütlands-Brückenkopf“ wehten die Fahnen Schleswig-Holsteins und des gemeinsamen, großen deutschen Vaterlandes fröhlich im Morgenwinde. Und als ich Morgens erwachte, da hörte ich auf dem Paradeplatze die Signale sächsischer Hörner und deutsche Commandoworte: „Gewehr auf, Marsch, Marsch!“ und eine sächsische Jägercompagnie zog vorüber, um die Stellung an der Schleußenbrücke und an den Schanzen zu besetzen. Und ein lieber Freund, der Advocat Fischer, trat zu mir in die Stube und sagte: „Wollen wir nicht einen Gang durch Rendsburg machen? Vor zwei Jahren habe ich Sie auch durch die Stadt geführt. Damals war es anders. Heute sollen Sie Rendsburg ohne Dänen sehen.“
„Ja,“ rief ich. „Vor zwei Jahren war es an einem warmen und heitern Sommertage, heute liegt eine dichte Schneedecke und ein grauer Nebel über der Stadt; aber das Herz ist ebenso heiter und fröhlich, wie es damals traurig war.“
Und aus der casernenhaft und regelmäßig gebauten Neustadt gingen wir durch die herrliche Allee von Ulmen und Linden über den Jungfernstieg nach der noch im mittelalterlichen Styl aufgebauten Altstadt. Zu beiden Seiten des Weges goß sich in weiter Fläche die Eider aus. Den Wasserspiegel bedeckte heute eine schimmernde Eisdecke. Auf dem Jungfernstieg waren bei einigen prächtigen Bäumen die Krone und ein Theil der Aeste abgeschlagen; manche trugen die Spuren von Axthieben auch an den Stämmen; drüben auf der anderen Seite des Wassers war eine lange Reihe herrlicher Ulmen in ähnlicher Weise verunstaltet. Eine prächtige Trauerweide, welche vor zwei Jahren weit über den Wasserspiegel hinabhing, fehlte heute ganz. „Wer hat denn diese prächtigen Bäume in so barbarischer Weise verunstaltet? wo ist denn die schöne Trauerweide geblieben, welche ich damals so bewunderte?“ fragte ich, erstaunt über diese Verwüstung, meinen Freund.
„Glauben Sie,“ erwiderte er, „daß diese Barbarei Jemand anders begangen haben kann, als die Dänen? Es fiel ihnen plötzlich ein, daß die Altstadt zu Schleswig gehöre, und sie hatten die Absicht, Rendsburg nur bis „Südjütlands-Brückenkopf“ zu räumen, der, wie Sie sehen, dort am Ende der Promenade des Jungfernstieges die Altstadt von der Neustadt trennt. Hinter den Forts dort wollten sie sich festsetzen und sämmtliche Bäume hier auf der Promenade niederhauen, um für ihre Kanonen freien Spielraum zu haben, wenn die Sachsen durch die Neustadt heranzögen.
[76] Sehen Sie da und dort, zwanzig Schritte weiter die Vertiefungen im Boden quer über den Weg?“
„Ja, ich sehe sie. Woher rühren sie?“
„Die Dänen hatten zwei Palissadenreihen quer über die Straße gebaut, um hinter ihnen den Durchgang zwischen den beiden Forts nach der Altstadt zu vertheidigen.“
„Nun, und wo sind die Palissadenreihen geblieben?“
„Es war zu lächerlich,“ sagte der Advocat, „zweimal haben sie die Palissadenreihen in zwei Tagen aufgebaut, und wieder niedergerissen. Ihre Unentschlossenheit war eben so groß, wie die Lust, hier, mitten in Rendsburg Halt zu machen in ihrer Retirade.“
„Und wie war ihr Abzug?“
„Kläglich, ganz still und lautlos. Es lag ein dichter Nebel. Sie verschwanden fast ungesehen. Dann stieg die Sonne hinter den grauen Nebelvorhängen empor, feurig, glänzend, die Häuser und der Wasserspiegel erschienen wie in goldenes Licht getaucht. Und mit der Sonne zogen die Sachsen ein, von unendlichem Jubelruf begrüßt, und aus allen Fenstern flatterten in demselben Moment die schleswig-holsteinischen und die deutschen Fahnen. O, es war ein herrlicher Augenblick nach so langer, trüber Zeit!“
„Ist es denn wahr, daß die Dänen Alles fortgenommen und mitgeschleppt haben, was nicht niet- und nagelfest war?“
„O nein,“ erwiderte er lachend, „sie haben sogar das mitgenommen, was niet- und nagelfest war. Sie haben die Oefen aus den Baracken gebrochen, sie haben die Laternenpfähle dort drüben ausgerissen; in den Casernen, im Lazareth fehlt Alles, sie haben sogar die Nägel aus der Wand gerissen, an denen sie Kleidungsstücke aufgehängt hatten. Im Telegraphenamt fehlen alle telegraphischen Instrumente. Man erzählte mir, daß sie sogar die Fußböden aufgerissen und aus den Bretern Kisten gezimmert haben.“
„Und das Geld in den Cassen?“
„Glauben Sie etwa, daß die Dänen Geld liegen lassen? Nein, das wäre doch zu naiv!“
Wir waren am „Südjütlands-Brückenkopf“ angekommen. Der Name umschließt eine kolossale Frechheit, und zwar eine zweifache Frechheit, einmal, indem Schleswig „Südjütland“ genannt wird, dann, indem sie mit dieser Benennung die Grenze Schleswigs bis mitten in die Stadt Rendsburg verlegen. Aber wenn es auf dänische Anmaßung ankommt, da kann man ja über gar nichts erstaunen! Nun gingen wir links an dem Fort abwärts, immer an der Eider entlang, durch den sogenannten Schlangenweg und über die Schiffbrücke nach der Schleuße zu. Im Sommer ist dieser Weg ein sehr angenehmer Spaziergang. Links schweift das Auge über die blaue Wasserfläche des Flusses, welcher sich hier zu einem weiten Becken ausdehnt, rechts erheben sich hinter duftigen Wiesen die charakteristischen Häuser der Altstadt. Heute deckte die ganze Umgebung eine weiße Schnee- und Eisdecke. „Wohin führen Sie mich denn eigentlich hier, Freund?“ fragte ich den in schnellem Schritt neben mir gehenden Advocaten.
„Wohin? nun, nach dem Kronwerk. Sie sollen doch die Hannemänner ganz in der Nähe sehen. Sehen Sie da drüben den Danebrog? Er ist auf halben Stock aufgezogen, wegen der Trauer.“
Richtig, drüben am andern Ufer des Flusses flatterte lustig der Danebrog, das weiße Kreuz im rothen Felde auf hoher Stange. Noch einige hundert Schritt, und wir waren im Kronwerk angekommen. Die Scenerie war sehr belebt. Hier, gleich neben uns, waren eine Compagnie sächsischer Infanterie und eine Abtheilung Pioniere beschäftigt Erdschanzen aufzuwerfen. Mühsam arbeitete der Spaten in dem gefrornen Boden. Drüben am andern Ufer des Flusses standen das Zollhaus und einige andere Gebäude, welche dänische Infanterie besetzt hielt. „O,“ sagte der Advocat, „kommen Sie, Sie können die Dänen noch näher haben. Auf zehn Schritte sollen Sie Hannemann sehen.“ Wir gingen an dem Wasserbecken entlang bis dahin, wo dasselbe durch eine Schleuße mit einem zweiten, weiten Wasserbecken verbunden war. Die Schleuße hatte eine Breite von ungefähr zwanzig Schritt. Ueber derselben lag eine Brücke, welche aufgezogen werden konnte. Jenseits derselben standen zwei dänische Posten. Hier, auf der andern Seite standen ihnen zwei sächsische Posten gegenüber. Die Dänen hatten das Gebäude, welches ihnen als Wachthaus diente, durch eine hohe Palissadenreihe gegen die Brücke zu geschützt. Hier drüben hatten die Sachsen ihre Wache ebenfalls in einem hart am Ufer liegenden Gebäude eingerichtet, und eine Palissadenreihe gerade derjenigen der Dänen gegenüber erbaut. Officiere und Soldaten gingen ab und zu. Viele Soldaten standen an der Schleußenbrücke und schauten plaudernd hinüber. Vor dem sächsischen Wachthause wehten die schleswig-holsteinische und die deutsche Fahne. So nahe haben sich Deutsche und Dänen lange nicht gegenüber gestanden.
„Was meint ihr, Kinder?“ fragte ich die neben uns stehenden Unterofficiere und Soldaten, „wollen wir nicht hinüber über die Brücke und die Hannemänner aus dem Lande treiben?“
„O,“ erwiderte einer der Unterofficiere, „wenn wir nur dürften, wie wir wollten, die Dänen wären auch schon aus Schleswig. Aber da stehen wir hier und dürfen nicht vorwärts, und da drüben plündern die Dänen die schleswigschen Dörfer aus. Nie dürfen wir wieder nach Dresden kommen, wenn wir die Dänen nicht aus dem Lande getrieben haben. Man wird uns verachten. Und so denken wir Alle, die Soldaten und die Unterofficiere. Und es liegt doch nicht an uns.“
„Ja, so denken wir Alle,“ sagte ein zweiter Unterofficier, „alle Sachsen. Auch die Hannoveraner denken so. Wir gehen nicht wieder zurück nach Altona.“
Da trat ein Rendsburger Bürger heran, als er uns bemerkte. Ich kannte ihn recht gut, noch von früher her. „Schändlich,“ rief er, „ist das nicht schändlich? Sehen Sie da drüben die sechs holsteinischen Dörfer, welche zwischen Eider und Sorge liegen. Bis jetzt hat kein Mensch in der Welt bestritten, daß sie zu Holstein gehören. Und die Dänen halten sie besetzt und plündern sie aus, und wir stehen hier und sehen zu, und der Bundestag – setzt keine Sitzung an. So eben erzählt mir ein Mann aus Büdelsdorf, aus dem größten Dorfe da drüben, daß gestern bereits Execution angesagt ist wegen der eigentlich erst am 14. Januar fälligen Steuern. Es ist den Dänen plötzlich eingefallen, sie zum 5. Januar einzufordern. Und eine Requisition ist angesagt, die die Dörfer vollkommen ruiniren muß. Von Heu und Stroh soll die Hufe Landes 3–4000 Pfund liefern. Schwertfeger, der den „Megger Koog“ besitzt, soll allein eine Million Pfund Heu liefern. Und es ist so leicht, jetzt die ganze Danewerkstellung zu nehmen,“ fuhr er fort, „jetzt, wo die Treene und die Schley gefroren sind; fast ohne Verlust kann man sie nehmen, während, wenn das Wasser wieder auf ist, zehntausend Menschen dabei umkommen können. Es ist eine schändliche Geschichte.“
„Kennen Sie die Stellung so genau?“ fragte ich ihn.
„Ganz genau. Ich habe darin gearbeitet. Ich kenne jede Schanze, jedes Geschütz. Wenn Sie wollen, will ich Ihnen die Stellung ganz genau beschreiben. Aber ich muß schleunig nach der Stadt. Sie müssen mit mir zurückgehn.“
Wir gingen der Eisenbahn entlang bei der Schanze, welche dort die Hannoveraner bauen, vorüber nach der Stadt. „Unsinn,“ murmelte der Rendsburger Bürger, als wir bei den Schanzarbeitern vorüberkamen, „diese Schanze! Was soll die Schanze? Sie wird nur angelegt, um die Leute zu beschäftigen.“ Auf dem Eise liefen halberwachsene Knaben Schlittschuh. Sie hatten bunte Bänder in den schleswig-holsteinischen Farben in Händen, und wenn sie ganz in der Nähe der drüben postirten dänischen Schildwachen waren, hielten sie ihnen die Bänder hin und riefen: „Hannemann, kennst Du dat?“ oder: „Hannemann, kannst mi kriegen?“ worauf sie dann eilig zu dem andern Ufer zurückjagten.
„Unsere Lage ist wahrlich zu ernst zu solchem Kinderspiel,“ sagte der Rendsburger Bürger, als wir neben dem Flüßchen hin zur Stadt zurückgingen. „Aber hören Sie jetzt, nun will ich Ihnen die Danewerkstellung schildern, Herr Doctor; aber bringen Sie’s in Deutschland in die größte Zeitung. Die Dänen werden sich schändlich darüber ärgern. Allein können Sie nicht Schleswig-Holstein erobern, leider nicht; aber so geärgert hat die Dänen, wie Sie, bis jetzt selten Jemand. Also hören Sie: Friedrichsstadt bildet den rechten Flügel der Stellung. Es hat 3 Schanzen, eine starke Schanze und zwei Lünetten. Sie sind mit 13 Kanonen armirt, 6pfünder bis 84pfünder. Der Brückenkopf ist zerstört. Nun weiter nach links. Die nächsten Schanzen sind bei Hollingstedt. Zwischen Friedrichsstadt und Hollingstedt bildet die Treene die Überschwemmung des Treenethals. Zwischen Hollingstedt und Kurburg sind neun starke Schanzen. Sie sind armirt mit einem 84pfünder, zwei 4pfündern, zwei 18pfündern und zwei 6pfündern. Von Kurburg bis Danewerk sind fünf Schanzen. Sie sind ebenso armirt, wie die vorigen. Das Terrain ist dort flach. Von Danewerk bis Pustorf sind acht Schanzen. Davon sind drei Schanzen nicht armirt. Das Terrain ist hügelig.
[77][78] Hier ist die Stellung am leichtesten angreifbar, weil das vorliegende Terrain aus Moorgrund und Wiesen besteht und das gegenüberliegende Terrain hügelig ist. Jetzt ist das ganze Terrain gefroren. Hier ist die Stellung also bei dem gefrorenen Terrain, und weil die Schanzen nicht armirt sind, leicht zu nehmen. Bei Friedrichsberge ist eine Schanze mit vier Geschützen, zwei 18pfündern und zwei 6pfündern. Hier beginnt nun die Schley. Jetzt ist sie gefroren und haltlos. Die nächsten Schanzen sind bei Missunde. Es sind ihrer drei, jede mit acht Geschützen armirt. Bei Missunde ist die leichteste Übergangsstelle über die Schley. Die ganze Schanzenreihe hat bis Schleswig eine Länge von sieben Meilen, von Schleswig bis Missunde dritthalb Meilen. Zu ihrer Besetzung sind wenigstens 2400 Artilleristen nöthig. Es ist gar nicht zu verantworten, daß die Stellung nicht jetzt augenblicklich angegriffen wird. Wie ich Ihnen sage, sie wäre fast ohne Blutverlust zu nehmen.“
„Aber warum armiren die Dänen die Schanzen nicht jetzt vollständig?“ mußte ich doch meinen Begleiter fragen, der sich nach und nach in eine Entrüstung hineingeredet hatte, wie sie mir bei einem Schleswig-Holsteiner noch nicht vorgekommen war.
„Das wäre ein Kunststück,“ rief er, „was selbst die Energie der dänischen Regierung nicht fertig bringen würde. Materiell ist die ganze Vertheidigungslinie noch höchst unvollständig; vor acht Tagen waren die Pulvermagazine noch nicht fertig. Die Dänen werden auch nie im Stande sein, die Linie zu besetzen. Bei der Anlage ist auf Mitwirkung einer schwedischen Armee von 40–50,000 Mann gerechnet. Leider bleibt die Armee nur aus.“
Wir waren wieder bei „Südjütlands-Brückenkopf“ am Jungfernstieg angekommen.
Am Abend wäre ich durch einen Zufall fast den Dänen in die Hände gerathen. Ich war im Begriff, vor Pahl’s Hotel am Paradeplatze in eine Droschke zu steigen, um nach dem Bahnhof zu fahren. Da sprang der Hauptmann von Kolb, der jetzige Besitzer des Gasthofes, der während der Feldzüge eine Compagnie der schleswig-holsteinschen Armee führte, hinzu und rief: „Was Teufel, wo wollen Sie denn hin?“
„Nun, ich will nach Kiel und fahre nach dem Bahnhof,“ entgegnete ich, ganz verwundert über die an dem sonst so ruhigen Hauptmann ungewohnte Hitze.
„Haben Sie denn vergessen, daß die dänische Regierung seit zwei Jahren schon befohlen hat, Sie, sowie Sie sich in den Herzogthümern betreten lassen, zu verhaften und gefangen nach Kopenhagen zu führen? Den Bahnhof haben die Dänen ja noch besetzt. Steigen Sie aus. Ich will Sie nach der Haltestelle in der Stadt fahren.“
Ich ging mit dem braven Hauptmann nach der Haltestelle.
Dort brachten wir noch eine halbe Stunde im Wartezimmer zu, bis der Zug ankam, um mich nach Kiel zu fahren. Das Wartezimmer war voll von Reisenden, mehrere Damen und Bürger aus Rendsburg, hannoversche Officiere und Fremde, welche ebenfalls nach Kiel und Altona wollten. Das „Unglück im Lande“ und „der verlassene Bruderstamm“ in Schleswig gab zu einer Menge leidenschaftlicher Ausbrüche Veranlassung. Am heftigsten traten die Damen auf, welche von den Officieren die Zurückforderung der in der dänischen Armee dienenden Schleswig-Holsteiner und die sofortige Vertreibung der Dänen aus Schleswig verlangten. Alle waren vollkommen miteinander einverstanden. Hätte es an den im Wartezimmer der Eisenbahnstation zu Rendsburg befindlichen Personen gelegen, die Dänen wären noch heute Abend aus den sechs holsteinischen Dörfern zwischen Eider und Sorge geworfen worden.
Zu den talentvollsten der jüngeren Zöglinge der Düsseldorfer Schule gehört unbedingt Friedrich Hiddemann, der Maler des allerliebsten Idylls, das wir unsern Lesern in einem sehr gelungenen Holzschnitte vorführen. Wie Becker, Knaus, Vautier und manche andere hochbegabte Düsseldorfer hat er seinen farbenreichen Pinsel vorzugsweise dem volksthümlichen Genre gewidmet und namentlich das gemüthliche heitere Element desselben vertreten.
Friedrich Hiddemann wurde als der Sohn eines Musikers im Jahre 1829 in Düsseldorf selbst geboren und, trotz seines energischen Widerstrebens, von seinem Vater gezwungen, sich für dessen Lebensberuf vorzubilden. Indeß, wie überall und immer, wo entschiedenes Talent nach einer andern Lebensgestaltung hinweist, so brach sich dieses auch bei Hiddemann durch alle äußeren Hemmnisse und Schwierigkeiten endlich siegreiche Bahn. Nach dem vorbereitenden Zeichnungsunterrichte durch den verstorbenen Maler und Bildhauer Götting sah er sich zu seiner unsäglichen Freude 1848 in die Malclasse der Düsseldorfer Akademie unter Professor Hildebrandt aufgenommen. Zwei Jahre später schloß er sich den Schülern Schadow’s an, um als solcher vier Jahre lang der Akademie anzugehören.
Allein das war nicht die Kunstrichtung, die seinem Naturell und der Art seiner Begabung entsprach, und so fielen seine ersten malerischen Versuche nach historischen Motiven keineswegs hoffnungweckend aus. Endlich aber fand er das Feld, das ihm zusagte, und nun errang er sich Erfolg auf Erfolg, so daß er schon heute unter den Ersten seines Kunstgebietes genannt wird.
Seine Bilder, die sich immer rasch verkauften und durch ganz Deutschland und bis nach Frankreich hinüber verbreiteten, sind bereits ziemlich zahlreich, so daß wir hier nur einiger der bedeutendsten gedenken wollen. Es sind dies vor Allem: der Sonntagmorgen, – Schwarzwälder Bauern stehen, liegen und sitzen vor der überfüllten Kirche und hören in den mannigfaltigsten pittoresken Gruppen und Stellungen die Predigt mit an; die Dorfschule der guten alten Zeit, – ein Blatt voll köstlichen Humors. Der Lehrer, der zugleich ehrsamer Korbmacher ist, sitzt eingeschlafen bei seinem Flechtwerk, während die liebe Jugend den glücklichen Moment zu allerhand ergötzlichem Unfuge nach besten Kräften ausbeutet; und der Confirmationsrock, – einem ungeschickten und mit drolliger Verblüffung dreinschauenden Bauernjungen wird vom Schneider der Confirmationsrock angepaßt, in dem sich der arme Bube ganz verliert. Die Frau Mama ist über das schlechte Augenmaß des unglücklichen dörflichen Kleiderkünstlers außer sich vor Aerger, der Großpapa aber sieht der wichtigen Procedur in tiefster Seelenruhe zu, und die kleineren Geschwister machen Mienen der komischsten Spannung.
Die Kegelbahn gehört zu den neuesten Arbeiten des fleißigen Künstlers, sie ist erst 1860 vollendet worden, und der Leser kann sich mit eigenen Augen überzeugen, wie reizend der gemüthliche Vorwurf behandelt ist. Wir nannten das Bild ein Idyll, und dies ist’s in der That, eine anheimelnde Sonntagsnachmittagsidylle mit dem ganzen Frieden und genügsamen Behagen, das unsere Phantasie mit ihr verbindet. Wir befinden uns im Baumgarten eines alterthümlichen rheinischen Wirthshauses; im Hintergründe ragt der Spitzthurm der Kirche herein. Wie verschieden und ausdrucksvoll sind nun die einzelnen Gruppen und Gestalten, die uns in diesem einfachen Rahmen entgegentreten! Der Sohn des reichsten Bauern, mit stattlichem Pelzpardel geschmückt, ist eben auf die Bahn getreten, kunstgemäß und bedächtig hat er die Kugel in die richtige Lage gedreht und mißt nun mit prüfendem Blicke das Ziel, ehe er seinen Wurf thut. Ihm zur Seite steht ein alter Bauer mit listigem Gesichte, der, auch bereits die Kugel in der Hand, dem jungen Kegler seine Rathschläge zu geben scheint. Alle Augen aber sind auf diesen letztern geheftet. Selbst der Herr Pfarrer, so recht ein Bild innerer Heiterkeit, jedenfalls noch einer aus der alten freisinnigen Schule, wendet den Blick nicht von der Scene, während neben ihm der Schulze oder ein anderer der Dorfmagnaten ihm die Wichtigkeit des Momentes mit bedeutsamen Mienen kunstgerecht auseinandersetzt. Und wie trefflich ist das Gemisch von Spannung und Neid ausgedrückt, das sich auf dem Antlitz des bei seinem Schoppen auf der Bank sitzenden Bauern ausprägt! Die Verlegenheit endlich des Anschreibers, der mit seinen Zahlen nicht in’s Reine zu kommen scheint, hat etwas Urkomisches! Mit einem Worte, das Ganze giebt trefflich die Stimmung der Scene wieder: Bewegung in der Ruhe. Das Bild fand denn auch allgemeine Bewunderung, ist aber leider ebenfalls nicht im deutschen Vaterlande geblieben, sondern nach Paris verkauft worden.
Im Leben ist unser junger Künstler die Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit selbst und erfreut sich in den Künstlerkreisen seiner Vaterstadt, und wo er sonst gekannt wird, der allgemeinsten Achtung.
[79]Preußische Beamte aus früherer Zeit. Im Jahre 1793 brachen in Breslau wegen eines verhafteten Schneidergesellen bedenkliche Unruhen aus, welche durch die Schwäche und Ungeschicklichkeit der Behörden eine traurige Wendung nahmen. Es wurde von Seite des Militärs auf die in den engen Straßen dicht gedrängte Menge geschossen und dabei siebenunddreißig Personen getödtet und einundvierzig schwer verwundet, darunter unschuldige Kinder, Frauen und zufällig Vorübergehende. Die Hauptschuld traf in der öffentlichen Meinung den allmächtigen Minister Grafen Hoym, einen Mann voll angeborener Liebenswürdigkeit, aber ebenso charakterlos, ohne sittliche Kraft, von Eitelkeit und Selbstsucht erfüllt. Bei dieser traurigen Angelegenheit richtete einer seiner Untergebenen, der feurige, hochbegabte Kriegsrath Zerboni in Petrikau, an den Minister einen Brief, worin er in einer weder vorher noch nachher gehörten Sprache ihm sein Sündenregister vorhielt. „Es sind,“ heißt es in diesem merkwürdigen Schreiben, „den 6. dieses Monats Auftritte in der Hauptstadt Schlesiens vorgefallen, die in einem wohlregierten Staate nicht möglich sind. Unsere Staatsverfassung ist gut, unsere Gesetze sind weise; wo kann der Fehler anders liegen, als in der Ausübung der letztern? Was hiervon auf die große Schuldrechnung Ew. Excellenz kommt, hat Ihnen Ihr Gewissen in der Nacht vom 6. zum 7. dieses Monats gesagt. Wehe Ihnen, wenn die guten Vorsätze, die Sie da faßten, das Schicksal aller Ihrer bisherigen Entschlüsse haben; Ihre letzten Jahre werden dann unrühmlich und Ihr Andenken verhaßt sein. – Sie wollen das Gute, aber Sie haben nicht die Kraft, es zu vollbringen. – Sie beugen Ihr Knie vor der Convenienz und huldigen der Laune des Moments. Sie schätzen den Stein nur um der Folie willen. – Sie haben das Vorurtheil der Geburt, das man sonst ertrug, zu einer Zeit, wo man so dreist jedem grauen Wahn in die Augen leuchtet, durch die kleinlich strengen Grenzlinien, die Sie in Ihren Cirkeln ziehen, unausstehlich und sich dem gebildeten Bürgerstande unerträglich gemacht. Neben den durch tausend bedenkliche Begünstigungen erkauften Bücklingen Ihrer souperfähigen Herren übersehen Sie die Achtung edler Männer, die im Sturme um Sie treten und Ihnen mit Rath und Entschlossenheit aushelfen könnten, wenn der Insektenschwarm, der nur im Sonnenblick Ihrer glänzenden Epoche zu dauern vermag, verjagt ist. – Mit Wehmuth habe ich es bei meiner kürzlichen Anwesenheit in Schlesien bemerkt, es ist weit gekommen. Männer von Kopf und Herzen hassen Sie nicht mehr; sie verachten Sie. Ihre Gunst ist der Stempel geworden, an dem man einen zweideutigen, charakterlosen Menschen erkennt. Man arbeitet daran, Ihre Periode zu beschleunigen.“
Um den allerdings außerordentlichen Ton dieses Briefes erklärlich zu finden, muß man einen Blick auf die damalige Zeit und die Menschen werfen. Noch wirkte das Beispiel Friedrich des Großen nach, der sich für den ersten Diener seines Staates erklärt hatte, noch gab es Beamte, die aus seiner Schule hervorgegangen waren und mitten in der unter seinem schwachen Nachfolger eingerissenen Sittenlosigkeit und Unmoralität die Gebote der Pflicht und Ehre treu erfüllten. Die Aufklärung des Jahrhunderts und die Donnersprache der französischen Revolution hatten die Geister aus ihrem Schlafe gerüttelt und auch in Deutschland eine mächtige Bewegung hervorgerufen. Dazu kam die Sturm- und Drangperiode der jungen, überschäumenden Literatur, besonders Schiller’s jugendliche Ideale und die Philosophie des großen Kant mit ihrem kategorischen Imperativ von gediegenem Erz. Alle diese Elemente fanden sich in dem Kriegsrath Zerboni vereinigt, der nach dem einstimmigen Zeugnisse selbst seiner Gegner ein vortrefflicher Kopf, heller Geist, warmer Patriot und musterhafter Staatsmann war.
Als schwärmerischer Eiferer für Tugend und Recht hatte er mit dem aus Oesterreich geflüchteten Kapuziner Georg Fessler und einigen gleichgesinnten Freunden eine Art Freimaurerorden ganz im Geiste jener Zeit unter dem Namen „Euergeten“ oder Gutesthuer gestiftet, mit dem Wahlspruch: „Dem Verdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut“ und der Absicht, die Vorrechte des Adels abzuschaffen, die Güter der hohen katholischen Geistlichkeit zu öffentlichen Zwecken zu verwenden, die Lage der ländlichen Bevölkerung zu verbessern und besonders für den Unterricht und die Erziehung des Volkes zu sorgen. Unglücklicher Weise geriethen die Papiere dieser an sich ganz unschädlichen Verbindung in die Hände des Grafen Hoym, der davon den geeigneten Gebrauch gegen seinen Gegner machte. Zerboni wurde ohne Urthel und Recht für unbestimmte Zeit auf die durch den Baron von Trenck berüchtigte Sternschanze in der Festung Magdeburg gebracht, wo er in einem dunkeln, feuchten Kellergemach ohne Bücher, Schreibmaterial und frische Luft längere Zeit schmachtete. In seiner Vertheidigungsschrift legte der unerschrockene Mann das offene Bekenntniß ab, daß er eine unumschränkte Monarchie nicht als das letzte Ziel der Cultur ansehn, indem er ein Verhältniß, wo auf der einen Seite lauter Zwangspflichten ohne Rechte, auf der andern lauter Rechte ohne Pflichten stehe, für widernatürlich gehalten habe. Selbst die republikanischen Ansichten seiner Freunde, die er nicht theilte, glaubte er nicht strafbar in einem Staate, wo einst der erste Mann des Jahrhunderts vom Throne herab bekannt, daß eine Monarchie die beste, nach Umständen auch die schlechteste aller Staatsverfassungen sein könnte; in einem Lande, wo ein Philosoph wie Kant unter öffentlicher Censur gelehrt, daß nicht eher die Hoffnung vorhanden sei, die Nationen in ein durch das Sittengesetz gebilligtes Verhältniß zu einander treten zu sehen, als bis sie sammt und sonders eine republikanische Regierungsform annehmen werden.
Endlich wurde Zerboni vor seine ordentlichen Richter gestellt und mit Anrechnung der bereits erlittenen Strafe zu einer milden Festungshaft verurtheilt. Das Kammergericht bestätigte diesen Spruch, indem es hinzufügte: „daß Zerboni um so strafbarer sei, da er als Justitiarius die Gesetze und Landesverfassung hätte kennen und einsehen müssen, wohin der Kampf gegen die Vorrechte der privilegirten Stände und gegen die vermeintlichen Privilegien der höheren Staatsbeamten führen werde.“
Nach seiner Freilassung veröffentlichte Zerboni eine Schrift „über das Bildungsgeschäft in Südpreußen“, worin die Regierung aufmerksam gemacht wurde, daß nur die Begründung eines freien Bauernstandes und die Begünstigung deutscher Einwanderer Polen in eine Vormauer gegen Rußland umzuwandeln im Stande sei. Der Minister Struensee erkannte die Richtigkeit dieser Ansicht und streckte Zerboni trotz seiner demokratischen Gesinnung das nöthige Geld vor, um seine Colonisationspläne zu verwirklichen.
Ein Freund und Gesinnungsgenosse Zerboni’s war damals der nicht minder ausgezeichnete Zollrath Hans von Held, der berühmte Verfasser des zu seiner Zeit so großen Aufsehen erregenden „schwarzen Buches“, das die ebenfalls unter dem Grafen Hoym geschehenen Unterschiede beim Verkauf und der Verschenkung der in dem polnischen Theile der Monarchie liegenden Güter schonungslos aufdeckte. Die Seele dieser Betrügereien, welche sich auf Millionen beliefen, war einer der Untergebenen und Creaturen des allmächtigen Ministers, der ehemalige Förster Triebenfeld, der mit der Zeit zum Forstrath befördert und sogar geadelt worden war. Der ehrliche Held, noch dazu durch das unverdiente Schicksal seines Freundes Zerboni gereizt, sammelte die betreffenden Thatsachen und veröffentlichte dieselben unter dem Titel: „Die wahren Jakobiner im preußischen Staate, oder actenmäßige Darstellung der bösen Ränke und betrügerischen Dienstführungen zweier preußischer Staatsminister.“ Statt des Druckorts hatte der Verleger „Nirgends und Ueberall“ angegeben, mit der Jahreszahl 1801. Dem schwarzen Einbande verdankte das Buch den Namen, unter dem es allgemein bekannt geworden ist.
Held zeigte dem ihm befreundeten Minister Struensee das Manuscript vor der Herausgabe seiner Schrift und fragte seinen Vorgesetzten um Rath. Struensee behielt die Schrift einige Tage bei sich, und als er sie zurückgab, erklärte er die Thatsachen für richtig, allein bei weitem noch nicht vollständig, indem er hinzufügte, er kenne den tieferen Zusammenhang, ein Geheimniß, das der Verfasser nicht habe wissen können. Ungeheuer war die Wirkung des Buches, das gegenwärtig zu den größten bibliographischen Seltenheiten gehört und nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden sein dürfte. Graf Hoym und der Kanzler v. Goldbeck, gegen welche diese furchtbare Anklage geschleudert war, erlagen fast unter dem Gewicht der öffentlichen Meinung. Gegen Held wurde eine strenge Untersuchung eingeleitet; zu seiner Vertheidigung fügte er den früheren Angaben unter dem Namen „schwarzes Register“ eine umständliche Aufzählung der in Südpreußen von 1795-1798 verschenkten Güter hinzu, ihres vorgespiegelten und ihres wahren Werthes, der Empfänger und etwaiger späterer Besitzer. Diese Liste enthält zweihundertundvierzig Güter, die zu vierthalb Millionen Thaler geschätzt, aber zwanzig Millionen werth und an etwa zweiundünfzig Personen verschenkt waren.
So hatte z. B. der berüchtigte Triebenfeld dafür, daß er die Schenkungen anordnete und ausführen half, selbst acht Güter geschenkt bekommen, welche im Werth von 51,000 Thalern angegeben, bald nachher auf 700,000 abgeschätzt und am 9. März 1801 für 750,000 verkauft wurden. Trotzdem daß Held die Wahrheit der von ihm angegebenen Thatsachen bewies und in jedem Punkte den beiden Ministern gegenüber sein Recht behauptete, wurde er von der Criminaldeputation des Kammergerichts mit Amtentsetzung und achtzehnmonatlicher Festungshaft bestraft und dieses Urtheil in zweiter Instanz mit der Mehrheit einer Stimme bestätigt. Zwar erstattete der Justizminister v. Arnim dem Könige Bericht und sprach darin sehr günstig für Held, aber der König ließ der Gerechtigkeit, die hier das größte Unrecht war, ihren ungehemmten Lauf. Schwer mußte der Freund der Wahrheit für sein edles Streben büßen und, da er keine Anstellung in Preußen fand, mit Noth und Sorgen kämpfen. Dennoch liebte er sein Vaterland treu und fest, treuer als seine mächtigen Gegner. Im Unglück und tiefsten Falle Preußens bewährte Held seinen Patriotismus, indem er mit Wort und Schrift unter den größten Gefahren für sein eigenes Leben und seine Freiheit gegen die Franzosenherrschaft und den Despotismus Napoleon’s rücksichtslos in Wort und Schrift ankämpfte, indem er mit wunderbarem Scharfblick das nahe Ende des allmächtigen Usurpators voraussagte. Erst nach dem Freiheitskriege erhielt Held von dem Minister Hardenberg eine neue Anstellung beim Salzwesen, während sein Freund Zerboni zum Oberpräsidenten der Provinz Posen ernannt und somit der ehemalige Demagoge für dieselben Ideen belohnt wurde, für die er einst so schwere Strafen und Verfolgungen erlitten. Beide erlebten den Sieg der guten Sache, für die sie gekämpft und die schwersten Opfer gebracht. Beide sind darum noch heute bemerkenswerth als leuchtende Beispiele des preußischen Beamtenstandes, der einst berühmt war wegen seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, wegen seiner Vaterlandsliebe und Ueberzeugungstreue und dies hoffentlich noch recht lange bleiben wird.
Sylvestergeschenk an einen Dichter. Es war in der letzten Stunde des abgelaufenen Jahres, als in Bonn eine Anzahl von Studirenden der Philologie um ihren Meister, Otto Jahn, in trautem Kreise beisammen saß. Die Stimmung von Lehrer und Schülern war eine ernst gehobene, wie dies die Momente solcher Zeitabschnitte mit sich zu bringen pflegen, wo man rückblickend abschließt mit der ihrem Ende nahenden Periode und bangfragend vorwärtsschaut in die sich eröffnende neue, und was jetzt überall, wo deutsche Herzen schlagen, in erster Stelle die Gemüther beschäftigt, neue Hoffnung weckt, aber auch neue Sorge und neue Angst, – das erfüllte natürlich auch die Seelen unserer kleinen Sylvestergesellschaft und um so lebhafter, als der verehrte Lehrer selbst zu den Söhnen des „verlassenen Bruderstammes“ gehört. Die Becher kreisten fleißig, und als das Jahr schied, da stimmten Alle in feierlicher Begeisterung das viel gesungene, aber immer von Neuem seine zündende Wirkung bethätigende Schleswig-Holsteinlied an, und noch unter dem Eindrucke seiner markigen Strophen reifte der Entschluß, dem Dichter des Liedes ein kleines Zeichen
[80] des Dankes und der Anerkennung zu senden. An den Ufern des Rheines war die Wahl der Ehrengabe nicht schwer: schon am 2. Januar ging ein Fäßlein edelsten Rebengewächses zu einem Labetrunke an den Dichter nach Würzburg ab, zugleich mit einem von sämmtlichen Teilhabern, Lehrer und Schülern, unterzeichneten Widmungsschreiben, dessen warme Worte Zeugniß ablegen von der Quelle, der sie entflossen sind: dem treuen, deutschen Herzen.
Dritte Todtenliste von im gegenwärtigen amerikanischen Kriege gefallenen Deutschen, deren Erben Näheres auf dem Generalconsulat der Vereinigten Staaten zu Frankfurt a. M. durch dessen Secretair August Glaeser erfahren können. Das Generalconsulat fühlt sich bei dieser Gelegenheit verpflichtet, zu bemerken, daß nach wie vor diese Listen ausschließlich der „Gartenlaube“ zur Veröffentlichung zugesandt werden, daß mithin alle anderen dieselben enthaltenden Blätter sie nur aus der „Gartenlaube“ abgedruckt haben können.
Christoph Ammelmeier, Johann Braun, Breitenbach, Hornist Breitenitz, Corporal Bohne, Bernhardt, Borkhardt, Jacob Brunner, Johann Beck, Jean Becker, Christ, Corporal Cramer, Jacob Cordet, Albert Clines, Dantemann, H. Diehl II., Karl Dingen, Inv. E. Diehring, J. G. Danglen, Ed. D. Erwig, Ehler, Jesse Epinger, Friedemann, Franke, Sergeant Faust, Joseph Frith, F. Frederick, Lieutenant Firmbach, Grote, Grebb, E. Gundelach, Corporal Greß, Hermann Hartmann, Rudolph Heck, Henkel, Hutt, Heinecke, Hellen, Harning, Hunter, J. C. B. Honte, C. Krumb, Köhler, Krattwitz, Kempf, Kaufmann, Sergeant Kühne, Georg Kreß, Martin Lang, Sergeant Lüchinger, Sergeant Lange, Lambert, Lohmer, August Leg, Latzen, Lieutenant Lenders, S. Leonhard, Xaver Marder, Georg Moses, Most, Albert Mehl, James Metz, Oscar Nister, Corporal Ney, Nickel, G. Neumann, Oelkins, Ohms, Ortmann, Pault, Pfeffer, Pflugfelder, Eduard Patz, Ephraim Rochert, Rothkopf, Peter Roth, Johann Roeder, Rötsch, Rauscher, H. Rissick, Jacob Rees, Fred. Rall, Joh. Sauter, Richard Schweikert, Strauß, Schellhaas I., Schulz, Corporal Schulz, H. Schwarz, Schirnmann, Lieutenant Spangenberq, Stroh, Anton Spingler, G. Thies, Theiß, Franz Tone, H. Ulleweiler, Joh. Wolff, Waldhauer, Wirbenhorst, Jos. Winter, W. A. Wecker, Peter Ed. Yorks.
Deutschland in Frankreich. Als ein erfreuliches Zeichen, wie in Frankreich das Verständniß und die Würdigung unserer deutschen Literatur von Jahr zu Jahr tiefere Wurzeln fassen, wird unsern Lesern die Mittheilung erscheinen, daß die trefflich geleitete „Revue germanique“, die sich zum Ziele gesteckt hat, unseren überrheinischen Nachbarn die Kenntniß deutschen Wesens und deutschen Geistes zu vermitteln und zu diesem Zwecke vor Allem auf das aufmerksam zu machen, was als wirklich bedeutende literarische Erscheinung anerkannt werden muß, demnächst schon eine Uebertragung der in den letzten Nummern der Gartenlaube zum Abdruck gebrachten ergreifenden Erzählung „Das ewige Licht“ von C. Aug. Heigel, aus sehr competenter Feder veröffentlichen wird.
Wollt in der deutschen Sache ihr deutsch sein an Geist und Gesinnung,
Wohl! – Seid’s an Sprache doch auch! Rein sei und kräftig das Wort.
Fort mit „Situation, Pression, Succession“ und dergleichen!
Ist doch die Lage so klar, Druck auch und Erbfolgerecht.
Nennt nicht, was Recht, legitim, opportun, was entspricht euren Zwecken,
Redet zum Deutschen doch deutsch, fegt diplomatischen Kram!
Herausgegeben von Friedrich Hüttner.
Vierteljährlich nur 10 Ngr.
Bisher ein Blatt für „gemüthliche Leser“ und des gemüthlichen Scherzes, des milden Tadels im humoristischen Gewande hat sich derselbe besonders seit seinem neuen Jahrgange mehr und mehr zu einem entschiedenen Parteiblatte umgewandelt und als solches in den liberalen Kreisen allgemeinen Anklang gefunden. Mit Schärfe und Energie wird er fortfahren seine satirische Geißel zu schwingen gegen Alles, was dem Volke sein Recht, seine Ehre und seine Freiheit verkümmern und schänden will, doch auch in ernsten Mittheilungen das große Publicum in einfacher und Jedermann verständlicher und anziehender Sprache über seine theuersten und wichtigsten Interessen aufzuklären suchen und überabll mit Entschiedenheit auftreten, wo Kampf Pflicht und von Nöthen ist.
Wir können daher aus voller Ueberzeugung Jeden, der unsern Standpunkt theilt, angelegentlich einladen, dem Dorfbarbier sein Haus und sein Herz zu öffnen und treu an dem treuen Freunde des Volkes festzuhalten, der nie fehlen wird, wo es gilt, wohlgerüstet auf dem Kampfplatze zu erscheinen.- ↑ Der nachstehende durch seine Einzelheiten sehr interessante Bericht eines Zeitgenossen über die Hinrichtung der Maria Stuart ist uns aus ganz zuverlässiger Quelle, als aus dem handschriftlichen Nachlasse des ehemaligen kurtrierischen Kanzlers Dr. Wimpheling stammend, mitgetheilt worden. Wir haben uns bisher vergeblich bemüht, in Erfahrung zu bringen, ob das Schriftstück schon früher anderweitig veröffentlicht worden ist, glauben aber mit dem Abdruck desselben in jedem Falle unserm großen Leserkreise eine willkommene Gabe zu bieten. D. Red.
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Vorlage: zum