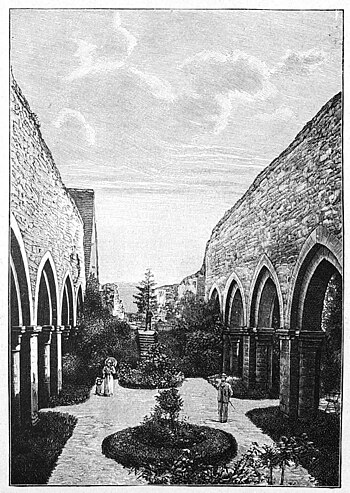Die Gartenlaube (1895)/Heft 51
[857]
| Nr. 51. | 1895. | |
Die Lampe der Psyche.
(11. Fortsetzung.)
Siehst Du, Magda,“ begann Sibylle, „es ist gekommen, wie ich Dir sagte: Flemming hat ihn mir totgeschossen.“
Ihre Augen waren wie erloschen und ihre Stimme ganz klanglos.
„Wallwitz lebt doch noch und er wird leben!“ rief Magda und faltete die Hände.
Sibylle sah vor sich hin.
„Wir sind alle schrecklich unglücklich,“ sagte sie, mit dem Kopf nickend, „ja, schrecklich unglücklich. Aber er muß noch unglücklicher sein! O, wie es wohl in ihm aussieht! Weiß Gott, ich beneide ihn nicht um das Gefühl! Den Mann erschossen zu haben, der ihn so liebte und verehrte!“
Magda war sehr blaß. Sie wollte Sibylle nicht mit der Verteidigung kränken, die sie für die That bereit hatte. Und dann: es war so, wie Sibylle sagte! Wie mußte es in ihm aussehen! Es ergriff sie aufs tiefste, daß Sibylle so ohne Zorn, voll innigstem Mitleid seiner, als des Elendesten von ihnen, gedachte.
„Und alles dies wegen Lilly!“ sprach sie bitter.
Das Wort belebte Sibylle. Ihre Augen blitzten. Sie stand in alter Beweglichkeit vor Magda.
„Denke Dir,“ erzählte sie, „sie war es, die mir das Märchen von der geladenen Pistole erzählte, an das auch Großmama glaubt. Doktor Friedrichs hat es gesagt, als er ihn brachte, und Keller hat es bestätigt. Lilly allein konnte sich die Wahrheit denken. Als sie nach mir schickten – er hatte meinen Namen geflüstert … denk’ Dir, Magda, in seinem ersten bewußten Augenblick …“
Sie weinte an Magdas Schulter.
„Du wolltest von Lilly sprechen,“ mahnte sie nach einer Pause. Sibylle richtete sich wieder auf.
„Lilly kam mir entgegen und erzählte es mir. Ich weinte gar nicht. Ich war wie von Stein. Ich sah immer bloß Lilly an, und als sie mit ihrer Lüge fertig war, sagte ich bloß: Du bist eine Mörderin! Und da zuckte sie die Achseln – so – – und machte so ein Gesicht – – und sagte, ich sei wohl überspannt.“ Aber sie war doch ganz blaß geworden. Und dann sagt’ ich ihr, wenn sie einen Fuß in sein Zimmer setze und sich ihm zeige – denn das muß ihn doch gräßlich aufregen! – wolle ich Großmama alles wiedersagen, was ich weiß. Sie traut sich auch nicht, sie traut sich nicht. Und Großmama sagt ‚wie lieblos!‘ Das schadet nichts, mag Großmama das denken, das geschieht Lilly recht.“
Es wurde dämmerig. Magda saß am Fenster und sah auf die grauen Hintergebäude, die hier reizlos den Blick verschrankten.
Ein ungeheurer Druck lag auf ihrer Seele, die furchtbare Ungewißheit sollte noch weiter getragen werden. Tagelang, wochenlang vielleicht konnten sie noch zittern für dies Leben, das, wenn es erlosch, zugleich Licht und Freude aus
[858] Renés Dasein hinweglöschte. – Sibylle ging im dunklen Raum auf und ab. Es lag etwas Feierliches in ihren Schritten.
„Ich habe einen Entschluß gefaßt, Magda,“ sagte sie; „wenn Walfried sterben muß, laß ich mich vorher mit ihm trauen, dann will ich ihn als seine Witwe ewig betrauern. Denn ich werde mich niemals trösten und nie einen andern lieben. Mein Leben sei seinem Andenken geweiht. O Gott und ich bin erst achtzehn Jahr!“
Dies Gemisch von echtem Gefühl und einer unbewußten Selbstgefälligkeit, die sich vom eigenen harten Schicksal rühren läßt, zeigte Magda, wie anders ihre eigenen Schmerzen geartet waren als die Sibyllens. Aber sie wurde dadurch nicht in ihrem liebevollen Mitleid beeinflußt. Sie sah es als ihre Aufgabe an, Sibyllen beizustehen, um wenigstens an ihrem Teil zu heilen, wo René Wunden geschlagen.
„Von dieser Idee wirst Du zurückkommen,“ sagte sie herzlich, „es würde eine Handlung sein, die Dich und ihn marterte. Und wenn er sterben sollte – ist das innere Band nicht ebenso unzerreißbar?“
Aber Sybille war gesonnen, den ganzen Kelch auszutrinken und in ihrem Unglück romantisch zu schwelgen. Weinend sprach sie:
„Die Welt wußte ja noch nicht, daß ich seine Braut war. Sie soll erfahren und sehen, wie ich ihn geliebt habe. Und Tante Sibylle, die morgen kommt und unsern Bund zustande bringen wollte, wird mir beistehen! Sie ist wegen einer unglücklichen Liebe ledig geblieben. Sie wird mit mir fühlen.“
„Deiner Eltern wegen – sei ein wenig vernünftig,“ bat Magda.
Sibylle weinte stärker. Auch das Unglück ihrer Eltern, die die einzige, hoffnungsvolle Tochter lebenslänglich elend sehen sollten, ergriff sie schwer.
„Wie kann man vernünftig sein, wenn man das Liebste, was man auf der Welt hat, sterben sicht. Ja, Du kannst es nicht begreifen, Du weißt nicht, was Liebe und was Unglück ist.“
Magda schwieg. Sie dachte gequält, daß kein Herz für die Leidfähigkeit eines anderen Herzens einen Maßstab hat. Und daß vielleicht der Gram Sibyllens nicht an die Not ihrer eigenen Seele heranreichte.
Wer hatte mehr Gründe zu weinen, wenn der Verwundete starb: Sibylle, die den Geliebten verlor, oder sie selbst, die fortan das Dasein des Ueberlebenden vergiftet wußte?
Ach, wie oft würde Sibylle sie noch mit ihren thörichten Reden verwunden! Aber sie nahm sich vor, mit dem lieben Kinde, seiner Unreife und seinem reinen treuen Herzen eine unermüdliche Geduld zu haben.
Ihr war es, als erfülle sie damit geradezu eine Pflicht gegen René. Sie würde sich mit Freuden hingeopfert haben, um nur etwas für ihn in seinem Sinn zu thun.
Mit der großen Stunde verrauscht auch die große Stimmung. Schon am andern Morgen kam es Magda vor, als sei der Zustand der Todesangst in den vorhergegangenen Stunden leicht zu ertragen gewesen. Er fand doch seinen erlösenden Gipfelpunkt in dem Wiedersehen mit René. Nun lag aber die nächste Zeit vor ihr wie eine graue Oede. Sie konnte nichts thun als warten und sich fürchten.
In der „Leopoldsburger Zeitung“ las sie zwei Notizen im lokalen Teil. Beide waren in ihren Augen Lügen.
Da stand zunächst zu lesen, daß der Premierlieutenant von Wallwitz das Unglück gehabt habe, sich beim Reinigen einer Pistole, die er ungeladen glaubte, schwer zu verwunden, so schwer, daß man an seinem Wiederaufkommen fast verzweifle. Es war noch hinzugefügt, wie beliebt der tüchtige Offizier bei seiner Mannschaft sei, und daß Herr von Wallwitz dem Vernehmen nach gerade im Begriff gewesen, seine Verlobung mit einer der reizendsten jungen Damen der hiesigen Gesellschaft zu vollziehen, daß das Unglück also doppelt beklagenswert sei, da es einen Mann getroffen, der sich in den glücklichsten Lebensumständen befinde.
Die Notiz war taktlos – so konnte es scheinen. Magda fühlte heraus, daß ihre Ausführlichkeit von den Einsendern beabsichtigt war. Man gab soviel Details, um keinerlei Gerüchte aufkommen zu lassen.
Die andere Notiz betraf René. Er habe, so hieß es, zur Vollendung seines Musikdramas einen unbestimmten Urlaub genommen.
„Er ist fort,“ dachte Magda, „geflohen! Oder er wartet in einer Nachbarstadt ab, ob hier Gerüchte entstehen. Wie könnte er arbeiten! Jetzt mit dem Gefühl im Herzen!“
Schließlich war es der beste Vorwand, den er für eine Abwesenheit oder Zurückgezogenheit wählen konnte!
Sie erwartete, er werde ihr irgend ein Zeichen geben, sich ihr brieflich doch noch aussprechen, irgend ein Gefühl der Sehnsucht nach ihr äußern.
Von Hortense, die jeden Tag viele Menschen sah, hörte sie bald, daß keine Seele auf die Idee käme, Wallwitzens Verwundung könne einen geheimnisvollen Hintergrund haben oder gar mit René Flemming in Zusammenhang stehen. Ganz Leopoldsburg beschäftigte sich so sehr mit den Gerüchten über Magda und Flemming, daß es Flemmings vorübergehendes Interesse für Lilly Wallwitz ganz vergessen hatte. Auch hatte das Fräulein von Deggenburg am Duellmorgen doch erkannt, daß es Magda gewesen war, die mit Hortense zu Flemming gegangen, und vermittelst ihres Opernglases hatte sie beide Damen einen Augenblick an Flemmings Fenster gesehen.
Hortense hatte sich das mit einem besonderen Ausdruck im Gesicht angehört und nur trocken gesagt: „So – wirklich?“ aus welcher Antwort die Fragenden und Berichtenden keinen Schluß ziehen konnten.
„Laß sie nur meinen Namen zerfetzen,“ sprach Magda mit schmerzlichem Lächeln, „wenn diese Redereien ihn schützen. Was liegt an mir!“
„Ich habe schon für die beste Verteidigung gesorgt,“ tröstete Hortense, „morgen kommt die Herzogin und besucht Deinen Vater.“
Und die hohe Dame kam auch und versicherte Magda und der diensthabenden Hofdame, die sie begleitete, daß ihr die „arme liebe Excellenz, als sie noch der Minister für den Unterricht, die Künste und die geistlichen Angelegenheiten des Landes waren, ein sehr treuer, lieber, unschätzbarer Mitarbeiter gewesen“.
Sie war sehr leutselig und äußerte sich, daß Magda elend aussehe und der Anregung bedürfe. Sie habe Magda eigentlich bitten wollen, ihr ein Pendant zu dem so wundervollen Christrosenstück zu malen, aber diese Bitte verschöbe sie bis zum Frühling. Hingegen lud sie Magda zum nächsten Theeabend in das Schloß und erlaubte ihr, für die bevorstehende Lotterie zum Besten einer Missionsausrüstung zwei schöne Wandteller mit Blumenmalerei zu stiften, die noch im Atelier vom Sommer her hingen, und von welchen die hohe Frau, als sie sich im Atelier umsah, bemerkte, daß sie als Lotteriegewinne sich vortrefflich eignen würden.
Magda küßte ihr dankbar und gerührt die Hand. Die Herzogin hatte sie so eigen angesehen, mit einem so menschlichen, warmen Blick, der aus einer anderen Seele zu kommen schien als all’ die langsam vorgebrachten leutseligen Tiraden.
Nachher weinte sie einige erlösende Thränen und dachte viel über das Schicksal der Herzogin nach. Das hohe Paar war gewiß nicht glücklich. Vielleicht weil es keine Kinder hatte, vielleicht weil es nicht zusammenpaßte. So waren sie auseinandergewachsen, die Herzogin hatte ihr warmes, schüchternes Fühlen verstecken gelernt, des Herzogs feurige Seele entfloh ihr.
„Vielleicht hat sie ihn nicht verstanden,“ dachte Magda. „Ob es wohl möglich ist, einen Mann ganz zu verstehen?“
Und damit war sie wieder bei René und den Rätseln angelangt, die er ihr aufgab.
Er schrieb nicht und kam nicht. War er so tief gebeugt, so ganz haltlos, daß er sich nicht vor ihr zu zeigen wagte?
Der Erfolg des hohen Besuches, den Magda erhalten, kam augenblicklich.
Johanne von dem Busche und die anderen beiden Damen meldeten sich zur Malstunde zurück, mit ihnen baten noch drei neue Schülerinnen um Aufnahme.
„Nein,“ sagte Magda, „ich kann nicht arbeiten, ich bin nicht wohl,“ und lehnte es ab.
Sie war außerstande, an Thätigkeit mit andern nur zu denken. Sogar die Pflichten ihres Hausstandes waren ihr lästig. Sie mochte am liebsten sitzen und grübeln und sinnen, wie es ihm wohl ergehe, was er thue, wie er seine Tage verbringe.
Wahrscheinlich auch in thatenlosem, qualvollem Bangen und Hoffen. Wahrscheinlich gehetzt von der fürchterlichen Angst, daß das Menschenleben, das durch ihn in Gefahr schwebte, doch noch verloren gehen werde.
Welche Veränderungen mußten mit ihm vorgegangen sein, er, der lebhafte, ungebundene Geist, geknechtet und gefesselt von dem Bewußtsein solcher That! Wie mußte er leiden!
Vielleicht ward seine Schaffenskraft im Keim gebrochen.
[859] Magda dachte an sein Werk und an die heißen Freuden, die er an demselben gehabt, an die stolzen Hoffnungen, die er auf dasselbe gesetzt. Alles dahin und verloren –
Die Hauptstunde des Tages war die, wo sie mit Sibylle zusammentraf und hörte, wie es Wallwitz gehe. Jede Einzelheit dieses Krankenlagers ward ihr bekannt. Sie lebte im Geist mit in dieser Krankenstube, über deren Schwelle einzutreten die Hoffnung immer noch zögerte.
Frau von Lenzow freute sich, daß Magda seiner Zeit den kühlen Ton in jenem Absagebriefchen offenbar gar nicht bemerkt hatte. Die Gunst der Herzogin, in diesem Augenblick so deutlich betont, wollte doch sagen, daß niemand an Magda Ruhlands Reinheit zu zweifeln habe. Wie peinlich, wenn man nun schon mit Magda gebrochen gehabt hätte! Sibylle bekam manches Lob zu hören, über ihre Anhänglichkeit an Magda. Auch war Frau von Lenzow, von einem echten Bedauern über ihre einmal geäußerte abfällige Meinung ergriffen, von Herzen liebevoll zu Magda und bat sie, ihren guten Einfluß auf Sibylle geltend zu machen. Denn Sibylle beharrte bei ihrem Vorsatz, sich mit Walfried an dessen Krankenbette trauen zu lassen. Ueber das Verlöbnis wurde jetzt offen gesprochen, man hatte es für klüger gefunden.
Die Notiz aus der „Leopoldsburger Zeitung“, worin Sibylle als „eine der reizendsten jungen Damen der hiesigen Gesellschaft“ bezeichnet worden war, hob sie wie ein Heiligtum auf. In all’ ihrem Gram hatte diese Bezeichnung ihr doch unendlich wohlgethan und sie gab das Blatt auch Lilly zu lesen, obschon sie sonst ja kein unnötiges Wort mit ihr sprach.
Sie fühlte sich in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt und glaubte sich darum auch verpflichtet, etwas ganz Außerordentliches zu thun.
Ihre Tante und Taufpatin, Baronesse Sibylle Zielendorf, eine ältere Cousine ihres Vaters, die inzwischen angekommen war, fand die Idee poetisch und rührend. Sie bestärkte Sibylle in allen Ueberschwenglichkeiten, und wenn bei dem jungen Mädchen der natürliche Jugendmut einmal durchbrach, war es die sentimentale Baronesse, die immer neu den Jammer und die hohen Opfergefühle in ihr weckte. So kam die kleine Sibylle aus den Aufregungen gar nicht heraus, und es war doch schon genug an der einen, an der steten Sorge um das teuere, gefährdete Leben.
„Was wird das auf René für einen Eindruck machen,“ dachte Magda geängstigt, „wenn er hört, daß Sibylle sich so an einen Sterbenden bindet!“ –
„Weißt Du, daß René Flemming hier ist und ruhig in seiner Wohnung sitzt? Warum sollte er auch abgereist sein? Keiner weiß was,“ sagte Sibylle ihr eines Tages.
Magda verfärbte sich. Er war hier? Ihr so nahe? Und schwieg?
Sie hatte sich gedacht, er wolle vielleicht vor jedermann, auch vor ihr, seinen Aufenthalt verbergen.
„Woher weißt Du das?“ fragte sie.
„Von Lieutenant Bohrmann. Der kommt jeden Tag, nach Walfried fragen. Mich plagte die Neugier, ich wollte doch ’mal so hinhören – ich glaub’ auch, Bohrmann ist dabei gewesen. Er kommt so oft, am meisten, und war vorher gar nicht so intim mit Walfried. Das ist verdächtig. Na, und da fragte ich denn ganz unbefangen, weshalb Flemming sich gar nicht um Walfried bekümmere, er habe doch immer so befreundet gethan.“
„Und Bohrmann sagte .. ?“
„Daß Flemming so sehr beschäftigt sei und übrigens innigsten Anteil nehme und täglich durch ihn von Walfried höre. Ich sagte noch, ich meine, in der Zeitung ’was von Urlaub gelesen zu haben. Und Bohrmann antwortete: ganz richtig, den verlebt er hier.“
Er war hier! Und kam nicht, sein Herz an dem ihren zu entlasten!
Ihr schien das ein voller Beweis, daß René sie dennoch nicht wahrhaft liebe. Er täuschte sich vielleicht über sich selbst, es gab in ihm Aufwallungen, die ihn zu ihr zogen. Oder er hatte zuviel Mitleid mit ihr, um ihr die Wahrheit einzugestehen. Er zeigte sie ihr so schweigend, um sie zu nötigen, ihrerseits ein Band zu lösen, das doch nie zum Glück führen könne.
Dann fiel ihr wieder ein, daß sie ja ihm habe entsagen wollen und daß er die Entsagung nicht angenommen habe.
Sie las auch seinen letzten Brief wieder und wieder und eine Stimme sagte ihr, daß er nicht der Mann sei, etwas zu schreiben, das nicht eine innere Gewißheit ihm diktiert habe.
„Es ist furchtbar,“ dachte sie, „jeden Augenblick fühle ich mich zu einer anderen Erregung hingerissen. Besser ein Ende als dies ewige Ringen nach Glauben und Zuversicht!“
Was sie am allermeisten an Renés Schweigen verletzte und wunderte, war dies: „Versteht er denn gar nicht, daß es mich trösten und beruhigen würde, um ihn sein zu dürfen? Hat er so wenig Gefühl und Sinn für das, was meinem Herzen wohlthäte, so muß ich mir doch sagen: es fehlt ihm an Verständnis für mich.“
Nicht verstanden werden, heißt, nicht geliebt zu werden, sagte sie sich. Sie wollte gekannt sein bis in die tiefsten Falten ihres Wesens von dem Manne ihrer Liebe. Nur so konnte ein wahrhaft inniges Zusammenleben erreicht werden.
Sie vergaß ganz, daß er sie gebeten hatte, ein starkes Weib zu sein, und daß es oft schwerer ist, stark zu sein, wo es gilt, einen Lebenden zu schonen und zu verstehen, als einen Toten zu beweinen.
| * | * | |||
| * |
Bei ihrem lebhaften Verkehr mit Sibylle fiel es ihr gar nicht ein, daß sie sich einer Begegnung mit dem Wesen aussetze, dessen Anblick sie am wenigsten jetzt ertragen konnte. Sie dachte gar nicht daran, daß sie eines Tages Lilly von Wallwitz sehen und sprechen müsse. Sie glaubte, Lilly würde sich mit schlechtem Gewissen still und ängstlich zu Hause halten, und da Magda das Wallwitzsche Haus nicht betrat, so könnten sie sich nicht treffen. Aber Lilly, von jeder Gesellschaft, ja vom Theater ferngehalten, verging vor Langerweile und unternahm jeden Mittag einen Spaziergang über die halbe Ringstraße, den Kasernenweg und den Schloßplatz. Den konnte ihr niemand verdenken, er war für ihre Gesundheit durchaus nötig. Bei dieser Gelegenheit traf sie dann sehr viel Bekannte, plauderte hier und da und ließ sich ein Streckchen von teilnehmenden Kameraden Walfrieds begleiten. Es war die einzige Zerstreuung, die der endloslange Tag ihr brachte.
Eines Mittags ging Magda auf dem Schloßplatz hin und her. Das Wallwitzsche Haus lag an demselben, der Rückwand des Schlosses gegenüber. Magda wollte Sibylle erwarten, die um Eins zu kommen versprochen hatte, um mit der Freundin zusammen nach Hause zu gehen.
Ein blauer Himmel strahlte auf eine keusche Schneelandschaft hernieder. Der Fluß, nicht gefroren, wirbelte schwarz und blank unter der gewaltigen Brücke dahin, auf welcher die nackten mythologischen Gestalten mit Schneemützen auf den grauen Sandsteinlocken standen. Die Dächer trugen dicke weiße Schneelager auf sich, die feinen Aeste der Bäume waren von Rauhreif umkleidet, auf dem Rasen der Anlagen breitete sich eine hohe, lockere, weiße Decke. Dazwischen liefen aufgeworfene Wälle, die ausgeschaufelte Wege einfaßten; die Menschen, die da spazieren gingen, waren von weitem nur bis zu den Knieen sichtbar. Und alle Geräusche des Verkehrs, das Rollen der Räder, der Tritt der Pferdehufe, die Schritte der wandernden Menschen, erklangen gedämpft. Die winterliche Welt, die vordem etwas Kahles und Unausgefülltes gehabt hatte, schien mit einem Mal enger, stiller und traulicher geworden. Alle Leute machten vergnügte Gesichter, die kräftige Kälte hatte so etwas Gesundes, der frische Schnee so etwas heiter Anmutendes. Jedermann feierte bei seinem Anblick Kindheitserinnerungen und alte Leute standen und sahen mit lächelndem Neid den Knaben zu, die, auf kleinen Schlitten stehend, ihr Gefährt mit eisenbeschlagenen Stöcken vorwärtsstießen.
„So leuchtende Wintertage haben in ihrer Stimmung etwas von Frühling,“ dachte Magda. „Sie machen Mut. Wie merkwürdig wir von der Natur abhängig sind!“
Ihr war es, als müßte Sibylle heute mit besseren Nachrichten kommen.
Und da lief diese auch schon herbei, das Pelzbarett ein wenig schief auf dem dunklen Haar, mit schlangengleich sich windender Pelzboa um den Hals. Aber ihr Gesicht sah unglücklich drein wie alle Tage.
Sie blieb vor Magda stehen und sagte gleich: „Großmama will es nicht! Ist es nicht schändlich!“
„Was will sie nicht?“
„Ich soll mich nicht mit Walfried trauen lassen,“ erzählte sie und Thränen traten ihr sofort in die Augen. „Großmama findet es zu theatralisch. Ach, sie haben alle kein Gefühl!“
Sie hakte Magda ein und ging langsam mit ihr weiter.
„Und Großmama meint, es hieße Walfried zu verstehen geben, daß er bald sterben müsse.“
„Hat sie damit nicht recht?“ fragte Magda.
[860] „Es wäre so ein großer Liebesbeweis gewesen,“ sagte Sibylle und nahm eines der Enden ihrer Boa gegen Mund und Nase, denn sie fürchtete, laut weinen zu müssen.
„Walfried glaubt gewiß auch so an Deine Liebe,“ tröstete Magda.
„Ja, aber wenn er nun am Leben bleibt und noch ein paar Wochen auf Reisen muß, nach dem Süden, zur Erholung, da kann ich doch als seine Braut nicht mit,“ jammerte Sibylle.
Vor freudigem Schreck blieb Magda stehen. „Ist denn Hoffnung – ist wirklich Hoffnung?“ fragte sie.
„Doktor Friedrichs hat heut’ gesagt, noch drei Tage so weiter und alle Gefahr ist ausgeschlossen. Die Wunde heilt,“ berichtete Sibylle kläglich.
„Und das sagst Du in solchem Tone!“ rief Magda und wäre ihr um den Hals gefallen, wenn man sich nicht in den öffentlichen Anlagen befunden hätte.
„Wenn ich doch nicht mit ihm reisen kann!“ meinte sie in Thränen.
Vor diesem kindischen Egoismus war es Magda schwer, geduldig zu bleiben. Gerade wollte sie etwas herzlich Belehrendes sagen, als ihr das Wort auf den Lippen erstarb und ihr das Blut aus den Wangen wich.
Da kam zierlich, sehr modisch gekleidet und mit der gewollten Nachlässigkeit der Haltung, die sie immer annahm, wenn sie ihr mißliebigen Personen begegnete, Lilly von Wallwitz über die Brücke daher.
„Mein Gott, Lilly! – auf der Straße muß ich nun höflich sein,“ sagte Sibylle geärgert.
Magda ließ den Arm der Freundin fahren und faltete ihre Hände fest in dem Muff zusammen. Das Herz schlug ihr so sehr, daß die pulsenden Adern am Halse das Pelzwerk zittern machten. Und dabei zwang eine merkwürdige Neugier sie, der Ankommenden gerade und starr ins Gesicht zu sehen. Diese war es gewesen, um derentwillen sie so maßlos litt. Diese hatte er geküßt, dieser von Liebe gesprochen, um dieser willen sie zu verlassen, aufzugeben gedacht – –
Es war Magda, als müßte sie der andern ins Gesicht schreien:
„Ich weiß alles! Aber er verachtet Dich! Er hat Dich gar nicht geliebt – gar nicht! Mir gehört sein Herz.“
Lilly gab der Braut ihres Bruders die Fingerspitzen und wollte sie gnädig auch Magda reichen.
Da sah sie den starren, feindlichen Blick und sah, daß Magda ihre Hände mit einer kurzen, unwillkürlichen Bewegung tiefer in dem Muff verbarg.
Sie kniff die Augen halb zu, Kurzsichtigkeit heuchelnd, und sagte:
„Nun, Sibylle, schon wieder mit einer roten Nasenspitze und verweinten Augen? Sie müssen ein Engel sein, Fräulein Ruhland,“ wandte sie sich an Magda, „um jetzt mit unserer lieben Sibylle auszukommen.“
Sie sah dabei dreist in Magdas Augen und dachte: was hat die Ruhland, was sieht sie mich so an, will sie mir nicht die Hand geben, oder ist es Zufall?
Magdas Lippen bewegten sich, sie wollte etwas antworten, irgend etwas Herbes, Verächtliches. Aber es war ihr unmöglich. Ihre Geistesgegenwart war dieser Lage nicht gewachsen. Sie konnte sich nicht beherrschen und nur immer die anstarren, die ihr von allen Menschen dieser Erde die einzig Hassenswerte schien.
„Sollte Sibylle geschwatzt haben?“ dachte Lilly beunruhigt. Sie glaubte, diese Art Mädchen wie Sibylle zu kennen: die haben ein Dutzend allerbeste Freundinnen und vertrauen einer jeden Geheimnisse unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit an!
„Mit mir kann man sehr gut auskommen,“ sagte Sibylle trotzig, „wenn ich auch nur aus Leopoldsburg bin und wenn ich auch nicht in einer Genfer Pension dummes Zeug gelernt habe.“
Lilly zuckte die Achseln. Sie stritt sich nicht, das wäre kindisch gewesen. Aber sie ärgerte sich doch, daß Sibylle in Gegenwart der anderen diesen Ton anschlug.
„Fräulein Ruhland wird einen schönen Begriff von Deiner Erziehung bekommen, wenn sie hört, was für einen Ton Du gegen die Schwester Deines Verlobten annimmst,“ sprach sie.
„Magda weiß genau, daß ich gut erzogen bin,“ sagte sie.
„Wenn ich ihr doch sagen könnte, daß ich alles weiß,“ dachte Magda während dieses Wortgefechtes zwischen den künftigen Schwägerinnen, „wenn ich doch könnte!“
Aber sie begriff, daß sie zu schweigen hatte. René hatte ihr den Namen Lillys nicht genannt, René hatte vor ihr geleugnet, sich duelliert zu haben. Was sie wußte, wußte sie durch ihr ahnungsvolles Herz und die unverkennbaren Thatsachen. Sprechen hätte geheißen, ihn in den Verdacht der Unritterlichkeit bringen. Schweigen hieß, auf die Genugthuung verzichten, die Gehaßte klein und bang zu sehen. Magda wäre kein Weib gewesen, wenn sie nicht danach gelechzt hätte, Lilly, die eine kurze Zeit ihr die Liebe des Einen geraubt, demütigen zu dürfen. Aber sie bezwang die Aufwallung. Sie dachte, um sich vor der Versuchung zu retten: er würde mir nicht verzeihen, wenn ich etwas Kleines thäte.
„Nun, ich will das süße Zusammensein mit Dir und Deiner schweigsamen Freundin nicht mehr stören,“ sagte Lilly spöttisch. „Adieu!“
Sie hielt Sibylle die Hand hin, als habe ein liebevollstes Gespräch sie hier fünf Minuten zusammen festgehalten. Sie that es, um sie dann Magda hinreichen zu können.
Und im voraus schon faßte sie Magda ins Auge mit herausforderndem Blick.
Aber Magda wich zurück, ihre Hände sanken ihr am Leibe nieder.
„Nein,“ sagte sie klanglos, „nein!“
Dann bückte sie sich hastig und verlegen und hob den Muff auf, der ihr entfallen war. Sie ging mit schnellsten Schritten davon, ehe noch die erstaunte Sibylle eine Frage thun konnte.
Mochte diese Lilly denken, was sie wollte, mochte sie in ihr eine Wissende erraten, es war Magda alles einerlei. Nicht um die Welt hätte sie diese Hand berühren mögen, die sich einmal nach ihrem heiligsten Eigentum ausgestreckt.
Die nächsten Stunden fanden sie völlig fassungslos. Nachträgliche Eifersucht brannte ihr schmerzhaft in der Brust. Sie stellte sich immer vor, wie sein Arm sich um jene Schultern gelegt, seine Hand jenes kastanienfarbene Haar gestreichelt habe.
Es war unerträglich. „Nein,“ sagte sie sich, „ich kann es doch nicht vergessen und vergeben! Es war doch mehr als ein Spiel, es war so folgenschwer, daß sein Leben dadurch einen Riß bekam. Seine Fröhlichkeit ist gebrochen, sein Werk verloren. Und alles um diese! Nur so lange will ich in meinen Gedanken bei ihm sein und mit ihm sein, bis sich das Eine entschieden hat – bis wir wissen, ob Wallwitz leben kann.“
Drei Tage noch der Ungewißheit! Dem bangenden Warten war eine Grenze gesteckt. Aber wie die letzten Wegesstrecken immer die mühseligsten sind, so wurden auch diese drei Tage zu endlosen Zeitspannen.
Wenn auf der Treppe ein Schritt erklang, bebte Magda. Es konnte ein Bote von Sibylle sein, der Walfrieds Tod anzeigte. Wenn sie Sibylle traf, zitterten ihr die Kniee und ihr Herz schlug, bis das erste Wort über sein Befinden gesagt war. Nachts lag sie schlaflos und dachte, ob wohl der Verwundete schlafe.
Keine Seele, vielleicht nicht einmal die Sibyllens, konnte so für dies gefährdete Leben zittern wie die ihre. Kein heißeres Flehen um seine Erhaltung ward gen Himmel gesandt.
Ob René wohl wußte, daß die Entscheidung nahe bevorstand, ob er wohl, gleich ihr, die Tage in fiebrischer Spannung thatenlos verbrachte?
Sie dachte sich ganz hinein in seinen Gemütszustand und glaubte, alles zu verstehen und zu wissen, was in seinem Innern vorgehe.
Auch hatte sie sich allmählich, sich zum Trost und zur Erklärung seines völligen Schweigens, seine Zurückhaltung so ausgelegt: er gestand sich nicht das Recht auf Glück zu, so lange Walfrieds Leben in Gefahr schwebte.
„Wenn ich es doch sein dürfte, die ihm sagte, Walfried ist gerettet! Wie er aufatmen würde, welch eine Erlösung das sein würde –“
Daß sie diesen Augenblick, wenn er kam, nicht mit ihm erleben sollte, ward ihr eine bittere Entsagung.
Diese Minuten noch mit ihm durchkosten, dachte sie, und dann scheiden!
Daß man von einem Manne nicht mehr freiwillig scheiden kann, der einen mit solcher Ausschließlichkeit beschäftigt, dachte sie nicht, das ward ihr nicht klar.
Wie das Licht und die Luft um sie Bedingungen ihres Lebens waren, deren Unerläßlichkeit sie sich nicht bei jedem Blick und nicht bei jedem Atemzug bewußt ward, ebenso wenig ward sie sich bewußt, daß der Untergrund und die Begleitung ihrer wechselnden Tagesgedanken der eine, ewige Gedanke an ihn war.
Den ersten Tag, nachdem das verheißungsvolle Wort von der möglichen Genesung gefallen war, lauteten die Nachrichten
[861][862] sehr günstig. Die folgende Nacht war unruhig gewesen, doch hatten sich keine Zeichen gefährlicher Zustände eingestellt.
Am dritten Tage fand Magda nicht den Mut, auszugehen. Sie saß daheim, zählte die Stunden, verging vor Aufregung und erwartete vergebens Sibylle.
Der Abend kam, keine Nachricht. Draußen wirbelte Schnee auf scharfen Windstößen wagerecht durch die Luft. Magda mochte nicht die alte Kathi ausschicken. Sie saß im dunklen Zimmer, sah an den Scheiben draußen den Schnee kleben und horchte auf den Wind. Die heulenden Töne machten ihr Furcht, sie klangen ihr wie Totenklage.
Kaum wagte sie, zu Bett zu gehen. Sie fing an, sich allerlei abergläubische Zeichen auszudenken: wenn der Sturm aufhöre, würde Walfried leben. Oder: wenn heute abend noch jemand käme, würde er sterben. Aber als spät noch die Frau Sekretär Böhmer herumkam, um sich von Kathi für morgen Wäscheklammern auszuborgen, sagte sich Magda: „wie kann ich nur so dummes Zeug denken!“ und als in der Nacht der Sturm nicht aufhörte, dachte sie: „wie unsinnig von mir!“
Dennoch erschrak sie am andern Morgen, als sie sah, daß ihre Uhr stand. Sie war auf halb Drei stehen geblieben. Das war ein Zeichen! Magda glaubte sich auch zu erinnern, daß ihr um halb Drei so sonderbar, so ganz schrecklich bang ums Herz gewesen.
„Ich habe einfach vergessen, die Uhr aufzuziehen,“ sagte ihr Verstand.
Aber sie ließ sie nun unaufgezogen liegen. Sie kleidete sich schnell an und erwog, ob sie nicht doch zu Sibylle gehen solle.
„Wenn sie mir dann begegnet – wenn ich das Schreckliche auf der Straße hören müßte – oder vor Zeugen – –“
Sie setzte sich ganz fassungslos in ihren Stuhl am Fenster.
O, wenn René annähernd so zu Mut war wie ihr – und mußte er nicht noch ärger leiden? – da brach diese Zeit gewiß auf immer seine Spannkraft!
Draußen klingelte es mit großer Heftigkeit. So ungestüm und andauernd drückte nur Sibylle auf den Knopf.
Magda erhob sich. Es rauschte in ihrem Kopf. So etwas wie die Vorstellung durchzuckte sie: wäre er tot, käme sie nicht. Dann gewann die Angst wieder Oberhand.
Richtig, es war Sibylle. Sie stürzte herein und Magda um den Hals. Sie drehte Magda mit sich herum und schrie in einem fort: „Er ist außer Gefahr – er ist außer Gefahr!“ Magda war ganz weiß im Gesicht. Ohne daß sie es fühlte, liefen ihr Thränen über die Wangen. Sie faltete die Hände.
„Gott sei Dank, tausendmal Dank!“ flüsterte sie leise.
Und dann lebhafter: Weiß er es schon?“
„Natürlich, der Doktor sagte es gestern abend zu ihm. Ich war dabei. Wie Walfried mich ansah – o, es war zu schön! So zärtlich! Ich glaube, er hat mich rasend lieb.“
„Nein, ich meine, ob – ob René es weiß,“ fragte Magda.
„Der wird es schon erfahren,“ meinte Sibylle, welcher dies ziemlich gleichgültig war. „Er kann sich gratulieren. Er hätte ja sein Leben lang wie so ein Kain ’rumlaufen müssen.“
„Sibylle!“ rief Magda schmerzlich. „Er muß doch furchtbar gelitten haben.“
„Das war seine gelindeste Strafe. Aber lassen wir doch den abscheulichen alten Flemming! Ich verzeih’ ihm und er geht mich nichts mehr an. Aber weißt Du was, Magda? Ach, ich muß Dir furchtbar viel erzählen – gestern war’n Krach bei uns – sonst wäre ich gleich noch gestern abend gekommen, denn Du mit Deiner rührenden Teilnahme warst doch die Nächste dazu. Aber süße, beste Magda, der Lohn bleibt nie aus – ich hab’ ’was Himmlisches für Dich in petto.“
„Ein Krach, bei Euch?“ fragte Magda, sich zur Teilnahme zwingend. Ihre heißen, glücklichen Gedanken waren bei ihm, bei ihm!
„Ja, denk’ Dir, Tante Zielendorf war so beleidigt, daß Großmama Wallwitz und Papa und Mama die Idee mit der Trauung am Krankenbett theatralisch genannt hatten. ‚Ich gebe das Geld zu dieser Heirat‘, sagte sie, ‚und da habe doch wohl auch ich ein Hauptwort dazu zu sprechen.‘ Nicht wahr, da hat sie ganz recht? Tante Sibylle ist überhaupt ein Engel. Und denk’ Dir, sie kennt ja Walfried bloß nach der Photographie, und in die hat sie sich total verliebt, er soll Tantens verflossenem Bräutigam ähnlich sehen. Papa und Mama finden es nicht. Das nahm Tante auch übel. Na, und weil ich nun immerzu heulte, daß ich nicht mit Walfried reisen kann – er soll für acht Wochen nach der Riviera, weil es doch immer ein Schuß durch die Lunge war – hat Tante sich ’was ausgedacht. Ich glaub’, bloß halb aus Liebe zu mir, halb, um die Eltern zu ärgern.“
Magda träumte vor sich hin.
„Du hörst ja gar nicht zu!“ rief Sibylle empört.
„Doch, doch,“ versicherte Magda auffahrend.
„Also – nun fall aber nicht in Ohnmacht, Alte! – Tante Zielendorf wird auch an die Riviera gehen und mich und Dich mitnehmen!“
„Mich?“ fragte Magda.
„Ja, Tante sagte leise zu mir, Du seiest die einzige gefühlvolle Seele in ganz Leopoldsburg. Kein Mensch habe sich die Sache so zu Herzen genommen wie Du. Und da sie doch fürchtet, sich zu langweilen, als Dritte bei einem Liebespaar, sollst Du mit,“ erzählte Sibylle triumphierend.
„Und Deine Eltern?“
„Die wollten erst nicht. Da sagte Tante, daß sie sich dann für die Heirat nicht mehr interessieren und kein Geld geben werde, wenn sie keinen Willen haben solle. Für die pekuniären Opfer wolle sie doch auch fortan in Walfried und mir so etwas wie Familie haben. Na, und da schwiegen die Eltern.“
„Ich kann nicht mit,“ sagte Magda.
„O, Du darfst es gern annehmen, Tante Sibylle hat scheußlich viel Geld,“ beteuerte Sibylle.
„Ich kann meinen Vater nicht verlassen.“
„Aber bitte, liebe Magda – der weiß ja doch nichts von Dir,“ sagte Sibylle.
Magda stand auf.
„Ich kann nicht!“ sprach sie ganz bestimmt. „Vielleicht wirst Du es eines Tages verstehen.“
Sibylle sah sie ganz aufmerksam an und dachte nach. Plötzlich schien ihr ein Licht aufzugehen.
„Ich bin ja wohl mit Blindheit geschlagen gewesen?“ rief sie freudig aus – erfreut über ihre Findigkeit und rücksichtslos übersehend, ob sie auch an ein zartes Geheimnis rühre – „darum warst Du neulich so sonderbar zu Lilly und wolltest ihr nicht die Hand geben! Du hassest Lilly, weil Du selbst eine hoffnungslose Liebe zu Flemming hast! Mein armes, liebes Herz!“
Sie umarmte Magda mit naivem, beleidigendem Mitleid.
„Und da bist Du bange, Lilly noch oft treffen zu müssen, ehe wir reisen? – Nein, die rutscht ab. Weißt Du, die hat sich hier tot gelangweilt. Sie hatte so’ne große Korrespondenz die letzten Tage und hat es sich so eingefädelt, daß sie am Tage, wo Walfried außer Gefahr erklärt werde – eher ging es doch Schanden halber nicht – einer Einladung zur alten Ponsdorf, ihrer künftigen Schwiegermutter, folgt. Sie wird es da wohl zu drehen wissen, daß sie sich, anstatt nächsten Herbst, schon diesen Winter mit Ponsdorf verlobt. O, ich kann mich schon im voraus schwarz ärgern, wenn ich daran denke, wie Lilly mich mit ihrer Neunzackigen und ihrem Geld noch mal anöden wird. Und Mama sagt, die Ponsdorfs sollten man still sein; der selige Graf hat seiner Zeit mit Stroußberg ’was gegründet und dabei ist er reich geworden, und Mama sagt, alles Geld von daher hat ’was Brenzliges. Wir haben nicht viel, aber vornehm sind wir, wir Lenzows. Also, was ich sagen wollte: wegen Lilly kannst Du gern kommen – die Luft ist rein von morgen ab.“
Magda sah wohl ein, daß es vor dieser Beredsamkeit kein Entrinnen gab, außer durch die Wahrheit.
„Ich kann aber doch nicht mit Herrn von Wallwitz zusammenkommen,“ sagte sie leise. „Ich war mit René Flemming heimlich verlobt, ehe – ehe – –“
Sibylle schrie beinahe auf.
„Also doch, also doch! Was mußt Du ausgestanden haben, Magda! Und hast das immer so in Dich ’reingeschluckt? O – das könnt’ ich nicht. Gott – wie mußt Du Lilly hassen – und ihn! Hör’ ’mal, das war doch schändlich von ihm. Nein, so ’was kann man nicht vergeben! Dieser Sch – –“
„Sibylle!“ rief Magda mit lauter empörter Stimme, „untersteh’ Dich, ein Wort auf ihn zu sagen! Gewiß, es war schrecklich – aber ich habe es verziehen. Wir sind versöhnt. Du bist zu jung, um einen Mann wie René zu richten.“
Die kleine Braut, die schon vor Eifersucht gezittert hatte, wenn Walfried früher mit einer anderen Dame nur tanzte, sah Magda fassungslos an.
[863] „So etwas willst Du vergeben? Aber das ist doch gar nicht zu verstehen, daß er dir untreu ward, um mit Lilly eine Liebelei anzufangen,“ sprach sie.
Sie hatte Magda immer für ein sehr stolzes Mädchen gehalten und würde es viel begreiflicher gefunden haben, wenn jetzt große Worte von Haß und Rache gefallen wären.
„Verstehen? Nicht verstehen?“ sagte Magda mit leuchtenden Augen. „Glaubst Du, daß wir Frauen einen Mann je ganz verstehen können? Und ein Mann uns? Haben wir nicht Fähigkeiten und Bedürfnisse und Empfindungen, die verschieden von denen eines Mannes sind? Glaubst Du, daß die Männer so sind, wie wir sie uns in unsern Mädchenträumen gedacht haben?“
„Mein Walfried ist so!“ schaltete Sybille ein. Magda hörte gar nicht. Sie fuhr fort, beredt, als hätte sie eine Verteidigung auf Tod und Leben zu führen:
„Wie oft ertappe ich mich darauf, jeden Tag und jede Stunde, daß ich René anklagen möchte, weil er diese und jene Regung meines Herzens, irgend ein Bedürfnis nach Trost, nach seiner Nähe, nach einem Liebeszeichen von ihm nicht befriedigt, weil er es nicht versteht! Und da muß ich mich denn endlich fragen: ja, verstehe denn ich ihn immer? Sein Herz, seinen Geist, seine Stimmungen? Glaubst Du, daß zwei Menschen einander je ganz erfassen können, bis in die allergeheimsten Falten ihres Wesens? Glaubst Du nicht, daß da Tiefen sind, die man in sich selbst nicht ahnt und die uns selbst überraschen, wenn sie sich bei irgend einer Gelegenheit vor uns aufthun? Und wie sollten wir die Abgründe, die verborgenen, in einer andern Seele alle erkennen wollen? Wie je vor Ueberraschungen auch von dort sicher sein? Und außerdem: verändern wir uns nicht? Kann ich wissen, wie ich mich in einigen Jahren entwickelt haben werde? Kann ich wissen, wohin seine Seele wächst? Nichts kann man verstehen, aber alles kann man verzeihen. Die Liebe trägt über jede Kluft des Unbegreiflichen hinüber! Aber freilich, daran muß man glauben, daß man liebt, bis in den Tod, und geliebt ist über alles – trotz allem!“
„O –“ sagte Sibylle und faltete vor Erstaunen die Hände.
„Und das bin ich!“ fuhr Magda stolz fort. „Er hat es mir gesagt, als er sich zum Tode vorbereitete. Er liebt mich. Seine Seele ist mir immer treu gewesen.“ –
Als Sibylle fort war, stand Magda wie betäubt.
Was hatte sie alles gesagt? Waren das Gedanken gewesen, die, langsam, langsam in ihrem Herzen emporgewachsen, sich nun endlich in klare Worte gekleidet hatten? Sprach sie das alles, um ihn zu verteidigen, weil es ihr unmöglich war, Anklagen, die ihre Seele vielleicht selbst erhoben hatte, von andern Lippen laut zu hören?
Oder hatte sie es für sich selbst gesprochen, um mit lauten Worten die ewig nagenden stillen Zweifelgedanken sich zur Ruhe zu zwingen?
Mutlos neigte sie das Haupt. Sie redete sich ein, nur für Sibylle so gesprochen zu haben, um Sibyllens schnelle Zunge und kindisches Urteil zum Schweigen zu bringen. Sie hätte es eben nicht ertragen, ihn schmähen zu hören.
Auch sah Sibylle ja nur das eine Unbegreifliche: die kurze Treulosigkeit. Die vielen anderen kleinen Züge – klein und doch so unaussprechlich wichtige Zeugenschaft ablegend – die davon sprachen, daß René immer anders dachte und handelte, als Magda sich gedacht haben würde, daß er müsse – nein, die sah Sibylle nicht und ahnte auch nicht, daß er jetzt viele, viele Tage hatte vergehen lassen, ohne Magda auch nur ein Zeichen seines Gedenkens zu geben.
„Was wird er jetzt thun?“ dachte Magda, „wenn er erfährt, daß Wallwiz gerettet ist? Wird er versuchen, all die schrecklichen Erinnerungen abzuschütteln? Wird er versuchen, wieder zu arbeiten? Seine Natur hat gewiß entsetzlich gelitten unter dem stillen thatenlosen Leben. Kommt er jetzt endlich zu mir und bittet mich: hilf mir wieder das Gleichgewicht finden, mache mir Mut, zu meinem Werke zurückzukehren? Und wird dann alles wieder gut werden?“
All diese Fragen beantwortete sie sich dann mit einem harten „Nein!“
„Nein, wenn ich nicht mit ihm leiden durfte, will ich auch nicht mit ihm glücklich sein.“ (Schluß folgt.)
Lorenzo Magnifico.
Unterdessen war auch die zweite Hälfte des frevlerischen Anschlags gescheitert.
Der Erzbischof hatte sich unter der Domthüre von Lorenzo verabschiedet und war dann mit einer starken Begleitung nach dem Regierungspalast geeilt, wo die Signoria eben bei der Tafel saß. Einen Teil seiner Leute ließ er unten mit der Weisung, beim ersten Lärm das Thor zu besetzen, die andern nahm er mit in den Palast und hieß sie in einem Nebengelaß warten, während er selbst zu der geforderten Unterredung bei dem Gonfaloniere[1] eingeführt wurde. Aber die Aufregung und das seltsame Betragen des Besuchers, der etwas Verwirrtes von einem päpstlichen Auftrag an die Signoria daher redete und dabei unruhig nach der Thüre blickte, als ob er jemand erwartete, machte den Gonfaloniere stutzig. Er eilte rasch zum Ausgang, stieß auf einen der Verschworenen, der eben herein wollte, warf diesen an den Haaren zu Boden und rief die Wache zusammen. Die im Nebenzimmer versteckten Begleiter wollten herausbrechen, allein sie saßen in einer Falle fest, denn die Thür, die hinter ihnen zugeschlagen war, hatte ein Geheimschloß, das nur die Beamten zu öffnen verstanden. Sie wurden samt dem Erzbischof, der zu entfliehen versuchte, festgenommen, und da die außen stationierte Mannschaft in den Palast eindrang, verteidigte die Signoria das obere Stockwerk mit Steinen und was ihnen zur Hand kam; selbst das Küchengeschirr mußte als Waffe dienen.
Francesco de’ Pazzi hatte sich mit seiner schweren selbst geschlagenen Wunde nach Hause geschleppt und versuchte noch zu Pferde zu steigen, um den Aufruhr in der Stadt zu leiten. Doch er war so erschöpft vom Blutverlust, daß er sich entkleidet aufs Bett werfen mußte. Statt seiner eilte der alte Messer Jacopo mit etwa hundert Mann auf die Piazza, um dem Erzbischof zu Hilfe zu kommen. Aber die Sache der Pazzi war schon verloren. Als er das Volk zur Befreiung von der mediceischen Herrschaft aufrufen wollte, wurde er mit Steinwürfen und mit dem Ruf: Palle! Palle![2] Nieder mit den Verrätern! empfangen. In allen Straßen rottete sich die Menge zusammen: das kleine Häuflein, das den Palast besetzte, mußte weichen und viele wurden auf der Flucht erschlagen.
Jetzt erst erfuhr die Signoria Giulianos Tod und Lorenzos Verwundung und nun gab es auch drinnen keine Schonung mehr. Man hieb die Gefangenen, und wessen man sonst von den Eindringlingen habhaft wurde, nieder oder stürzte sie durch die Fenster auf die Piazza hinab. Der Erzbischof mit seinem Bruder und andere Häupter der Verschwörung wurden an den hohen Kreuzstöcken des Palastes aufgeknüpft; man ließ ihm nicht einmal Zeit, sich des geistlichen Ornats zu entkleiden. Gleichzeitig erlitt Francesco de’ Pazzi, den man, wie er war, aus dem Bette gerissen und unter dem Wutgeschrei des Volks nach dem Palast geführt hatte, an der Seite des Erzbischofs dieselbe Strafe. Auf alle Schmähungen, mit denen er überhäuft wurde, antwortete er nur durch finstere Blicke und tiefe Seufzer und der wilde Trotz verließ ihn auch im Tode nicht. Von dem Erzbischof wird erzählt, daß er im Augenblick des Sterbens sich wütend mit den Zähnen in Francescos nackte Brust verbissen habe.
Draußen hatte unterdessen die Volksjustiz ihr grausiges Werk begonnen. Man sah zerstückte menschliche Glieder durch die Straßen geschleift, die beiden Priester, die Lorenzo angegriffen hatten, wurden von der Menge aus ihrem Klosterversteck herausgezerrt, [864] verstümmelt und getötet, auch die Personen aus dem Gefolge des Kardinals mußten bluten, dieser selbst saß gefangen im Regierungspalast und dankte nur der Verwendung Lorenzos das Leben. Die wildeste Jagd galt den Gliedern des Hauses Pazzi. Der alte Jacopo wurde auf der Flucht im Gebirge von den Bauern festgenommen, denn die Kunde von den Vorgängen in Florenz war schon bis dorthin gedrungen, und trotz seiner flehentlichen Bitten, ihn unterwegs zu töten, schleppten sie ihn schmachvoll nach der Stadt, wo er das Los seines Neffen teilte. Er hatte übrigens sein tragisches Ende geahnt und noch am Samstag, der jenem blutigen Sonntag voranging, alle seine Schulden bezahlt, auch, was er an fremden Waren zu Hause und auf dem Zollamt liegen hatte, mit auffallender Geschwindigkeit den Eigentümern zugestellt, um keine Unbeteiligten in seinen Ruin zu verwickeln. Die scheußlichen Beschimpfungen, die noch dem Leichnam des Unseligen von der vertierten Menge zugefügt wurden, gehören zu den widerlichsten Flecken, mit denen sich das sonst so menschliche und hochkultivierte florentinische Volk in jenen Schreckenstagen beschmutzt hat. Der völlig schuldlose Renato wurde gleichfalls aufgegriffen und büßte mit dem Tode, daß er Pazzi hieß. Nur Guglielmo konnte sich mit Hilfe seiner Gattin in Lorenzos eigenem Hause bergen.
Mehrere Tage dauerte das Würgen, bei dem gegen hundert Personen, teils durch Henkershand, teils durch die Wut der Massen, ihr Leben verloren. Lorenzo selber suchte dem Wüten Halt zu gebieten. Gleich nach dem Attentat war das Volk unter dem Palaste Medici zusammengeströmt, ein blutiges Haupt auf einer Pike tragend, und hatte den Geretteten zu sehen verlangt. Lorenzo erschien, den Hals von einer Binde umwickelt, und wurde mit stürmischem Zuruf begrüßt. Er dankte denen, die ihn gerettet, und bat dringend um Mäßigung. Die tobenden Freunde, sagte er, flößten ihm mehr Besorgnis ein als selbst die Tücke seiner Feinde. Er beschwor das Volk, seinen Zorn für die äußeren Gegner aufzusparen und die Sorge für die Bestrafung der schuldigen Mitbürger den Gerichten zu überlassen. Diese Anrede, seine Mäßigung, die überstandene Gefahr, das alles wirkte mächtig auf die Gemüter; die Bürgerschaft wetteiferte, ihm Gut und Blut zu Füßen zu legen, auch die Lauen waren gewonnen, und unter allen Schrecken dieses Tages durfte Lorenzo sich sagen, daß eine Stunde ihn von allen seinen inneren Feinden befreit hatte.
Als die Volksrache gesättigt war, begannen die Gerichte zu arbeiten. Was vom Hause Pazzi noch übrig war, wurde eingekerkert oder verbannt, auch Guglielmo, Lorenzos Schwager, inbegriffen, ihre Güter wurden eingezagen, ihre Wappen, ihre Vorrechte, ihr Name selber aufgehoben. Mantesecco wurde nach einem umfassenden Geständnis, das den Papst schwer belastete, enthauptet. Nur Bermardo Bandini, Giulianos Mörder, hatte sich zu verbergen gewußt und entkam glücklich nach Konstantinopel; aber der Sultan, um Lorenzo zu ehren, sandte ihn in Ketten nach Florenz zurück, wo er noch ein Jahr später hingerichtet wurde. Zum ewigen Gedächtnis der Blutthat ließ man alle Teilnehmer der Verschwörung mit dem Strick um den Hals auf die Außenwände des Palazzo del Podestà (des heutigen Nationalmuseums)
malen, als Hochverräter mit dem Kopf nach unten. Andere Künstler eiferten, den Geretteten zu feiern. Lebensgroße, sprechend ähnliche Wachsbildnisse von Lorenzo, zu denen Verrocchio die Zeichnung gemacht, wurden in Kirchen aufgestellt, eines davon trug die Kleider, in denen Lorenzo verwundet worden war. A. Pollajuolo schlug eine noch jetzt vorhandene Medaille mit den Köpfen der Brüder Medici, die auf einer Seite die Rettung Lorenzos, auf der andern den Tod Giulianos vor dem Chor der Kirche – mit den Umschriften Salus publica und Luctus publicus („Das Heil des Staats“ und „Das Unglück des Staats“) – darstellte. Angelo Poliziano öffnete den liedersüßen Mund und ergoß in lateinischen Epigrammen seinen Schmerz um den gefallenen Freund und seinen unversöhnlichen Haß gegen die schon gerichteten Mörder.
Vier Tage nach dem blutigen Ereignis wurde Giuliano, mit neunzehn Wunden bedeckt, zu Grabe getragen. Die Trauer um ihn war tief und allgemein. Die Jugend des Opfers, sein freundliches Wesen und seine offene Hand, wodurch er alle Herzen gewonnen hatte, der Glanz seiner Gestalt, die feine Bildung und ritterliche Tapferkeit, das alles kam zusammen, um aus Giuliano eine jener tragischen Jünglingsgestalten zu machen, deren Geschick noch die Nachgeborenen beweinen.
Unser Bildnis nach einem in Berlin befindlichen Porträt von Botticelli widerspricht der Schilderung nicht, die sein Freund, der Dichter Poliziano, von Giuliano de’ Medici hinterlassen hat: hoher Wuchs, kräftiger Gliederbau bei vorgewölbter Brust, dunkle Augen, schwarzes, lose aus der Stirn gestrichenes Haar und bleiche Hautfarbe. Trotz der Aehnlichkeit mit Lorenzo darf man ihm glauben, daß Giuliano der Idealtypus jugendlich männlicher Eleganz war, wie er jener Zeit vorschwebte, vorausgesetzt, daß man, wie jene Alten es thaten, die Schönheit nicht in der Regelmäßigkeit der Züge, sondern in der charakteristischen Durchbildung aller Formen sieht und die äußeren Vorteile einer edelgeborenen, völlig ausgebildeten Persönlichkeit dazu rechnet. Giuliano war ein leidenschaftlicher Jäger, in Strapazen abgehärtet und jeder Art von Sport ergeben, in der Liebe zu Kunst und Poesie zeigte er sich als ein echter Medici und besaß auch selbst eine poetische Begabung, die wohl der seines Bruders nicht gleichkam, aber jedenfalls über den Dilettantismus hinausging; von seinen Gedichten ist leider nichts erhalten. Es war natürlich, daß die florentinische Jugend an ihm als ihrem Vorbild hinaufsah, und viele legten bei seinem Tode Trauerkleider an.
Da er der Politik fern blieb, hat die Geschichte kaum mehr von ihm verzeichnet als sein gewaltsames Ende. – Eine um so tiefere Spur hat er in der Poesie seiner Tage zurückgelassen, denn eine der berühmtesten Dichtungen des Jahrhunderts, die „Giostra“[3] des Poliziano feiert Giulianos Waffenproben und seine Liebe zu der schönen Simonetta. Sehr anmutig wird seine erste Begegnung mit der Schönen bei der Verfolgung eines Hirsches geschildert: die reizende Jugendgestalt in einem lichten Sommerkleide Blumen pflückend; der Jüngling, der bis dahin in trotzigem Selbstgefühl die Liebe verschmäht hatte, von ihrem Anblick so verwirrt und hingerissen, daß ihm kaum die Zunge gehorcht, um schüchtern nach Namen und Herkunft zu fragen. Das Gedicht ist in großem Umfang angelegt, reißt aber plätzlich ab mit dem Hinweis auf ein hereinbrechendes tragisches Verhängnis, womit nur der bald darauf erfolgte Tod der schönen Simonetta gemeint sein kann.
Sie war von genuesischer Familie und vermählt mit Marco Vespucci, einem edlen Florentiner, dessen Vater Piero später in [865] die Verschwörung der Pazzi mit verwickelt und aus Florenz verbannt wurde.
Außer der großen Schönheit werden ihr seltene Geistes- und Herzensgaben und eine besondere Holdseligkeit im Umgang nachgerühmt, wodurch sie die Eifersucht entwaffnete und sich zu der Verehrung der Männer auch die der Frauen erwarb.
Von ihren Beziehungen zu Giuliano ist nichts weiter auf die Nachwelt gekommen als seine leidenschaftliche Verzweiflung bei ihrem vorzeitigen Sterben. Simonetta wurde durch eine zehrende Krankheit weggerissen und war auch im Tode noch so schön, daß man sie im offenen Sarg zu Grabe trug, um den Mitbürgern noch einmal ihren Anblick zu gönnen. Ihr Tod wurde als ein öffentliches Unglück betrauert. Der Gebieter der Stadt selber besang dieses vielbeweinte Ereignis in einem Cyklus formschöner Sonette, worin er sich selbst in die Empfindung des Liebenden zu versetzen sucht, der durch diesen Tod seiner Lebenssonne beraubt wurde. Ihm nach versuchten sich die Dichter des Mediceerhofs mit mehr oder minder Geschick in ähnlichen Totenklagen, aber alle übertraf Poliziano mit seiner herrlichen lateinischen Elegie, in der Simonettas Leichenzug ein Triumphzug wird.
Sie starb am 26. April 1476, also genau zwei Jahre vor dem Tage, wo Giuliano unter dem Altar von Santa Maria del Fiore den Mörderdolchen erlag. Ob es nicht das Bild der toten Simonetta war, was den Unglücklichen an jenem Gedenktag von dem lärmenden Festgelage, wo der Mord lauerte, zurückhielt und sein Geschick noch um ein kleines verzögerte? – Mit den Poeten haben die Maler gewetteifert, Simonettas Reize festzuhalten. Ihr Bildnis, von Botticclli für die Medici gemalt, hängt im Palazzo Pitti zu Florenz, ist aber nur aus dem Geschmack jener Zeit zu verstehen. Pollajuolo dagegen hat auf seinem schönen, jetzt dem Herzog von Aumale gehörigen Porträt die Gefeierte in einer Weise aufgefaßt, die auch dem modernen Schönheitssinn entspricht. –
Bald nach Giulianos Ende enthüllte sich ein Geheimnis, an dessen Mitteilung ihn selbst der rasche Tod verhindert hatte. Der Architekt Antonio da San Gallo, sein Vertrauter, benachrichtigte Lorenzo, daß dem Verstorbenen ein natürlicher Sohn geboren sei, dessen Mutter dem Haus der Gorini angehöre und den er selbst aus der Taufe gehoben habe. Lorenzo suchte eilends den Knaben auf und nahm ihn auf den Wunsch seiner Mutter mit sich in den Mediceerpalast, wo er unter dem Namen Giulio mit Lorenzos eigenen Kindern heranwuchs. Dieser Giulio war es, der später unter dem Namen Clemens VIl. den päpstlichen Stuhl bestieg und schweres Unheil über seine Vaterstadt brachte.
Giulianos Schicksal hat viele Geister beschäftigt und ist noch in den letzten Jahren von Leoncavallo zu einer Oper „I Medici“ verarbeitet worden, in der historische Gründlichkeit und phantastische Willkür wunderlich streiten; das Musikdrama ist auch über einzelne deutsche Bühnen gegangen. Schlechter als bei diesem Modernen ist der unglückliche Giuliano bei dem Dichter Alfieri weggekommen, der ganz im Geiste des vorigen Jahrhunderts überall an Stelle der menschlichen Leidenschaften Prinzipien sah und daher in seiner bekannten Tragödie „Die Verschwörung der Pazzi“ das glänzende mediceische Brüderpaar als zwei tückische Tyrannen und die meuchlerische That der Pazzi als einen Akt heroischer Vaterlandsliebe darstellt. Wir Heutigen denken anders; wir wissen, daß jener Kampf keine freiheitliche Erhebung war, sondern nur die Verdrängung einer herrschenden Familie durch eine andere bezweckte, und daß es im höchsten Interesse des Friedens und der Kultur lag, daß das Steuer in den Händen des Würdigsten blieb.
Nach dem Untergang der Pazzi führten die päpstlichen Condottieren ihre Truppen, die schon die Grenzen der Toskana überschritten hatten, eiligst zurück. Aber Lorenzos Leben und Stellung war dadurch noch keineswegs gesichert. Papst Sixtus spie Feuer und Flammen und suchte jetzt durch offene Gewalt zu erlangen, was seinen Ränken mißglückt war. Die begütigenden Gesandtschaften der Florentiner wies er schroff zurück und nahm die Gefangenhaltung des Kardinals, die Hinrichtung des Erzbischofs und der anderen Geistlichen zum Vorwand für eine Bulle, in der Lorenzo, dieser „Sohn der Verdammnis“, nebst den Häuptern der Regierung aus der Kirche ausgeschlossen und ganz Florenz mit dem Interdikt bedroht wurde, wenn es den Verhaßten nicht in die Hände des Papstes ausliefere. Und da ihm die geistlichen Waffen nicht genügten, schloß Sixtus ein Bündnis mit dem König Ferrante von Neapel, erklärte Florenz den Krieg und warf die vereinigten Heere unter den besten Führern ins Toskanische. In der Kriegserklärung hieß es, daß der Feldzug des Papstes und des Königs nicht gegen die Republik, sondern nur gegen Lorenzo gerichtet sei; liefere man ihnen die Person des Medici aus, so solle der Friede nicht gestört werden. Die Bürgerschaft erklärte, daß sie bereit sei, mit Lorenzo zu stehen und zu fallen. Den Bannfluch wies die hohe florentinischc Geistlichkeit mit Hohn zurück und kündigte dem Papst als einem Verschwörer ihren Gehorsam. Doch wurde der Kardinal Riario, der vergeblich zu vermitteln gesucht hatte, unbeschädigt seinem Oheim zurückgegeben, welche Rücksicht den Florentinern schlecht bekam, denn nun brachen unverzüglich die Feindseligkeiten aus.
Sie fanden Lorenzo nicht unvorbereitet. Hatte er bis zuletzt alles aufgeboten, um den Frieden zu retten, so übertraf er jetzt sich selbst im Organisieren der Verteidigung.
Frau und Kinder hatte er mit A. Poliziano als Hauslehrer auf ein sicheres Landgut geschickt, er selbst blieb in der bedrohten Stadt, wo jetzt auch die Pest ausgebrochen war, zurück und arbeitete rastlos.
Die Stadt wurde verproviantiert, alle festen Punkte verstärkt und neue gebaut, gegen Siena und im Mugellothal starke Posten vorgeschoben. Lorenzo war überall die treibende Kraft. Die Angehörigen der hingerichteten Verschwörer kettete er durch neue Wohlthaten an sich, kein Feind durfte ihm im Innern zurückbleiben. Gleichzeitig unterhandelte er unausgesetzt mit den auswärtigen Höfen.
Die Lage war schwierig, auf die Bundesgenossen kein Verlaß: die Venetianer, ein zähes, in selbstsüchtige Politik eingeschlossenes Jnselvolk, schickten unzulängliche Hilfstruppen und sahen kaltblütig zu, wie das Schicksal von Florenz sich gestalte; Mailand, das guten Willen hatte, stand wegen inneren Haders selbst in hellen Flammen.
In all diesen Sorgen blieb Lorenzo noch Zeit, der dichterischen Thätigkeit Polizians zu folgen, und er schrieb wohl auch selbst gelegentlich zwischen zwei Ratssitzungen eines seiner vortrefflichen Sonette nieder, ja er hatte noch gute Laune genug übrig, um den Klagen seines schwierigen Hauslehrers, der sich mit Madonna Clarice nicht stellen konnte, ein nachsichtiges Ohr zu leihen. Nichts zeichnet Lorenzo mehr aus als diese unwandelbare Sammlung inmitten der aufreibendsten Thätigkeit und die hohe Gelassenheit, mit der er jederzeit über den Stürmen des Augenblicks stand.
Der Krieg wurde von beiden Seiten nach damaliger Sitte [866] von bezahlten Condottieren geführt, die für die Sache, der sie dienten, kein Herz hatten und immer bereit waren, zu der Partei eines etwa besser zahlenden Gegners überzugehen. Jahrelang dauerte der Feldzug, bei dem wenig Blut vergossen, aber unendliches Elend über die betroffenen Landesstrecken gebracht wurde. Die Sienesen, den Florentinern von alters her übelgesinnt, öffneten dem Feinde den Paß ins Herz der Toskana und ein glänzender Sieg der Florentiner unter ihrem Feldhauptmann Roberto Malatesta am Trasimener See wurde durch die schrecklichen Verwüstungen des verbündeten Heeres im Chiana- und Elsathal zu nichte.
Ein Waffenstillstand enthüllte Lorenzo erst seine ganze Gefahr, denn nun wurde der Mißmut der Bürgerschaft laut. Die erschöpften Finanzen, die Stockung des Handels, die Verheerung des Landes, der ganze wirtschaftliche Niedergang mit Teuerung und Pest hatten die Begeisterung abgekühlt, man gab Lorenzo zu verstehen, daß, da dieser verderbliche Krieg um seinetwillen geführt werde, es nun an ihm sei, so oder so dem allgemeinen Elend ein Ende zu machen.
In dieser höchsten Not, wo nur ein Wunder retten konnte, griff der Bedrängte in seine eigene Brust und schöpfte dort einen jener Entschlüsse, die nur dem Genie, das sich auf einen starken Charakter stützt, gegeben sind.
Er wußte, daß auch Ferrante des langen Krieges überdrüssig war, und diese Gewißheit gab ihm den Mut, selbst nach Neapel zu gehen und sich in die Hände des Königs auszuliefern, um entweder als Bringer des Friedens zurückzukehren oder dort sein Leben zu lassen.
Das Wagnis war groß, denn über der Königsburg von Neapel schwebten noch die Schatten einer blutigen That: König Ferrante aus dem Hause Arragonien, dieser treuloseste und grausamste Despot in einer an Treulosigkeit gewohnten Zeit, hatte den berühmten Condottiere Jacopo Piccinino unter Freundschaftsversicherungen zu sich gelockt und ihn heimlich ermorden lassen. Wenn dies dem geladenen ahnungslosen Gastfreund geschehen war, welcher Behandlung durfte ein im offenen Krieg befindlicher Gegner gewärtig sein!
Aber Lorenzo vertraute auf sein internationales Ansehen, auf die Wirkung seiner Persönlichkeit, die noch jüngst den Mörderarm entwaffnet hatte, auf die Macht seiner Gründe und auf sein Glück.
In aller Stille verließ er die Stadt und teilte erst von unterwegs der Signoria seine Absicht mit. Wer am meisten Ehre genossen habe, schrieb er, dem gebühre es auch, die Gefahr aller auf sein Haupt abzulenken, und er, als der hauptsächlichste Stein des Anstoßes, sei am besten geeignet, die Gesinnungen des Königs an seiner eigenen Person zu erproben und mit einem Schlage die ungewisse Lage zu klären.
Da die Signoria den wagehalsigen Schritt nicht verhindern konnte, wollte sie Lorenzo wenigstens mit ihrer ganzen Autorität stützen und ernannte ihn deshalb zum offiziellen Gesandten der Republik.
In dieser Eigenschaft kam er in Neapel an und wurde dort mit fürstlichen Ehren empfangen. Der König sandte ihm Schiffe entgegen, alles strömte zusammen, den Mann zu sehen, um den der lange Krieg geführt wurde und der jetzt allein und wehrlos sich in die Höhle des Löwen wagte.
Lorenzo hatte seine Ueberredungskunst nicht überschätzt. Es gelang ihm schnell, den König von den Vorteilen einer gemeinsamen Politik zu überzeugen, und er wurde mit höchster Auszeichnung in Neapel behandelt; aber gleichwohl hielt der ränkevolle Monarch ihn drei volle Monate in Ungewißheit zurück, während heimlich die Agenten des Papstes geschäftig waren, ihn zu verderben.
Lorenzo ließ sich keine Unruhe merken; er lebte auf großem Fuße, gewann den Hof durch seine Geselligkeit, das Volk durch fürstliche Geschenke und wurde der populärste Mann in Neapel. Da in dieser langen Zeit in Florenz alles ruhig blieb und Ferrante nun einsah, daß der Medici eine Macht war, auf die man bauen konnte, entließ er ihn mit einem ehrenvollen Friedensbündnis in der Tasche.
Mit grenzenlosem Jubel wurde der Heimgekehrte in Florenz empfangen. Der Andrang um ihn war so ungeheuer, daß die nächsten Freunde ihm nur aus der Ferne mit Augen und Händen zuwinken konnten. Ganz Italien atmete auf, und als bald danach ein Türkeneinfall in Otranto die Fürsten zur Einigkeit zwang, ließ sich auch der grollende Papst durch gute Worte vollends versöhnen.
Noch zwölf glückliche Regierungsjahre folgten auf diese Stürme.
Aus den Blättern der Geschichte, soviel sie von Lorenzo de’ Medici berichten, tritt sein Bild nicht voll heraus. Um seine Größe zu ahnen, muß man in Florenz gelebt haben, wo man auf Schritt und Tritt den Spuren seines Wirkens begegnet und von wo die geistigen Keime damals über die ganze Welt hinausflogen. Zwar gebaut hat er lange nicht so viel wie sein Großvater Cosimo, die Zeiten waren dafür zu unruhig; aber was er für Malerei und Skulptur that, ist kaum zu überblicken; andere, daniederliegende Kunstzweige wurden durch ihn aus der Vergessenheit hervorgeholt, die verschüttete antike Welt ans Licht gezogen.
Eine Geselligkeit wie die seines Hauses hat es kaum jemals in der Welt wieder gegeben. Da wußte man nichts von Etikette und nichts von Unterwürfigkeit: Lorenzo war nur ein Bürger wie die andern. Die angeborene Feinheit und die hohe Bildung der Nation erlaubten die vollkommenste Natürlichkeit. Zwischen den Diplomaten und hohen Geistlichen bewegten sich Dichter, Künstler, Gelehrte im zwanglosen Verkehr, und die widerstreitendsten Elemente hielt der einzige Mann durch seine Persönlichkeit zusammen.
Kein begabter Mensch hat seinen Weg gekreuzt, der durch ihn nicht Anregung und Förderung gefunden hätte. Indem er auf die Art eines jeden einging und sich selbst ihre Launen gefallen ließ, um nur ihr Schaffen nicht zu stören, mehrte ihr Ruhm den seinigen.
Doch nicht nur die fertigen Talente wurden begünstigt, Lorenzo wußte auch die keimenden zu entdecken und heranzuziehen. Die mediceischen Gärten nebst dem angrenzenden Kasino wurden die Schule einer neuen Künstlergeneration, und es ist nicht der kleinste Ruhm Lorenzos, daß fast alle, die aus dieser Anstalt hervorgingen, sich später als bedeutende Menschen auswiesen. Auch der fünfzehnjährige Michelangelo fand dort liebevolle Pflege seines Talentes und wurde täglicher Gast an Lorenzos Tafel, wo die berühmtesten Männer Italiens beisammen saßen. Die Hausordnung war merkwürdig. Es gab keine Rücksicht auf Rangstufen und Alter, wer zuerst kam, setzte sich neben den Hausherrn und für etwa nachkommende Höhergestellte wurden keine Umstände gemacht. Der Same, der bei diesem Verkehr unter die Jugend gestreut wurde, brachte dem folgenden Jahrhundert seine überreichen Früchte. Hätte Lorenzo, als seine Reste nach vierhundertjühriger Ruhe jüngst ans Licht gefördert wurden, aus den leeren Augenhöhlen noch einen Blick auf die von Michelangelos Meisterhänden geschmückten Wände der Mediceerkapelle werfen können, wie würde er sich über die Größe des Schützlings gefreut haben, den er als Kind aus allen andern herausgefunden hatte!
Zu den nächsten Vertrauten, die mit Leidenschaft an ihm hingen und denen Lorenzo lebenslang ein standhafter, immer hilfreicher Freund war, gehörten vor allen die Dichterbrüder Pulci, der oft genannte Angelo Poliziano und das glänzendste Meteor dieses Kreises, der schöne blutjunge Fürst Pico von Mirandola, der freiwillig das Hofleben mied, um sich ganz den Studien zu widmen, und der mit zwanzig Jahren für den größten Gelehrten seiner Zeit galt.
Aber in Lorenzo selbst war die Naturkraft am stärksten. Von seiner poetisch begabten Mutter hatte er die „Lust am Fabulieren“ geerbt und seine Dichtungen gehören zum Trefflichsten und zum Originellsten, was das Jahrhundert hervorgebracht hat. Unähnlich andern Fürsten, die im poetischen Wettbewerb höfischer Schmeichelei den Lorbeer danken, verjüngte er die Poesie, die in Gelehrsamkeit zu ersticken drohte, durch frischen Natursinn und wurde der Schöpfer einer neuen freieren Litteraturgattung, zu der keiner seiner Mitstrebenden ohne ihn den Weg gefunden hätte.
Heitere ländliche Idyllen, ergreifende geistliche Gesänge, übermütige Tanzlieder, die durch ihre frische Sangbarkeit noch heute lebendig sind, entquellen diesem vielseitigen Talent in gleich starkem Strome, während eine rastlose praktische Thätigkeit jede Minute seines bewegten Lebens ausfüllte – er schrieb täglich bis zu zehn ja zwanzig Briefe. Neben den Regierungssorgen und einer verwickelten Verwaltungsmaschinerie, deren kleinstes Detail durch seine Hände ging, neben der Erledigung von Besuchen, Briefen, Bittschriften, Geschenken, die aus aller Herren Ländern fortwährend an ihn kamen, hatte er noch Zeit zu ernsten philosophischen Studien, [867] und die von Cosimo gegründete Platonische Akademie erreichte unter Lorenzo ihre höchste Blüte.
Es ist der merkwürdigste Zug dieser unvergleichlichen Natur, daß er auf keinem Gebiete Dilettant war, sondern „für jede Thätigkeit, die er ergriff, geboren schien“.
Vom Kaufmann war keine Faser mehr in ihm und den ungeheuren ererbten Besitz konnte er nur noch verschwenden, freilich für die edelsten Ziele der Menschheit. Es kam ein Augenblick, wo die große mediceische Bank vor dem Ruin stand und wo Staatsgelder zu Hilfe genommen werden mußten. Diesen Vorwurf teilt Lorenzo mit Perikles.
Als Herrscher kann man ihn den ersten modernen Staatsmann nennen, weil bei ihm zuerst die Rücksicht auf dauernden Kredit den augenblicklichen Vorteil überwog. Seine Politik lebte nicht von der Hand in den Mund, sondern schuf bleibende Zustände über die ganze Halbinsel. Von Blut hielt er die Hände rein – so weit es ein Herrscher in jenen gewaltsamen Zeiten konnte. Auch den Ueberlebenden der Pazzi[4] milderte er bald ihr hartes Strafurteil und hob es mit der Zeit ganz auf.
Doch da bekanntlich nichts schwerer zu ertragen ist als eine Reihe von guten Tagen, so stiegen nun aus dem Schoße des Friedens und der allgemeinen Wohlfahrt selbst die Wolken herauf, die den kommenden Sturm in sich trugen.
Die alte Einfachheit der Sitten war geschwunden; mit der höheren Bildung und dem rascheren Umlauf des Geldes entwickelten sich Luxus und Verfeinerung, jenes weiche Element, in dem die Kunst ihre üppigsten Blüten treiben kann, das aber zugleich die Korruption und alle Keime der Entartung zeitigt. Man hört noch heute den Vorwurf wiederholen, daß Lorenzo absichtlich sein Volk durch rauschende Feste betäubt, durch Genüsse entnervt habe, um ihm den Verfall seiner Freiheit zu verbergen. Aber diese Freiheit hatte schon vor Lorenzo nur noch der Form nach bestanden und die Verderbnis wäre auch ohne ihn gekommen, denn sie war der allgemeine Zug der Zeit. Ihn selber rissen Prachtliebe und Genußfreude hin, als er den florentinischen Karneval, jenes Abbild der antiken Saturnalien, ins Leben rief, und er mischte sich selber zwanglos fröhlich in die glänzenden, von Künstlern arrangierten Maskenzüge. Für sie dichtete er die berühmten Karnevalsgesänge, durch deren jauchzenbe Lebenslust sich ein Refrain schon wie eine leise Ahnung vom nahen Ende all dieser Herrlichkeit zieht – [5]
Chi vuol esser lieto, sia!
Di doman non c’ è certezza.
Doch was für ihn selbst nur ein Ausspannen aus ernster aufreibenber Arbeit bedeutete, das wurde bei andern, denen dieses Gegengewicht fehlte, zur Uebersättigung und inneren Leere.
Ein Rückschlag mußte kommen und Lorenzo hatte ihn selber eingeleitet, als er auf Wunsch seines Freundes Pico von Mirandola den Dominikanermönch Girolamo Savonarola als Prediger aus Ferrara nach Florenz berief.
Dieser, ein asketischer Visionär von beschränktem Gesichtskreis aber glühenber Seele, riß zuerst von allen verdeckten Schäden die Hülle. Im Klosterhof von San Marco unter einem Rosenbaum, von dem noch heute ein später Setzling grünt und treibt, predigte er unter ungeheurem Zudrang aller Stände gegen die einreißende Sittenverderbnis. Damals, im Beginn seiner Laufbahn, als ihm seine phantastischen Visionen den Kopf noch nicht verrückt hatten, war sein Streben ein verdienstliches; er wollte die gesunkene Kirche reformieren und die öffentliche Moral heben. Man war zwar noch nicht in den Zeiten der Borgia, aber nahe davor, Prunksucht und Genußsucht zerrütteten die Gesellschaft, die Geistlichkeit gab selbst das Beispiel, Treue und Glauben waren aus der Welt geschieden, das Schönheitsgesetz, das nur erlauchte Naturen binden kann, ließ die große Herde der Menschen ohne Halt. Das letzte Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts war ein fin de siècle, neben dem das unsrige ein sehr spießbürgerliches Gesicht hat. Die Sehnsucht nach der Wiederkehr einer reineren, strengeren Welt, wäre es auch auf Kosten aller Genüsse, selbst der edelsten, der des Geistes, schlich durch die besseren Gemüter.
Auf diesen Boden fielen wie ein Gewitterregen die Mahnungen Savonarolas und seine Ankündigungen eines nahen furchtbaren Strafgerichts. Italien horchte hoch auf bei diesem neuen Ton; es fühlte sich erschüttert und glaubte an den Propheten.
Lorenzo, in dessen tiefer Seele auch die religiöse Saite klang, suchte sich ihm anfangs zu nähern, aber der Fanatiker stieß die dargebotene Hand zurück. Geschenke, mit denen Lorenzo nach wie vor das Kloster bedachte, warf er ihm von der Kanzel herab als Bestechungsversuche vor. Ein guter Wächterhund, sagte er mit Anspieluag darauf, belle den Dieb, der seinen Herrn bestehle, an, auch wenn er ihm einen Knochen vorwerfe. Der Dieb an seinem Herrn war für ihn Lorenzo, den er öffentlich als Urheber der Sittenverderbnis und als Tyrannen anklagte.
Lorenzo blieb gelassen; er war zu stolz, den Ferraresen von dem Posten, auf den er ihn gestellt hatte, zu entfernen. Die Gegensätze lagen damals so nahe beisammen, daß Lorenzos ergebenste Freunde zugleich Freunde des Mönches sein konnten, gewiß ein Zeichen, daß es mit der „Tyrannis“ nicht schlimm bestellt war.
Naturen wie die Lorenzos verzehren sich rasch. Im Beginn der Vierziger stehend, mag der einst so kräftige Mann, der auf Turnieren gesiegt hatte, wohl dem von uns mitgeteilten Bilde geglichen haben, über dessen geneigter Haltung und sinnender Miene schon die Schatten des frühen Todes zu liegen scheinen.
Im April des Jahres 1492 verschlimmerte sich das Magenleiden, das ihn seit längerer Zeit quälte so, daß er seinen Landsitz zu Careggi, das alte Sterbehaus der Mediceer, nicht mehr verlassen konnte. Die Mischung von zerstampften Perlen und Edelsteinen, die ihm ein in Eile vom Herzog von Mailand gesandter Arzt dort bereitete, war jedenfalls nicht geeignet, das Ende aufzuhalten.
Schwere Sorgen trübte seinen frühen Lebensabend: durch die Orsinische Heirat war ein fremder Blutstropfen in die Familie gekommen, sein ältester Sohn Piero hatte mehr vom römischen Feudalherrn an sich als vom florentinischen Bürger und versprach ein schlechter Steuermann für das Schiff zu werden, dessen schwieriger Kurs nur durch die Weisheit und Erfahrung des Vaters regiert werden konnte.
In den letzten Stunden wollte der Sterbenbe seine beiden Vertrautesten, Pico von Mirandola und Angelo Poliziano, um sich haben. Mit ihnen redete er in ungetrübter Heiterkeit von ihren gemeinsamen Studien und von der angelegten Bibliothek, die er wünschte vollendet ihnen hinterlassen zu können.
Aber noch eine andere Gestalt tauchte an Lorenzos Sterbelager auf, düster wie die Verkörperung des dem Mediceischen Hause drohenden Geschicks: der Mönch Savonarola. Was ihn nach Careggi geführt, was die beiden zusammen geredet, ist ungewiß. Man sagt, er sei von Lorenzo selbst gerufen worden und habe nach empfangener Beichte den Sterbenden aufgefordert, seinem Volke die Freiheit wiederzugeben, worauf Lorenzo stumm den Kopf nach [868] der Wand gedreht und jener sich, ohne Absolution zu erteilen, entfernt habe.[6]
Lorenzo starb am 8. April 1492 im nicht vollendeten dreiundvierzigsten Lebensjahr. Sein Tod war wie der Cäsars von Naturphänomenen begleitet, die als Wunderzeichen gedeutet wurden. Ein unerhörter Sturmwind raste über Florenz, der Blitz schlug ein Stück der Domkuppel herunter, die Löwen, die auf Staatskosten gehalten wurden, zerfleischten sich gegenseitig, man wollte Stimmen in den Lüften gehört haben, ein leuchtender Feuerstreif stand unbeweglich über Careggi und erlosch, als Lorenzo den Geist aushauchte.
Kaum war der Damm zerrissen, der den allgemeinen Hader so lange zurückgestaut hatte, so war es, als sollte das Chaos hereinbrechen. Piero wirtschaftete in den Tag hinein, ohne auf die letzten Ermahnungen seines Vaters und auf die Zeichen der Zeit zu achten; nach innen gewaltsam, nach außen zweideutig, stellte er die politischen Traditionen seines Hauses geradezu auf den Kopf. Die entzweiten Fürsten Italiens riefen zu ihrem Unheil französische Waffen herbei, dazwischen donnerte Savonarola und kündigte den Anfang vom Ende an. Die Beängstigung ward allgemein, Lorenzos Freunde starben rasch im Kummer weg, die Ueberlebenden klammerten sich an Savonarola. Seltsame Visionen schreckten auch unbeteiligte Zuschauer. Einem harmlosen Musiker an Pieros Hofe erschien bei Nacht der tote Lorenzo mit schmerzverstörtem Gesicht und schwarzen zerrissenen Gewändern, durch welche die Haut schimmerte, und befahl ihm, seinem Sohne Piero zu sagen, sein Sturz sei nahe, bald werde er von Florenz vertrieben sein, um nicht zurückzukehren. Der Mann, der die Lebenden offenbar noch mehr fürchtete als die Toten, wollte trotz Michelangelos dringendem Zuspruch nicht reden. Da erschien ihm die Gestalt zum zweitenmal, gab ihm zum Beweis ihres Daseins einen heftigen Schlag ins Gesicht und wiederholte den Befehl. Jetzt rannte der arme Musikus sinnlos vor Schreck nach Careggi, um den Gebieter zu suchen, der ihm unterwegs mit seinem Gefolge entgegengeritten kam. Piero hörte die Geschichte an und fand sie spaßhaft; die ganze Gesellschaft lachte den Geisterseher aus. – Michelangelo floh entsetzt aus dem Hause, das er dem Untergang verfallen sah.
Kaum ein paar Wochen vergingen, so war die Prophezeiung des Traumgesichts erfüllt. Piero mußte aus seiner Vaterstadt flüchten, um in der Fremde zu sterben, seine Brüder und Freunde irrten im Exil. Florenz ward ein Gottesstaat mit Jesus Christus als Gonfaloniere. Auf der Piazza gingen die Eitelkeiten der Welt[7], darunter unschätzbare Kunstwerke und ein Teil von Lorenzos herrlicher Büchersammlung, der seine letzte Sorge gegolten hatte, in Rauch und Flammen auf. Freilich sollte der Brand, den er entfacht hatte, am Ende den Propheten mit verzehren.
Als die Toskana nach unendlichen Nöten schließlich unter einer mediceischen Dynastie die Ruhe wiederfand, da war Florenz nicht mehr die Heimat der Freiheit und der Kunst. Der Stamm des großen Lorenzo war durch Verwandtenmord ausgetilgt, ein anderer Zweig der Familie Medici hielt das Scepter in Händen, der seinen Ursprung von dem Bruder des alten Cosimo ableitete und mit Eifersucht auf den Ruhm seiner großen Vorgänger sah. Mit Hofceremoniell und Maitressenkabalen beschäftigt, hatte er keine Zeit, dem Größten, der den Namen Medici geführt hat, eine würdige Ruhestatt zu schaffen.
Auch jetzt soll nur eine schlichte Inschrift im Stein die Stelle kenntlich machen, die die Reste des erlauchten Brüderpaares birgt – eine weise Enthaltung, denn welcher Schmuck vermöchte Den zu ehren, dessen Denkmal unvergänglich in der Kulturgeschichte der Menschheit aufgerichtet steht!
Karl Thiessens Brautfahrt.
(Fortsetzung.)
Wie es zngegangen war, daß das Gerücht von Karl Thiessens Heiratsabsichten und seinem Retourbillet in der ganzen Stadt herum kam, das weiß heute noch niemand zu sagen. Sicher ist aber, daß nie so viel Kaffeegesellschaften gegeben wurden wie in den nächsten Wochen, und daß auf jeder dieser Kaffeegesellschaften der Reichtum des wiedergekehrten Stadtkindes, die glänzende Aussteuer, die er, wie man wissen wollte, zum großen Teil schon beschafft hatte, noch um ein Beträchtliches wuchs, so daß Karl Thiessen auf die bequemste Art von der Welt zum Millionär gemacht wurde.
Die Beliebtheit und Bedeutung der Tante Verwalterin stieg damals zu schwindelnder Höhe. Sie wußte sich gar keinen Rat mehr vor den Einladungen und Liebenswürdigkeiten ihrer Mitbürger; täglich mehrmals guckte irgend ein niedliches Mädchengesicht bei ihr ein, brachte ein paar Blumen oder einen seltenen Pflanzenableger für den Garten oder bat um ein Rezept zu dem und jenem Gebäck, zu dieser und jener Pastete. Letzteres war ein besonders sicheres Mittel, bei der alten Dame in Gunst zu kommen.
Diese zeigte sich aber sehr reserviert und verschlossen; sie gab weder über ihre noch über ihres Neffen Absichten und Aussichten irgend welchen Aufschluß und spann nur, wie eine brave gutmütige alte Spinne, ihre Fäden nach allen Seiten, so daß Karl Thiessen sich bald mitten in diesem Netze fand und nur noch die Qual der Wahl zu haben brauchte, die bekanntlich nicht immer die leichteste ist, und nun gar in solcher Kardinal- und Lebensfrage.
Unter den Häusern welche die Frau Verwalterin für ihrem Heiratskandidaten im Auge hatte, war in erster Linie das des Steuerrats Dierks. Der brave Mann erfreute sich einer angesehenen Stellung unter seinen Mitbürgern und eines ganz netten Vermögens – allerdings hatte bei ihm, wie er zu sagen pflegte, der Thaler nur zehn Groschen, da er sich des Besitzes dreier Töchter zu rühmen wußte.
Bei diesem Herrn Steuerrat hieß es nun mit vollem Recht wie in dem schönen alten Märchen: „Er hatte drei Töchter, und die jüngste war die schönste von allen!“
Diese jüngste war, ihres bildhübschen Gesichtchens wegen, das Wunder der ganzen Stadt; sie hatte krause, aschblonde Haare, die fast wie leicht gepudert aussahen, und in reizvollem Gegensatz dazu zwei große schwarze Augen, denen ein mehr begeisterter als poetischer Verehrer den kühnen Vergleich gewidmet hatte: „Steuerrats Sabinchen hat ein Paar Augen wie zwei Tassen schwarzer Kaffee!“
Wenn nun im Märchen aber die Schönste und Jüngste auch immer die Beste, Klügste uud Fleißigste ist, so pflegt das in der Wirklichkeit nicht allemal zu stimmen.
Das hübsche Sabinchen – oder Binchen, wie sie allgemein genannt wurde – war gerade ihrer Schönheit wegen von Kindheit an etwas sehr verzogen, für jede Arbeit zu gut und zu fein und zu zierlich angesehen und vom ganzen Hause als Prinzeßchen behandelt worden, das sich von seinen braven gutmütigen und auch gar nicht häßlichen Schwedtern, mit Selbstverständlichkeit bedienen ließ, und für das Mama und Papa Steuerrat einmal auch so was Aehnliches wie einen Prinzen als Eidam erwarteten und erträumten.
Eine von Binchens Schwestern, Klara mit Namen, erfreute sich der besonderen Protektion der Frau Verwalterin. Sie hatte bei ihr einen kleinen Kursus in der feineren und feinsten Kochkunst durchgemacht und sich dabei in hohem Grade anstellig gezeigt: sie kochte Aepfelgelee von Fallobst fast so klar und goldhell wie ihre alte Meisterin selber – und sie war das, was man so im guten Sinne ein resolutes Frauenzimmer nennt, dem man auch zutraut, daß es wohl im fremden Lande deutscher Küche, deutscher Tüchtigkeit und – deutscher Zunge Respekt zu verschaffen wissen werde.
Diese Perle des weiblichen Geschlechts ihrem Neffen zuzuwenden, hatte die Frau Verwalterin in ihrem Sinn beschlossen. Heute, an einem warmen schönen Septemberabend, wollte sie, ganz eigens zu diesem Zwecke, eine kleine Fete geben, zu welcher sie eben nach ihrer appetitlichsten Art, die schneeweiße Latzschürze vorgesteckt, einen rosig glänzenden Krabbensalat zurechtmachte und sonstige verlockende Vorbereitungen traf. –
[869]
[870] Sie hatte dieses kleine Fest mit besonderer Verschmitztheit ausgedacht und angeordnet. Nur Klara dazu einzuladen, wäre doch in diesem zarten Fall nicht angegangen – man durfte es auch nicht zu durchsichtig machen! Also war Klara mitsamt der Mama Steuerrätin – oder um den schuldigen Respekt nicht zu verletzen, die Mama Steuerrätin mitsamt Klara befohlen worden, und damit doch noch ein junges Mädchen dabei wäre, hatte die Frau Verwaltern Anna Braun dazu gebeten. Die störte nie, sondern erschien und verschwand wie ein kleiner stiller Hausgeist, wenn man sie haben wollte und nicht haben wollte!
Ach, die gute Verwalterin, sonst so bewandert und scharfsinnig in Herzenssachen, ahnte nicht, was sie mit dieser Einladung anrichtete. Sie sah nicht, wie Annchen Braun, die sonst nie Eitle, wohl eine Stunde lang vor dem Spiegel stand und ihre dicken braunen Zöpfe – ihre einzige, wirkliche Schönheit – flocht umd hochsteckte uud wieder tief steckte und mit zitternden Händen in ihrem schmalen Kofferchen suchte nach irgend etwas, was sie putzen und schmücken könnte. Schließlich hatte sie mit einem kleinen Seufzer vor sich hin gesagt: „Es ist ja doch alles einerlei!“ und sich damit begnügt, ihr sorgfältig gehütetes Einsegnungskleid anzuziehen und sich ein paar blasse Astern vorzustecken – auch das kam ihr schon beinahe gewagt vor. –
Der Abend verlief bisher ganz programmmäßig – für den eingeweihten Beobachter sehr belustigend und komisch.
Die Frau Steuerrätin, sich der Wichagkeit der ganzen Sache wohl bewußt, trat in malvenfarbiger Seide an, mit einer Brosche von der Größe einer mäßigen Bratenschüssel und einer Miene, als wenn sie soeben von Reichs- und Staatswegen schon zur Schwiegermutter ernannt worden wäre.
Klara, in rosa Barege, die Haare nach damaliger Mode in ein rosa Netz mit rosa Seidenrüsche gefangen, marschierte in zitternder Erwartung hinter ihr her, und beide machten, als Karl Thiessen eintrat – auch sehr fein, in dunkelblauem Leibrock und weißer Kravatte – die verlegen unbefangensten Gesichter, die man sich nur denken kann.
Karl Thiessen war wirklich unbefangen. Ihm waren in den letzten vierzehn Tagen so viel junge Mädchen von der Tante Verwalterin vorgestellt worden, unter allerlei wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Vorwänden, daß es ihm auf eine mehr oder weniger nicht weiter ankommen konnte, und da er der ganzen Sache naturgemäß nicht als poetischer Liebhaber, sondern als Mann, der eine Frau sucht, gegenüber stand, so verbeugte er sich denn mit dem harmlosesten und vergnügtesten Gesicht von der Welt vor der netten Klara, ja, er dachte sogar flüchtig bei sich: „Das wäre am Ende etwas!“ – eine Seelenregung, die der Tante Verwalterin nicht entging, da sie es sich zur Aufgabe gestellt hatte, sein Mienenspiel bei dergleichen Anlässen scharf zu beobachten und ihre Schlüsse zu ziehen. Daß im Hintergrunde des Zimmers noch Anna Braun stand, die sich die erdenklichste Mühe gab, nicht rot und nicht weiß zu werden, das merkte Karl erst etwas später und schüttelte ihr kräftig die Hand mit einem „Guten Abend, Annchen!“ wie es sich so für Jugendbekannte uud Gespielen aus alter Zeit gehörte. Dann setzte er sich zu Klara und fing an, allerlei lustige Geschichten und Schnurren von seiner chinesischen Heimat und deren Bewohnern zu erzählen, so daß die Zuhörer gar nicht aus dem Lachen kamen.
Die Sache ließ sich gut an!
Die Frau Verwalterin fühlte einen dumpfen Schmerz bei dem Gedanken, daß sie jetzt durch den Ruf: „Nun bitte, zu Tisch!“ das erblühende Glück stören mußte. Sie kämpfte ordentlich mit sich. – Aber noch fünf Minuten, dann mußte die Kalbskeule aller menschlichen Berechnung nach zu sehr „durch“ sein – und das konnte die gute Frau unter keinen, auch den dringlichsten Verhältnissen nicht auf sich sitzen lassen.
Ehe noch dieser innerliche Kampf zwischen Liebe und Pflicht seine Entscheidung gefunden hatte, ging draußen die Hausklingel ganz zierlich und schnell – man hörte ein silberhelles Kichern und Lachen – und mit den Worten: „Liebe Frau Verwalterin, wollen Sie einen ungebetenen Gast noch aufnehmen?“ öffnete sich die Zimmerthür, und im weißen Mullkleidchen einen Strauß brennend roter Kresse vorgesteckt, flog Steuerrats Bincheu herein in die Gesellschaft – und nun war die Bescherung fertig!
Auf die Gefahr hin, meine Frau Verwalterin in den Ruf einer ungastlichen Person zu bringen, den sie wahrhaftig nicht verdient – von der Größe der vorerwähnten Kalbskeule ganz abgesehen, die noch zehn ungebetene Gäste hätte satt machen können – auf diese Gefahr hin also muß ich sagen, daß sie kein sehr freundliches Gesicht machte, als das reizende Mädchen so hereingeschneit kam.
Die hatte sie ihrem Karl eigentlich gar nicht zeigen wollen; denn daß sie ihm gefallen würde, wie die Männer nun einmal sind, denen das bißche Rot und Weiß, ein zierliches Stumpfnäschen und ein Paar großer Augen den Kopf verdrehen – das konnte man sich ja an den zehn Fingern abklavieren!
Und sie sollte ihm nicht gefallen!
Steuerrats Binchen, die nichts weniger war als ein Bienchen an Fleiß, die nur surren und von einer Blume zur andern fliegen und je nachdem auch ein bißchen stechen konnte – die wollte sie nicht für ihren Karl! Und nun mußte sie es erleben, daß dieser selbe Karl, sobald es sich mit irgend welchem Anstand thun ließ, seinen Platz verließ und sich neben die kleine Schönheit setzte – daß er ihr alle die komischen Geschichten von China weiter erzählte, daß er nach den ersten zwanzig Minuten kaum mißzuverstehende Anspielungen darauf machte, wie gut es eine deutsche Frau – und ganz besonders seine Frau dort haben würde – kurz, daß er sich sterblich in das Binchen verliebte, und daß dieses that, als merkte es seine Eroberung und seinen Triumph gar nicht, aber dabei ganz im stillen ein paarmal einen Blick nach Mutter und Schwester warf, der ziemlich deutlich sagte und sagen sollte: „Seht Ihr wohl?“
Die gutmütige Klara, schon daran gewöhnt, daß ihr das schöne Nesthäkchen die besten Bissen vor dem Munde wegschnappte, sah still uud ein bißchen säuerlich auf ihren Teller nieder. Die Frau Steuerrätin, mit dem nicht unberechtigten Gefühl: „Na, es bleibt ja in der Familie!“ ließ der Sache ihren Lauf, und die Verwalterin nötigte mit rotem Kopf zum Essen und zum Trinken. – Und Annchen Braun? Ach, das arme Kind leerte an diesem heutigen Abend den Kelch der Bitterkeit bis zum letzten, bittersten Tropfen, wenn sie Karls strahlendes Gesicht sah uud seine lustige Stimme hörte – und noch mehr, wenn sie Steuerrats Binchen in ihrer ganzen morgenfrischen Lieblichkeit durch die gesenkten Wimpern hindurch beobachtete und dann immer leise zu sich selbst sagte: „Ja – die freilich!“
Der Abend wollte gar kein Ende nehmen! Als man vom Tisch aufgestanden war, lustwandelte die Jugend noch in dem Garten, und die beiden alten Damen saßen bis in die tiefe Nacht hinein als Opfer der Verhältnisse nebeneinander auf dem Sofa, gähnten erst verstohlen und nach und nach sehr offenherzig und strickten wie ums liebe Brot. Die Frau Verwalterin, die beim Anfang des Festes erst „beim Abnehmen“ gewesen war, konstatierte dann später bei sich – als einziges befriedigendes Resultat der Festlichkeit: „Wenigstens habe ich dreiviertel von meinem Strumpf fertig gestrickt.“
Draußen im Garten promenierten inzwischen die beiden Paare, nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit gruppiert. Anna und Klara in anfallsweisen Gesprächen matten Inhalts voran – beide immer die Ohren gespitzt nach den zwei andern hin.
Karl und Binchen schritten zwischen den Rabatten des kleinen Gärtchens – immer um das Rasenrondell herum – „zum Schwindligwerden!“ bemerkte Klara ein bißchen giftig, was ihr, angesichts der Sachlage und ihres Standpunkts dazu, kein billig Denkender verargen wird.
Endlich hielt die Mama Steuerrätin die schweren Augen nicht mehr auf, sie holte sich ihre Lämmer von der Weide und ging, sehr befriedigten Mutterherzens, mit ihnen davon. Eine von ihnen würde es nun also doch sein, die den ausländischen Goldfisch davontrüge! Karl Thiessen begleitete die Damen natürlich ritterlich heim und pfiff auf dem Rückweg ganz sentimental vor sich hin: „Ach, wie ist’s möglich dann, daß ich dich lassen kann!“ daher der scharfsinnige Leser sich schon einen Rückschluß auf den inneren Zustand unseres Helden gestatten kann.
Anna Braun huschte ungeleitet und unbehelligt nach Hause und schrieb noch bis in die tiefe Nacht hinein, mit fliegender Feder und fliegendem Herzschlag, Annoncen für die verschiedensten Tagesblätter, in denen ein junges Mädchen Stellung zur Erziehung jüngerer Kinder suchte – aber sofort – dies dreimal unterstrichen.
„Denn hier bleibe kann ich nicht – ich kann nicht!“ sagte sie vor sich hin, als sie die Lampe auslöschte.
Nun, die Sache kam, wie sie kommen mußte! Wir wissen ja, daß Karl Thiessen, in Rücksicht auf sein Retourbillet, nicht viel Zeit hatte, sich seine Freierei zu überlegen – und so gingen denn nicht [871] mehr als vierzehn Tage ins Land, bis die freudige Angelegenheit in schönste Ordnung kam und goldgeränderte Verlobungskarten in jedem Hause zu finden waren, auf denen sich Karl Thiessen und Steuerrats Binchen als Verlobte dem allgemeinen Wohlwollen und dem allgemeinen Klatsch bestens empfahlen.
Steuerrats hatten zunächst, trotz aller Einverstandenheit mit der Geschichte, etwas gejammert, daß sie ihr Binchen, den Schmuck und das Krönchen ihres Hauses, überhaupt weg– und nun gar bis nach China geben sollten. Aber mitziehen konnten sie nun mal nicht, da der Papa Steuerrat sich auf seine alten Tage nicht mehr entschlossen haben würde, einen Zopf zu tragen, und so fanden sie sich in die an sich ja sehr erfreuliche Thatsache, und Binchen wurde, um der baldigen Trennung und der glänzenden Heirat willen, noch ein bißchen mehr verzogen als bisher, insofern das überhaupt möglich war.
Daß es das schöne Binchen verstehen würde, eine reiche Frau zu sein, das konnte bald ein Blinder mit dem Stocke fühlen, wie man so zu sagen pflegt.
Sie nahm alle die schönen fremdländischen und inländischen Geschenke, mit denen der Bräutigam sie überschüttete, so selbstverständlich hin, als wenn sie eigentlich noch viel anderes erwartet hätte. Sie bestand schon gleich zu Anfang darauf, daß man den ersten Lohnwagen der Stadt nahm und die Brautvisiten im Fahren zurücklegte, statt, wie es Karl gern gethan hätte, nachbarlich und freundschaftlich von Haus zu Haus zu gehen, so daß er sein schönes Bräutchen in den Strahlen der Herbstsonne und des Glückes hätte bewundern lassen können.
Auch bei Annchen Braun hatte das junge, fröhliche Paar seinen Besuch abgestattet. Sabine rümpfte zwar erst das Näschen bei dem Gedanken, in die bescheidene Dachkammer hinaufsteigen zu sollen, die die kleine Lehrerin innehatte – aber Karl, mit nicht ganz richtiger Beurteilung der Sachlage, bemerkte: „Wir wollen das gute Mädchen doch nicht auslassen – sie freut sich mit an unserm Glück und ist meine alte Jugendbekannte.“
Da hatte denn Binchen nachgegeben – im ganzen ein äußerst seltener Fall, der ihr denn auch von Karl mit doppelter Anbetung gelohnt wurde.
So stiegen die beiden hübschen glücklichen Menschen die enge Treppe hinauf und betraten das Stübchen, das Anna Braun bewohnte und in dem sie, als einzigen Schmuck, einen schönen Rosenstock pflegte, der eben in Blüte stand.
„Nun, Annchen, hier bringe ich Ihnen meine kleine Braut!“ hatte Karl in seiner herzlichen Weise gesagt, und Anna hatte ihm tapfer die Hand gedrückt und sie auch Binchen gegeben. „Gott segne Sie alle beide!“ sagte sie, und dann wandte sie sich rasch zum Fenster und pflückte die beiden schönsten Rosen von ihrem Rosenstocke ab. „Wollen Sie dies von mir annehmen?“
Binchen steckte mit einem leichten Nicken die Rose in den Gürtel ihres weißen Kleides und lächelte ein wenig dazu.
„Ein bißchen sehr gefühlvoll!“ sagte sie dann noch auf der Treppe zu ihrem Bräutigam, „hat sie Dich etwa selber gern gewollt?“
Karl Thiessen öffnete die Augen sehr weit. „Anna Braun? – mich? – ach, warum nicht gar!“ sagte er und erwies sich damit als vorzüglichen Beobachter und Menschenkenner. Dann lachte er laut und harmlos auf über den sonderbaren Gedanken – so gingen sie davon. – Und Anna Braun stand am Fenster und sah dem schönen Paar nach. „Der liebe Gott hat es also doch nicht gewollt!“ sagte sie einfach vor sich hin – dann ging sie zu ihrem Rosenstock und rückte ihn in die Sonne.
Karl Thiessens Brautzeit stand im ganzen und großen auch in der Sonne. Er war begeistert von Binchens Schönheit, Heiterkeit und Anmut. Er freute sich, sie mit Geschenken, mit golddurchwirkten Shawls und Seidenstoffen aus dem fernen China zu überschütten und zu schmücken, die ihr kindisches Entzücken erregten – und er freute sich darauf, „drüben“ mit ihr Staat zu machen, wie man zu sagen pflegt.
Aber manches kam doch auch so nach und nach zu Tage, was ihn, den Mann der gesunden Vernunft, veranlaßte und aufforderte, sich ganz bedeutend hinter den Ohren zu kratzen. Er wollte sich, wie er sattsam ausgesprochen und betont hatte, eine deutsche Hausfrau mitnehmen, und das zu sein oder zu werden, dazu hatte Binchen vorläufig verzweifelt wenig Lust oder Anlage.
Niemals sah man sie mit einem Strickzeug oder einer Näherei beschäftigt, sie stickte höchstens, nach damaliger schrecklicher Mode, Rosenbouquets auf Pantoffeln für ihren Zukünftigen oder nähte Perlen auf einen Ofenschirm – die Arbeiten ließ sie dann auch noch meist unvollendet liegen, bis die gutmütige Klara sie ihr heimlich fertig machte. Sie lag des Vormittags im Lehnstuhl und las Romane und ging des Nachmittags mit ihrem Bräutigam spazieren, worauf sie natürlich am Abend zu müde war, um die Hände noch besonders zu rühren.
Lobte Karl Thiessen einmal ein besonders gelungenes Gericht der schwiegerelterlichen Tafel – und wir wissen ja, daß Klara bei der Frau Verwalterin kochen gelernt hatte, können uns also denken, daß alles, was der Bräutigam zu kosten bekam, von erster Trefflichkeit war – lobte er also, wie gesagt, einmal die oder jene Speise und fragte dabei: „Hat Binchen das gekocht?“ dann begegnete er allenthalben lächelnder Verwunderung und mußte hören: „Binchen? Die braucht doch nicht zu kochen – sie wird ja eine reiche Frau!“
Als diese Bemerkung wieder einmal gefallen war – man saß noch am abendlichen Theetisch im Wohnzimmer beisammen – da faßte sich Karl Thiessen ein Herz und sagte mit einiger Bestimmtheit: „Liebe Schwiegermutter, mir scheint es besser, wenn ich einen kleinen Irrtum aufkläre!“
Die Frau Steuerrätin setzte sich in Positur – den Ton kannte sie ja noch gar nicht an ihrem zukünftigen Eidam.
„Sie sagen immer,“ fuhr Karl, zuerst etwas langsam, dann aber um so energischer fort, „Binchen braucht dies nicht im Hause zu thun und jenes nicht im Hause zu lernen – sie wird eine reiche Frau. Erstens muß eine reiche Frau sich auch um ihr Haus kümmern und die Küche verstehen, wenn sie nicht nur eine reiche, sondern auch eine rechte Frau sein will. Meine Frau soll es wenigstens ganz gewiß thun! Und dann – was man reich nennt, das bin ich doch gar nicht. Das möchte ich Ihnen ausdrücklich sagen! Ich habe ein sehr glänzendes Auskommen und kann es, mit Gottes Segen und gutem Glück, noch ’mal zu was bringen – aber doch immer erst mit der Zeit. – Ich habe von Hause aus gar kein Vermögen in meine Stellung mitgebracht, und daß man in sechs bis acht Jahren nicht vom armen Schlucker zum reichen Mann wird, wenn man es redlich anfängt, das wissen Sie wohl selber!“
Er hielt nach dieser kleinen Predigt inne und schöpfte tief Atem; es hatte auch niemand Miene gemacht, ihn zu unterbrechen.
Das schwiegermütterliche Antlitz war bei seinen Worten so lang geworden, als besähe sich die Eigentümerin in einem blanken Eßlöffel. Sie erwiderte kein Wort, sondern sah nur mit bedeutungsvoller Miene nach ihrem Mann hin, wobei sich ihre Nase spitzte wie der beste Faberbleistift.
Der Herr Steuerrat, seiner Pflicht als Hausherr und Vater eingedenk, sagte kein Wort, sondern hustete nur. Binchen schwieg auch und sah vor sich nieder; ein kleiner verdrießlicher Schatten auf ihrer weißen Stirn war Karl nicht entgangen.
Als man die unter solchen Umständen nicht allzu muntere Abendmahlzeit aufgehoben hatte und vom Tisch aufgestanden war, zog Karl seine kleine Braut mit sich ans Fenster.
„Binchen, kann Dich denn das traurig machen, daß ich nicht nur ein Spielzeug an Dir haben will?“ frug er herzlich und eindringlich und hob ihr reizendes Gesichtchen am Kinn in die Höhe, „willst Du nicht mir zuliebe Dich von morgen an ein bißchen um Haus und Küche kümmern? Deine Schwestern thun das ja doch auch, und wie freut sich Klara, wenn es uns allen schmeckt und sie kann sagen: ,Die Mehlspeise habe ich angerührt!‘ Nicht wahr?“
Binchen machte sich unwillig los.
„Nun, dann hättest Du Dir ja eine von den Schwestern aussuchen können, wenn sie Dir besser gefallen,“ sagte sie im Ton eines unartigen Kindes. „Um mich zu plagen und zu quälen, brauche ich nicht nach China zu gehen. Das kann ich hier auch thun, wenn ich Lust habe. Und ich habe keine Lust! Du hast doch immer gesagt, Du wolltest mich auf Händen tragen!“ fügte sie weinerlich hinzu.
„Und das will ich auch,“ sagte Karl fest, „das will ich ganz gewiß! Aber Du mußt Dich doch auch darauf vorbereiten, daß Du gehen kannst, wenn ich ’mal nicht da bin, um Dich zu tragen. Gerade dort in der Fremde muß eine Hausfrau doppelt am Platz und früh und spät auf den Füßen sein – siehst Du denn das nicht ein?“
Sie schüttelte stumm den Kopf und sah vor sich nieder, während sie mit dem zierlichen Füßchen das Muster des Teppichs nachzuzeichnen versuchte.
[872] „Nun, dann will ich heut’ abend nur gehen!“ sagte Karl mit etwas gepreßter Stimme und griff nach seinem Hut. „Du wirst, ja wohl bis morgen wieder zur Vernunft kommen. Grüße die Eltern!“
Damit ging er seiner Wege, ohne sich noch viel umzuschauen – es rief ihn auch niemand zurück.
Es war ein wundervoller Herbstabend, dunkel und warm, wie sie der Oktober manchmal bringt, und Karl fühlte, sich unvermögend jetzt, wo es doch gewaltig in ihm stürmte, allein zu Hause zu sitzen! Ebensowenig aber verlockte ihn der Gedanke, in eine dumpfige Bierstube einzukehren und über Stadtgeklatsch und Politik zu sprechen – Nebenbei auch wohl neugierig gefragt zu werden: „Nun, warum denn heut’ abend nicht bei der Braut?“
Halb unbewußt lenkte er seine Schritte nach dem Hause der Tante Verwalterin, die er naturgemäß seit seiner Verlobung viel seltner besucht hatte. Näher kommend, glaubte er leise Musik zu hören.
Er klinkte die Thür sachte auf – als Hausneffe und besonderer Liebling durfte er sich das schon erlauben – und trat in den Gartensaal zu ebener Erde, in dem ein kleines uraltes Spinett stand.
Es war dunkel in dem Zimmer, bis auf den Vollmondschein, der eben hereinfiel und den Schatten des Fensterkreuzes scharf und schwarz auf den weißen Fußboden zeichnete.
Die Frau Verwalterin saß, wie gewöhnlich um diese Zeit, im Sofa und strickte – er machte ihr mit der Hand ein Zeichen, sich nicht zu rühren. An dem kleinen Instrument saß Anna Braun und sang ein einfaches Volkslied. Karl Thiessen gehörte zu den Menschen, denen, ohne selbst ausübend musikalisch zu sein, Musik Lebensluft ist – er hatte es schon oft wahrhaft schmerzlich empfunden, daß seine Braut nicht spielte und nicht sang, und er versenkte sich mit doppeltem Vergnügen in den lang entbehrten Genuß.
Ohne daß Anna sein Eintreten bemerkt hätte, ließ er sich hinter ihr am offenen Fenster nieder, stützte den Kopf in die Hand und hörte zu, wie sie sang – ein deutsches Lied nach dem andern – die alten Worte und Melodien, die er in seinen schmerzlichsten Heimwehstunden in der Fremde vor sich hin gesummt und nach denen er sich gesehnt hatte. In seine heutige erregte, halb traurige, halb zornige Stimmung fielen die schlichten Töne wie kühlender Tau hinein. Der Mondstrahl, der immer weiter rückte, jetzt den dunkeln Kopf des Mädchens hell beleuchtete und auf ihren schmalen Händen schimmerte, schien wie mit einem Finger auf sie zu weisen und an ihn die Frage zu richten: „Hast du dir die denn noch nie recht angesehen?“
„Ja, wer so was alle Tage hören könnte,“ sprach er plötzlich, Zeit und Ort vergessend laut vor sich hin und Anna sprang, aufs tiefste erschrocken, vom Klavier auf und stand in mädchenhafter Verlegenheit im Mondschein vor ihm.
„Ich’ habe Sie gar nicht kommen hören!“ Mehr brachte sie nicht heraus, während die alte Frau Verwalterin schon mit dem Streichhölzchen kratzte, um die Lampe anzuzünden.
Aber Karl legte. hastig seine Hand auf die ihre.
„Ach bitte, Tante – noch kein Licht!“ sagte er eindringlich, „singen Sie uns noch ein paar von Ihren Liedern, Fräulein Anna! – so ein recht bewegliches, weichherziges – können Sie denn nicht mein Lieblingslied singen: ‚Ach, wie ist’s möglich dann, daß ich dich lassen kann!‘?“
„Nein!“ sagte Anna, so rasch und hart, daß er erstaunt aufblickte, „nein, das kann ich nicht singen – wahrhaftig nicht, Herr Thiessen!“
„Nun dann ein anderes,“ meinte die Verwalterin unbefangen, „sing’ uns das vom ,kühlen Grunde‘, Annchen – das ist ja auch hübsch.“
Und als Anna noch eine Weile gesungen hatte und leise den Deckel des Spinetts schloß, da stand Karl auch auf. „Ich darf Sie wohl nach Hause bringen, Fräulein Anna,“ sagte er „wir haben ja einen Weg.“
Während Anna, ohne viele Worte zu machen, nach ihrem Hut und Tuch ging, trat die Verwalterin zu ihrem Neffen und legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Nun, Karl, was hat’s denn gegeben?“
„Ach, nichts!“ sagte er halb verlegen und halb verdrießlich, „ich habe mich ein bißchen geärgert – das ist alles – nicht der Rede wert, Tante – wirklich nicht der Rede wert.“
Die alte gute Frau sah aufmerksam in sein blasses Gesicht.
„Mein lieber Junge!“ sagte sie zärtlich und schaute ein wenig sorgenvoll hinter ihm her. (Schluß folgt.)
Erinnerungen an Leopold v. Ranke.
Der hundertste Geburtstag Leopold v. Rankes belebt aufs neue rings im Vaterlande die Erinnerung an unseren größten Geschichtschreiber; er lenkt zugleich unseren Blick dem fruchtbaren Thüringer Thale zu, wo im Vaterhause zu Wiehe in der gedeihlichen Stille der Jahre nach dem Baseler Frieden das kindliche Gemüt mit der Luft der Heimat für immer jene heitere, milde Stimmung eingesogen hat, die aus allen Werken des weltumfassenden Historikers so vernehmlich zu uns redet. Vom Kyffhäuser fließt die Unstrut stundenweit zwischen Finne und Querfurter Hochebene langsam bis Memleben, wo sie nahe den Trümmern der Abtei ottonischen Angedenkens sich den Einlaß in die Flanke des Orlas gebrochen hat. Bis dahin erfüllen den Grund die feuchten Wiesen des Rieds, reiche Felder ziehen an den Gehängen zum Laubwald der Höhen hinauf. Auch die Ortschaften, mehrere Dörfer und das Städtchen Wiehe selbst, ein paar Schlösser, Burgen und Klöster, in Schulen verwandelt, erheben sich beiderseits über die Sohle des Thals und bieten in leichter Abwechslung die gleiche freundliche Rundsicht. Verwöhnte Reisende, wie Gotthilf Heinrich v. Schubert und König Friedrich Wilhelm IV., haben die Vorzüge dieser blühenden, Frieden atmenden Landschaft willig anerkannt; Leopold v. Ranke hat sie noch als Greis mit dem alten liebevollen Einverständnis wieder aufgesucht. Neben der sittlichen Zucht des Elternhauses darf man dieser erquickenden Umgebung den entschiedensten Einfluß auf die reine und glückliche Ausbildung seines Wesens zuschreiben.
Rankes Großvater, einer lutherischen Pastorenfamilie im Mansfeldschen entstammt, war als Pfarrer nach Ritteburg an der Unstrut versetzt worden; dort führte er ein Fräulein aus Hechendorf bei Wiehe heim, die in diesem Landstädtchen Haus und Grundbesitz ererbte. Letzterer, heute noch „Rankes Berg“ genannt, zieht sich südlich von Wiehe am Abhang der Finne empor und gewährt einen anmutigen Ausblick über die an geschichtlichen und sagenhaften Erinnerungen reiche Gegend. Drunten vorn Wiehe, links unweit davon das als Vorwerk zu Schulpforta gehörige Hechendorf, ehemals Cisterzienserkloster; weiter oberhalb, eine Stunde entfernt, Kloster Donndorf, wo Ranke vom zwölften bis ins vierzehnte Jahr den ersten gelehrten Unterricht empfing, ehe er nach Pforta kam. Gegenüber, jenseit des Rieds, das ebenfalls als Klosterschule namhafte Roßleben; rechts abwärts, vorm Orlas, Memleben, in seinen Ruinen ehrwürdig als Sterbestätte König Heinrichs I. und seines Sohnes, Kaiser Ottos des Großen. Steigt man von Rankes Berg weiter südlich in die Wälder hinauf, so trifft man [873] bald auf die ansehnlichen Trümmer der Burg Rabinswalde, einer Feste der sächsischen Kaiserzeit, später Sitz eines Grafenhauses, an das sich phantastische Erzählungen knüpfen.
In Rankes Berg selbst aber ragt zwischen jüngeren Obstbäumen, die zum Teil Leopolds Vater, Justizkommissar der Freiherren v. Werthern in Wiehe, gepflanzt, ein uralter riesiger Birnbaum empor, in seinem Ursprung noch auf die Cisterzienser von Hechendorf zurückgeführt, mit knorrigem Geäst, weitschattend, bewundernswürdig in seiner zähen Lebenskraft, ein Wahrzeichen der Umgegend, wie der Birnbaum in „Hermann und Dorothea“. Er spielt in Rankes Kindheitserinnerungen die gebührende Rolle, und bei seinen Ferienbesuchen bis an den Tod der Eltern in seinem einundvierzigsten Jahr hat er ihn unzähligemal fröhlich und sinnig wiederbegrüßt; so gut wie das schlichte Vaterhaus an der Straßenecke zu Wiehe, von dem er als alter Herr so rührend einfach erzählt: „In der Gasse neben dem Hause lagen Bauhölzer, auf denen bin ich oft stundenlang auf und ab gegangen. Alles das, was ich gelesen hatte, arbeitete dann in meinem Gehirn, ich brütete über Gott und Welt. Geschrieben wurde nichts; kein Mensch fragte mich, was ich dachte, ich selbst vergaß es wieder.“ Für uns Großstädter von heute – welch ein altertümlicher Reiz in diesem Bilde!
Rankes Mutter war die Tochter eines Rittergutsbesitzers in Weidenthal bei Querfurt; dort im großväterlichen Hause hörte der Knabe, was er nie vergessen hat, eines Tages bei Tisch den damals die Welt erfüllenden Namen Napoleon erklären. Aber auch an altdeutschen Erinnerungen fehlt es dort oben so wenig wie im Thal. Am Fuße des weithin sichtbaren Schlosses der Grafen von Querfurt mit seinem gewaltigen Rundturm, dem „dicken Heinrich“ nach der volkstümlichen Bezeichnung, entspringt der „Braunsbrunnen“; er ist nach Bruno von Querfurt, dem ersten Apostel der heidnischen Preußen, benannt, und noch alljährlich hält bei der Reinigung des überwölbten Quells die Gemeinde Thaldorf ein feierliches Brunnenfest ab. Eine Stunde westlich von Querfurt liegt Schloß Lodersleben, dessen Namen man, wie den des zerstörten Klosters Lotharsburg unweit davon, mit dem Kaiser Lothar dem Sachsen in Verbindung bringt. Mit dem Gutsherrn von Lodersleben, Rittmeister von Kotze, vermählte sich Rankes Tochter Maximiliane – nach dem Paten, König Max II. von Bayern, Rankes Schüler und Freunde, so getauft; und das gab dem greisen Historiker, besonders nachdem er 1871 die Gattin verloren, Gelegenheit zu wiederholten Besuchen der lieben heimatlichen Fluren.
Auch der Park von Schloß Lodersleben aber rühmt sich eines mächtigen, uralten Baumes; es ist eine Kastanie von großartigem Umfang, die mit ihren auf den Boden reichenden Aesten ein erquickliches Ruheplätzchen umschirmt. Schon seit Jahrzehnten hat man die Last des Gezweigs durch Stangen und Bänder stützen und umklammern müssen. Dort nun weilte, ruhte, sann und träumte der alte Ranke besonders gern und dort hat er am Abend des 28. Juli 1876 dem Sekretär seines Schwiegersohns in beschaulicher Stimmung das beziehungsreiche Gespräch zwischen Birnbaum und Kastanie diktiert, das wir als erste kleine Reliquie zur Feier des Jubiläums unseren Lesern nach der Abschrift mitteilen, welche die „Gartenlaube“ jenem mit der Niederschrift Betrauten, dem jetzigen Bürgermeister Tänzel in Cölleda, verdankt:
„Birnbaum: Du gehörst mir an! denn ich habe gesehen, wie Deine Mutter Dich auf dem Arme trug und wie Du Deine Kindesaugen an dem Grün des Gebüsches um mich her weidetest; dann bist Du alle Jahr wieder gekommen bis in Dein hohes Alter und hast Deinen Besitz immer mit Freuden begrüßt.
Kastanie: Aber ich habe auch einen Anspruch auf Dich! denn in Deinem Alter bist Du regelmäßig wiedergekommen und hast Dich in meinem Schatten gelabt!
Birnbaum: Aber ich bin größer und älter, ein Wahrzeichen für die ganze Umgegend.
Kastanie: Ich bin mit meinen Aesten weiter ausgebreitet, wie so leicht kein anderes Gewächs Gottes, ich habe Männer aus weiter Ferne kommen sehen, um mich als ein Wunder der Natur anzuschauen.
Birnbaum: Ich gehörte einem alten Kloster Hechendorf an und bin durch die Mönche gesegnet.
Kastanie: Auch ich habe ein altes Kloster in der Nähe gehabt, ‚Lotharsburg‘; Du siehest noch die Ruinen.
Birnbaum: Aber bei mir hat das Deutsche Reich seinen Ursprung genommen; in der Ferne sehe ich Memleben; Heinrich der Finkler war mein Herr!
Kastanie: Ich habe mich des Kaisers Lothar zu rühmen, von dem manche Ortschaft ihren Namen erhalten hat; nicht weit von hier ist der Braunsbrunnen, von dem die erste Bekehrung Preußens ausgegangen ist.
Birnbaum: Ich glaube, zwischen Memleben und dem Braunsbrunnen hat Freundschaft bestanden.
Kastanie: Jawohl! mein Bruno war ein Freund Deiner Ottonen; und siehst Du nicht die schöne Burg, von welcher aus die Grafen von Querfurt weit und breit das Land beherrschten?
Birnbaum: Unfern von mir ist Rabinswalde, wohlbekannt in Sagen und Geschichte. Dein Turm auf dem Schloß erinnert durch seinen Namen an meinen Kaiser Heinrich. Aber wir wollen nicht weiter streiten – ich gehöre dem Vater an.
Kastanie: Aber ich der Tochter, die mehr Lebenskraft hat.
Birnbaum: Aber Du bist schon mit eisernen Stangen gestützt und wirst Dich nicht mehr lange halten.
Kastanie: Du bist an Deinem Abhang den Stürmen noch mehr ausgesetzt als ich.
Der Historiker: Wenn Ihr beide zusammenbrecht, wo wird dann mein Staub sein? (Mein Name vielleicht doch noch im Gedächtnis der Menschen.)“
[874] Wohl das Anziehendste an diesem überaus schlichten Phantasiegebilde des Augenblicks ist der persönliche Schluß. Die eingeklammerten Worte hat Ranke, als ihm der Schreiber das Diktat vorlegte, reuig gestrichen.
Man sieht, wie der Wunsch nach irdischer Unsterblichkeit seines Namens, die er durch rastlose Geistesarbeit so wohl verdient hat, zwar lebendig in ihm aufzuckt, aber sogleich wieder von einer an die Betrachtung des Allgemeinen, der Weltentwicklung im großen Und ganzen, gewöhnten Weisheit unterdrückt wird.
Sehr viel deutlicher treten Weltanschauung, reine und große Auffassung seines Berufs, allgemeine Gesinnung und persönliche Beziehung in dem folgenden wertvollen Dokumente zu Tage, das wir uns freuen, den Lesern zum erstenmal vorführen zu können.
Es ist ein Brief, den Leopold v. Ranke am 25. Mai 1873 von Berlin aus seinem jüngeren Sohn in die Feder diktiert hat; gerichtet an den älteren, der damals als junger Geistlicher bei den deutschen Occupationstruppen mit deren Befehlshaber, dem alten Freunde seines Vaters, General v. Manteuffel, vertrauten Umgang in Nancy gepflogen hatte. Das Buch, von dem die Rede ist, war der kurz zuvor von Ranke mit Erläuterungen herausgegebene „Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen“, dessen Inhalt in politisch fernstehenden Kreisen nicht durchweg Beifall gefunden hatte. Alles andere in dem herrlichen Schreiben Rankes bedarf keines weiteren Kommentars.
„Berlin, den 25sten Mai 1873.
Lieber Otto!
Friedhelm, dessen Hand Du erkennst, ist es doch nicht, der hier schreibt; er führt nur heute, Sonntag nachmittag, einmal die Feder für seinen Vater, da sich Herr Sch. krank gemeldet hat. Gerade Sonntag mittag vermisse ich Dich und besonders Maxa mit ihrer Familie am meisten; sei mir also in der Ferne herzlich begrüßt!
Sehr erfreut hat mich die herzliche Aufnahme, die der „Briefwechsel“ bei Dir gefunden hat. Ein inneres Verständnis, das nur aus der Gesinnung kommt, gehört dazu, um dieses Buch zu würdigen. Hätte ich der öffentlichen Meinung beipflichten oder ihren Beifall gewinnen wollen, so würde ich das Buch nicht geschrieben haben. Aber das ist nie mein Sinn gewesen. Die historische Wissenschaft und Darstellung ist ein Amt, das sich nur mit dem Priesterlichen vergleichen läßt, so weltlich auch die Gegenstände sein mögen, mit denen sie sich eben beschäftigt. Denn die laufende Strömung sucht doch die Vergangenheit zu beherrschen und legt sie eben nur in ihrem Sinne aus. Der Historiker ist dazu da, den Sinn jeder Epoche an und für sich selbst zu verstehen und verstehen zu lehren. Er muß nur eben den Gegenstand selbst und nichts weiter mit aller Unparteilichkeit im Auge haben. Ueber allem schwebt die göttliche Ordnung der Dinge, welche zwar nicht geradezu nachzuweisen, aber doch zu ahnen ist. In dieser göttlichen Ordnung, welche identisch ist mit der Aufeinanderfolge der Zeiten, haben die bedeutenden Individuen ihre Stelle: so muß sie der Historiker auffassen. Die historische Methode, die nur das Echte und Wahre sucht, tritt dadurch in unmittelbaren Bezug zu den höchsten Fragen des menschlichen Geschlechtes.
Doch genug dieser Sonntagnachmittagspredigt! Leider muß ich fürchten: aus der fortgesetzten persönlichen Gemeinschaft mit Dir, von der ich hoffte, sie würde uns beschieden sein, wird nicht viel werden. Die Männer, welche die Lage der Sache kennen, sprechen uns nicht alle Hoffnung ab, aber vertrösten mich allezeit auf spätere Möglichkeiten. Der Prediger Frommel, den ich neulich sah, giebt Dir den Rat, bei der Militärpredigerlaufbahn zu bleiben.
Ich höre, Du denkst, wenn sich dort alles auflöst, eine Reise anzutreten – aber wohin? Ich weiß nicht, ob Du einen unwiderstehlichen Zug nach England hast. Wäre das nicht der Fall, so würde ich Dir raten, die heiligen Stätten im Orient aufzusuchen. In dem ersten Anfang unserer Ehe hatte ich mit Deiner Mutter diesen Gedanken gefaßt. Wir würden ihn wahrscheinlich ausgeführt haben, wären wir nur allein geblieben und besonders Deine Mutter gesünder. Ich wollte dann ein Leben Jesu schreiben mit der Lokalfarbe, wie sie bei Renan breit und markig hervortritt, aber in anderem Sinn; nicht ohne die Phantasie, die das Unglaubliche als poetisch religiöse Wahrheit zu fassen strebt. Ich will Dir nun nicht gerade raten, dies Unternehmen selbst auszuführen – ich glaube kaum, daß es mir gelungen wäre; mein Beruf war es eben nicht in der Welt. Aber es wird Dir zu großer Genugthuung gereichen und Deinen religiösen Gefühlen eine Art von lokalem Hintergrunde geben; das Evangelium würdest Du noch besser verstehen lernen. Nachher kämest Du auf einige Zeit zu mir, um dann dahin zu gehen, wohin die göttliche Vorsehung Dich ruft. Der Glaube an die Vorsehung ist die Summe alles Glaubens; ich halte ihn unerschütterlich fest.
So hast Du jetzt das Glück gehabt ohne viel Zuthun von unserer Seite, dem unübertrefflichen Manne zur Seite zu stehen, dessen Freundschaft zu dem Glück meines Lebens gehört. Der Umgang mit ihm selbst und mit seiner Familie ist unschätzbar für Dich gewesen und wird es für Dein ganzes Leben bleiben. Wenn ich ihm nicht öfter schreibe, so liegt das nur daran, daß ich ihm nichts Besonderes zu sagen weiß. Ich entbehre es, daß ich ihn und Dich nicht wohl besuchen kann; meine hohen Jahre und allerlei Gebrechlichkeiten verhindern mich daran, eine Reise zu unternehmen, die lang und komplicirt ist. Ich hätte wohl gewünscht, etwas Näheres über die Anwesenheit von Frau v. Manteuffel in Paris und ihre Beziehungen zu den Damen des Herrn Thiers zu vernehmen. Das ist doch auch eine Gesellschaft, die mich in hohem Grade interessirt. Laß Dir einiges erzählen und schreibe es mir ausführlich. Sage Frau v. Manteuffel sowie dem General meine herzlichsten Grüße und empfange sie auch selbst, trauter Otto, von Deinem Vater!“
Aller guten Dinge sind drei; so bieten wir denn zum Schluß unseren Lesern eine Gabe, auf die sie vor allen anderen Deutschen ein besonderes, wohlerworbenes Recht besitzen. Im Frühjahr 1885, nicht lange vor dem siebzigsten Geburtstag des Fürsten Bismarck, wandte sich der bekannte Romanschriftsteller Hermann Heiberg im Auftrag der Redaktion der „Gartenlaube“ an den neunundachtzigjährigen Ranke mit der Bitte, zu jenem Festtage eine historische Skizze über den großen deutschen Staatsmann für unser Blatt zu verfassen. Ranke hat dem Verlangen leider nicht zu willfahren vermocht; denn er war zu tief in die Arbeit am sechsten Bande seiner Weltgeschichte versenkt: Er hat oftmals betont, daß man in dem Gegenstande leben müsse, für den man etwas leisten wolle; an eine Unterbrechung des einen Studiums durch ein anderes war daher bei ihm niemals zu denken. Trotzdem konnte er der Versuchung nicht widerstehen, in einer kurzen Mußestunde seinem Amanuensis ein Paar Grundgedanken seiner Ansicht von der weltgeschichtlichen Bedeutung Bismarcks zur Niederschrift zu diktieren. Dieser kleine Aufsatz, damals von Ranke im Pult zurückbehalten, ward uns heute freundlich zur Verfügung gestellt. Unsere Leser werden sich freuen, so die Stimme unseres größten Geschichtschreibers über den größten Staatsmann seiner [875] Zeit gleichsam aus dem Jenseits herüber zu vernehmen. Der Entwurf zu einem Schreiben an Heiberg lautet, wie folgt:
„Auch nur eine kurze historische Skizze über das Leben des Mannes, dessen siebzigsten Geburtstag Deutschland zu feiern sich anschickt, zu verfassen – was Sie mir mit dringenden Worten ans Herz legten – kann ich nicht unternehmen. Wie ich Ihnen sagte: ich bin mit den Verwicklungen, Gefahren, Tendenzen des 9. Jahrhunderts in meinem Geiste vollauf beschäftigt. Ich suche den Faden der Ariadne in diesem Labyrinth zu finden; ich hoffe noch, es mir und andern verständlich zu machen. In diesem Augenblick Studien über das 19. Jahrhundert zu unternehmen, ist mir unmöglich. Dennoch reizt es mich, ich bekenne es, Ihren dritthalbhunderttausend Abonnenten ein Wort über die gewaltige Kraft zu sagen, welche in die Geschicke von Deutschland so tief eingreift, wie jemals ein Minister in der Monarchie vermocht hat. Glücklicherweise greifen die inneren Impulse unseres Kaisers und seines Kanzlers so vollkommen ineinander, daß eine Differenz der Tendenzen innerhalb des Kreises, den die Regierung ausmacht, nicht vorkommen kann.
Das Wichtigste, der Gedanke, von dem die politische Bewegung ausging, ist ein gemeinsamer: der preußische Staat mußte von dem Druck, welchen die auswärtigen Verhältnisse ihm auferlegten, befreit werden. Der dänische, der österreichische und der französische Krieg sind daraus gleichmäßig hervorgegangen. Dem Einfluß einer fremden Nationalität auf das nördliche Deutschland, der auf einem dynastischen Verhältnis beruhte, welches eben unterbrochen wurde, mußte ein Ende gemacht werden, wenn die Nation jemals ihrer Einheit innewerden sollte. Aber der Hader, der zwischen den beiden in Deutschland vorwaltenden Potenzen lange bestand und hierdurch noch geschärft wurde, konnte unmöglich länger fortdauern, wenn der preußische Staat seiner vollen Unabhängigkeit sich erfreuen sollte. War doch vor kurzem der Versuch gemacht worden, die Einheit der Nation in dem Hause Habsburg zur Darstellung zu bringen. Die Bundesfürsten, der Bundestag schienen sich dem zu fügen. Der gordische Knoten der deutschen Verwicklungen konnte nicht gelöst, er mußte zerhauen werden. Dies konnte nicht unternommen werden ohne Gefährdung der eigenen Existenz – auf diese Gefahr hin wurde es unternommen. Aber dank der Ausbildung, welche eine lange vorausrechnende Sorge der Regierung dem militärischen Geiste des Volkes und der Armee verschafft hatte, gelang es vollkommener, als man je erwartet hätte. Der einzige Bundesstaat, der sich dem wirksam entgegensetzte, wurde vernichtet. Dem alten Nebenbuhler wurde kein Fuß breit Landes entrissen; aber ein neuer Bund wurde geschlossen, der den Einfluß desselben auf das übrige Deutschland abschnitt.
Der Sieg von Sadowa eröffnete eine neue Aera für die Politik der Welt; nicht alle Welt aber acceptirte denselben. Noch immer wollte Frankreich den Einfluß nicht entbehren, welchen es früher in Deutschland ausgeübt und den es zu Anfang desselben Jahrhunderts beinahe zu einer wirklichen Oberherrschaft ausgebildet hatte. Es hoffte noch immer, die Niederlagen, die es danach erlitten, durch eine neue Erhebung wettzumachen. Man hat später erfahren, wie tief das noch immer auf die Zersetzung in Deutschland wirkte: alle Hoffnungen, die alten Zustände wiederherzustellen, schlossen sich an Frankreich. An und für sich hätten die beiden Nationen wohl nebeneinander bestehen können. Unausgesetzte Eifersucht aber bewirkte endlich einen Bruch, der zum Kriege führte, in welchem die Monarchie Friedrichs des Großen den Sieg über die napoleonischen Tendenzen und ihre Streitkräfte davontrug. Hierdurch erst wurde die volle Unabhängigkeit gesichert. Was die politischen und militärischen Führer der letzten Jahrzehnte geträumt, wurde vollendet. Es liegt die größte Befriedigung des Selbstgefühls einer Nation darin, wenn sie weiß, daß auf Erden kein Höherer über ihr ist. Gleichsam von selbst geschah es dann, daß die preußische Monarchie sich zum Deutschen Reich erweiterte; alle die, welche den Sieg hatten erfechten helfen, nahmen theil an der neuen Gestaltung.
Drei kriegerische Handlungen, deren wahre Ursache in der Entwicklung der inneren Kraft lag, deren Beginn und Gang jedoch nicht ohne den die auswärtigen Geschäfte leitenden Minister vollzogen werden konnte, welcher die Einheit der Idee in sich selbst trug und in jedem Momente der Differenzen gegenwärtig erhielt. Die größte intellektuelle Fähigkeit hatte sich mit dem universalen Interesse identifiziert. Notwendig fiel es ihr zu, dann auch den Frieden zu leiten, die allgemeine Teilnahme an der Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten verfassungsmäßig zu sichern. Noch weniger als bisher könnte ich hier auf eine Einzelheit eingehen; ich will nur beim Allgemeinsten stehen bleiben, ohne die Irrungen zu berühren, die dann eintreten mußten und eingetreten sind. Das vornehmste Objekt von allen ist die Organisation der nationalen Institute, welche dem entsprechen mußte, was in den europäischen Staaten überhaupt die maßgebende konstitutionelle Idee geworden ist, zugleich aber das Verdienst hatte, das Volk selbst in seiner Tiefe zu ergreifen und heranzuziehen. Das gehörte nun einmal zu dem Ganzen der Umwandlung, die sich vollzog, Wir sind inmitten derselben begriffen. So widerwärtig und verabscheuenswürdig die Ausschreitungen sind, die dabei dann und wann vorkommen, so läßt sich doch erwarten, daß die Velleitäten des Umsturzes durch den Gedanken der allgemeinen Umfassung und Entwicklung aller Kräfte zurückgedrängt werden.
Aber noch etwas anderes möchte ich von meiner Seite in Erinnerung bringen. Die wissenschaftlichen Studien, die nie in größerer Ausdehnung in Deutschland geblüht haben als heutzutage, bedürfen des Friedens; denn nur aus langjähriger Anstrengung und Arbeit der Gesamtheit und der Einzelnen können große Resultate hervorgehen. Eine solche Epoche ist dem deutschen Geiste in den Jahren seit dem letzten großen Kriege gewährt worden – ebenfalls hauptsächlich durch das Verdienst des Staatsmannes, der in jedem Augenblick den kriegdrohenden Impulsen entgegentrat und, indem er sie zurückwies, zugleich eine Art von Vorsitz in dem europäischen Rate davongetragen hat.
Noch ist aber auf diesem Wege viel zu thun übrig. Das innere Verständnis in der Nation selbst muß vollendet, die äußere Stellung nach allen Seiten hin gesichert werden. Wenn man den siebzigsten Geburtstag Bismarcks feiert, so geschieht das nicht allein in Bewunderung dessen, was durch ihn geschehen ist, sondern in der Erwartung, daß die Gründungen, die seinem Kaiser und ihm gelungen sind, für alle Zukunft bestehen und für jedermann die erfreulichsten Früchte, nicht der Ruhe, sondern der Thätigkeit hervorbringen werden. Das walte Gott!“ a/D.
[876]
Blätter und Blüten.
Eine gesprochene Zeitung. Unter diesem Titel sind nicht die Neuigkeiten der Klatschbasen zu verstehen, sondern eine „leib“haftige Zeitung. In der Haupt- und Residenzstadt Ungarns, in Budapest, giebt es nämlich schon seit geraumer Zeit eine Telephon-Zeitung, eine der sinnreichsten und interessantesten Erfindungen der Neuzeit. Die Telephon-Zeitung (ungarisch: Telefon-Hirmondó) ist eine Erfindung des vor einigen Jahren verstorbenen ungarischen Ingenieurs Th. von Puskás, der jahrelang an der Seite des amerikanischen Erfinderkonigs Edison arbeitete und selbst ein genialer Erfinder war.
Er gründete die Telephon-Zeitung, konnte sie aber nicht zur Blüte bringen. Nach seinem Tode kam dieselbe in den Besitz eines Budapester Großkapitalisten, der sie dann neu einrichtete und in eine Aktiengesellschaft umwandelte. Heute ist die Zeitung in Budapest sehr beliebt, alle Kaffeehäuser, Restaurants, Klubs, Geschäftsbureaus und viele Private haben sie einführen lassen, und die Abonnentenzahl wächst von Tag zu Tag.
Das Netz der Zeitung erstreckt sich über die ganze Stadt und die Nachrichten werden aus der Centrale (Redaktion) den ganzen Tag über mittelst Telephon den Abonnenten mitgeteilt. Bei jedem Abonnenten wird die Leitung eingeführt und mit zwei Hörmuscheln versehen. Das Programm ist für jeden Tag gleichmäßig festgestellt und besteht aus Neuigkeiten, Personal-, Börsennachrichten und „verschiedenen“ Mitteilungen. Hat die Redaktion dem Publikum etwas besonders Interessantes oder Wichtiges mitzuteilen, so wird die Aufmerksamkeit der Abonnenten durch ein im ganzen Zimmer hörbares Geräusch wachgerufen. Außerdem bietet die Zeitung ihren Abonnenten (Zuhörern) eine angenehme Zerstreuung, indem sie jeden Abend Konzerte und Vorlesungen veranstaltet. Vom Herbst laufenden Jahres an wird die Telephonzeitung auch mit der Budapester Oper und mit dem Volkstheater verbunden, so daß die Abonnenten auch die Vorstellungen dieser Theater von der Wohnung aus genießen können.
Eine wahre Wohlthat ist die Telephon-Zeitung für Kranke (speciell Augenkranke), die, an das Bett gebunden, größtenteils an quälender Langerweile leiden, und in der That haben Budapester Krankenhäuser zur Zerstreuung der Kranken die Telephon-Zeitung schon eingeführt. Wie jede andere Erfindung ist auch die Telephon-Zeitung der Vervollkommnung bedürftig, doch steht bei der rührigen Verwaltung zu erhoffen, daß sie alles mögliche aufbieten wird, um die Vervollkommnung zu fördern. R. Rothfeld.
Der Blumenfreund. (Zu dem Bilde S. 857.) Das zufällig wahrgenommene Schöne rührt bekanntlich viel tiefer als das gewohnheitsmäßig Erschaute. „Nagerln“, wie sie im Oberbayrischen die Nelken nennen, hat der alte Geigerseppel genug daheim, dunkle und helle, sie hängen ja nur so von den Fensterkästen herunter und seine Alte hat die größte Freude damit. Aber er schaut nicht hin, wenn sie ihm die ganze Pracht rühmen will, er läßt sie ruhig mit dem Gießkrug hinter den Blumenkästen hantieren und strebt selbst eilfertig, mit der Geige im Sack, dem Sonntagstanz im Wirtshaus zu. Freilich, wenn ihm dort am Schenkeneingang das biertragende Lenerl begegnet, lustig und bildsauber, angethan mit dem schönsten Feiertagsgewand, die runde Otterfellmütze auf dem blonden Schelmenkopf und ein brennrotes Nagerl zwischen den frischen Lippen – Teufel, das „reißt“ ihn nur so! Da muß er nahe bei, um daran zu riechen, denn so ’was von einem netten Blümerl hat er doch sein Lebtag nicht gesehen. Schade nur, daß seine Alte nicht Zeuge dieser plötzlich erwachenden Blumenliebhaberei sein kann! Was würde die darüber für eine Freude haben! … Bn.
Am Weißen Nil. (Zu dem Bilde S. 861.) Nachdem der Nil seine Quellenseen verlassen, breitet er sich im Laufe gegen Norden in weiten grasigen Steppen aus. Breiter und weiter wird sein Bett, stellenweise teilt sich der Strom in eine Anzahl Nebenarme, und wo langsamer seine Wellen dahinziehen, faßt in ihm die Pflanzenwelt festeren Fuß und überzieht ihn mit einer grünen Decke. Da stehen am Ufer dichte Horste der klassischen Papyrus, aus der Flut steigen die schlanken rohrartigen Stämme des Ambatschholzes empor und schließen sich zu einem schier undurchdringlichen Dickicht zusammen, dazwischen wachsen allerlei Schilf- und Wasserpflanzen und viele von ihnen verschlingen sich auf dem Spiegel des Stromes zu einem so festen Filz, daß über diese schwimmenden Wiesen selbst Herden von Rindern hinwegschreiten können. Verhaßt sind den Menschen diese gewaltigen „Grasbarren“ des Nils, da sie den Fluß verstopfen, die Schiffahrt völlig unmöglich machen. Um so willkommener erscheinen aber diese ewig grünen Wasserwildnisse, mit ihren stillen Buchten, zahllosen toten Armen, mit Sümpfen und Morästen, der Tierwelt, die zu ihrem Lebensunterhalt kühlender Wasserflut und ruhiger Beschaulichkeit bedarf. So ist auch der Weiße Nil ein Paradies der Nilpferde. Hier hausen sie noch in großen Herden und ihr lautes Brüllen, Schnauben und Tosen erfüllt die tropischen Nächte mit lärmenden Lauten. Ungestört weiden sie die schwimmenden Wiesen und das Ufergelände ab, denn kein Raubtier wagt sich an die 4 bis 5 Meter langen und 1½ Meter hohen Ungetüme, der Leopard der Steppe geht ihnen aus dem Wege und das Krokodil in der Flut läßt sie in Ruhe – der Mensch aber, der Hauptfeind aller Tiere, kommt nur selten in diese Wildnis.
In der frühesten Jugend, im Säuglingsalter, drohen allerdings auch dem kleinen Nilpferd die mannigfachsten Gefahren, es wächst aber in der Regel munter und sicher heran, denn es steht unter dem sorgfältigsten Schutze seiner Eltern. Die Nilpferdmutter behütet das Junge wie ihren eigenen Augapfel; auf Schritt und Tritt folgt es ihm zu Lande und zu Wasser und wehe dem Geschöpfe, das Miene macht, das Junge anzugreifen, ja nur arglos in die Nähe des teuren Flußferkels kommt! Auch das Nilroß ist kein Rabenvater, man sieht ihn vielmehr stets in der Nähe seiner Familie.
Ein solches Kleeblatt hat Meister Specht auf seinem Bilde dargestellt. Die Alten haben eine von Wasserpflanzen freie Flußstelle gewählt, damit das Kleine sich austummeln, nach Belieben schwimmen und tauchen konnte; nun ruht es von dem ernsten Spiel auf der Mutter Nacken aus, während der Vater es freundlich anschnaubt. Als Zeugen dieses Familienglücks haben sich am sicheren Ufer Meerkatzen eingestellt. Die bunte Affenbande ist in voller Aufregung. Der pater familias, der als Vorderster auf einer Wurzel hockt, scheint Naturstudien zu machen und über den wunderbaren Bau des Nilpferdmaules, in dem er genug Platz finden könnte, nachzudenken; die jüngere Sippe aber scheint auf Schabernack zu sinnen, und das ahnt die Nilpferdmutter, die aufmerksam die kleinen Teufel mustert. Dieser und jener hebt schon vielleicht einen Stein zum lustigen Bombardement auf. Da brüllt das Roß zufällig auf; in wunderbarem Baß erzittert die Luft; es schnaubt einigemal und das tönt wie das Stöhnen einer Lokomotive. Selbst Affenohren können solche nervenerschütternden Töne aus nächster Nähe nicht vertragen. Im Nu ist die Bande verschwunden – und Friede und Stille herrschen wieder in der improvisierten Nilpferd-Kinderstube. *
Die Zähne unserer Kinder. Vor kurzem sind zu wissenschaftlichen Zwecken einige Untersuchungen der Zähne größerer Kindergruppen ausgeführt worden. So prüfte Zahnarzt Fenchel in Hamburg das Gebiß von 200 Knaben und 135 Mädchen des dortigen Staatswaisenhauses und fand, daß von den Knaben nur 5, von den Mädchen aber nur 7 völlig gesunde Zähne besaßen. Insgesamt hatten die 323 Kinder 2471 kranke Zähne, jedes Kind im Durchschnitt also 8. Man könnte vielleicht einwenden, daß arme Waisenhauskinder in dieser Beziehung eine bedauernswerte Ausnahme darstellen, da ihnen die sorgfältige Mutterpflege gefehlt habe. Aber mit nichten! Jüngst untersuchte Privatdocent Dr. C. Röse in Freiburg i. B. das Gebiß von 500 Schülern der Volksschule und stellte fest, daß nur 3 Schüler völlig gesunde Zähne hatten. Das Verhältnis war also noch ungünstiger als in Hamburg. Wie die Eltern für die Zähne ihrer Kinder sorgten, ging daraus hervor, daß nur bei zweien dieser Kinder die schadhaften Zähne durch Plombieren vor sicherem Untergang gerettet wurden. An Belehrungen des Publikums in dieser Hinsicht fehlt es nicht; wir besitzen treffliche und billige gemeinverständliche Bücher über Zahnpflege, in Zeitungen sind zahlreiche zweckmäßige Artikel erschienen, aber die Eltern lassen sich aus ihrem Gleichmut nicht aufrütteln. Da entsteht wohl die Frage, ob es nicht angebracht wäre, bei den Kindern selbst anzufangen und diese in der Schule über die Hygieine der Zähne zu unterrichten. Die Mühe wäre nicht groß und schon in Form geeigneter Lesestücke ließe sich viel erreichen. *
Ruhepause. (Zu dem Bilde S. 869.) Behagliche Wärme im traulichen Wohngemach, duftende Blumen in prächtigen Vasen ringsum, sammetweich die schwellenden Polster des Lehnstuhls – wer so über der Arbeit sitzt, muß selbst ihre Mühsal als Lust empfinden. Vollends wenn die Nadel mit dem goldenen Faden so Schönes hervorbringt wie die kostbare Stickerei, die der jungen Frau auf dem Schoß liegt, und wenn die Arbeit Den zu beglücken bestimmt ist, an welchen die Stickerin voll liebender Sehnsucht denkt. Aber während des munteren Stichelns entführte die Vorfreude auf das Wiedersehen die Gedanken der Einsamen in weite Ferne zu dem geliebten Mann, der mitten in der Weihnachtszeit eine wichtige Geschäftsreise antreten mußte. Und sie ließ die fleißige Hand sinken, ganz in träumerisches Sinnen verloren, und sieht nun, zurückgelehnten Hauptes, im Geist das Bild des Entfernten, wie er heimkehrend freudig über die Schwelle tritt.
Inhalt: Die Lampe der Psyche. Roman von Ida Boy-Ed (11. Fortsetzung). S. 857 – Der Blumenfreund. Bild. S. 857. – Am Weißen Nil. Bild. S. 861. – Lorenzo Magnifico. Zur Auffindung seiner Grabstätte. Von Isolde Kurz. II. S. 863. Mit Abbildungen und Bildnissen S. 864, 865 und 867. – Karl Thiessens Brautfahrt. Eine Heiratsgeschichte von Hans Arnold (Fortsetzung). S. 868. – Ruhepause. Bild. S. 869. – Erinnerungen an Leopold v. Ranke. Mit bisher ungedruckten Aufzeichnungen desselben. Zum 21. Dezember 1895. S. 872. Mit Abbildungen S. 872, 873, 874 und 875. – Blätter und Blüten: Eine gesprochene Zeitung. Von R. Rothfeld. S. 876. – Der Blumenfreund. S. 876. (Zu dem Bilde S. 857.) – Am Weißen Nil. S. 876. (Zu dem Bilde S. 861.) – Die Zähne unserer Kinder. S. 876. – Ruhepause. S. 876. (zu dem Bilde S. 869.)
Nicht zu übersehen! Mit der nächsten Nummer schließt das vierte Quartal der „Gartenlaube“ 1895; wir ersuchen die geehrten Abonnenten, ihre Bestellung auf das erste Quartal des neuen Jahrgangs schleunigst aufgeben zu wollen.
Die Postabonnenten machen wir noch besonders darauf aufmerksam, daß der Abonnementspreis von 1 Mark 75 Pf. bei Bestellungen, welche nach Beginn des Vierteljahrs bei der Post aufgegeben werden, sich um 10 Pfennig erhöht.
Einzeln gewünschte Nummern der „Gartenlaube“ liefert auf Verlangen gegen Einsendnng von 30 Pfennig in Briefmarken direkt franko die Verlagshandlung:- ↑ Gonfaloniere = das nominelle Staatsoberhaupt.
- ↑ Feldgeschrei der mediceischen Partei, auf die Kugeln des Wappens bezüglich.
- ↑ Turnier.
- ↑ Die Familie existiert noch heute.
- ↑ Ein Vers, unübersetzbar in seiner Einfachheit. Der Sinn ist:
Freue sich wer kann des Lebens
Keiner kennt die nächste Stunde. - ↑ Diese unverbürgte Ueberlieferung wird durch innere Unwahrscheinlichkeit widerlegt. Was wollte Savonarola sagen? Kein Mann, und wäre er der mächtigste, kann durch Wort oder Federstrich einem Volke die Freiheit geben, das nicht im Mark seiner Knochen diese Freiheit mit sich trägt.
- ↑ Le vanità. Man schichtete einen mächtigen Scheiterhaufen auf und verbrannte Gemälde, Bronzen, Bücher, Gobelins, Masken und Putzgegenstände, während Mönche und Weltkinder psalmodierend um das Feuer tanzten.