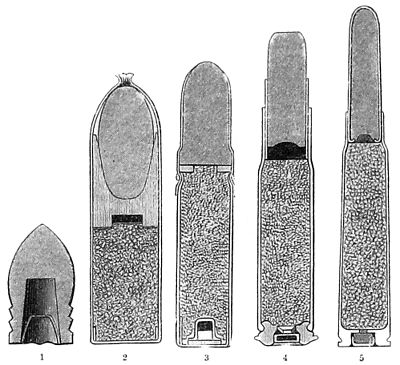Die Gartenlaube (1890)/Heft 5
[133]
| Halbheft 5. | 1890. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Flammenzeichen.
Willibald war wortlos der Einladung des Doktors gefolgt; allmählich kam man in ein Gespräch, bei dem Marietta allerdings den Hauptantheil trug. Sie erzählte ausführlich und in höchst komischer Weise das Zusammentreffen mit Willibald. Da sie von der bevorstehenden Verlobung längst unterrichtet war, so behandelte sie den Bräutigam ihrer Freundin wie einen alten Bekannten, sie fragte nach Toni, nach dem Oberforstmeister, und der kleine rothe Mund ging dabei wie ein Mühlwerk.
Der junge Majoratsherr war um so schweigsamer, die helle Stimme, die selbst beim Sprechen so lieblich klang wie Vogelgezwitscher, machte ihn ganz verwirrt. Er hatte den Doktor erst gestern kennen gelernt, als dieser in Fürstenstein einen Besuch abstattete, und es war dabei auch von einer gewissen Marietta die Rede gewesen, die mit seiner Braut befreundet war. Näheres aber wußte er nicht, denn Toni war nicht besonders mittheilsam.
„Und da läßt dies übermüthige Kind Sie nun ohne weiteres im Hausflur stehen und setzt sich an das Klavier, um mir seine Ankunft anzukündigen!“ sagte Volkmar kopfschüttelnd. „Das war sehr unartig, Marietta.“
Das junge Mädchen lachte und schüttelte die kurzen krausen Locken.
„O, Herr von Eschenhagen nimmt es nicht übel, dafür darf er auch zuhören, wenn ich Dir Dein Lieblingslied noch einmal vorsinge, Du hast ja kaum ein paar Takte gehört. Soll ich gleich anfangen?“
Ohne eine Antwort abzuwarten, lief sie an das Klavier, und nun erhob sich wieder jene silberhelle Stimme, die das Ohr förmlich bestrickte mit ihrem Zauber. Sie sang eine alte einfache Volksweise, aber es klang so lockend und schmeichelnd, so weich und süß, als sei plötzlich der Frühling und der Sonnenschein eingezogen in die stillen öden Räume des alten Hauses. Und es legte sich dabei auch wie Sonnenschein auf das Gesicht des alten weißhaarigen Mannes, in das sich so manche Falte der Sorge und des Kummers gegraben hatte. Mit einem halb wehmüthigen, halb freundlichen Lächeln hörte er dem Liede zu, das ihn wohl an die Zeit erinnern mochte, wo er noch jung und glücklich war.
Aber er war nicht der einzige aufmerksame Zuhörer. Der junge Majoratsherr von Burgsdorf, der vor zwei Stunden bei den donnernden Klängen des Janitscharenmarsches eingeschlafen war, der in vollster Uebereinstimmung mit seiner Braut die „dumme Musik“ für eine sehr langweilige Sache hielt, er lauschte diesen weichen, quellenden Tönen so andächtig, als ob sie ihm eine neue Offenbarung verkündeten. Weit vorbeugt saß er da, die Augen unverwandt auf das junge Mädchen gerichtet, das augenscheinlich mit ganzer Seele bei dem Gesange war und dabei mit einer unendlich reizenden Bewegung das Köpfchen hin und her wiegte, und als das Lied zu Ende war, athmete er tief auf und fuhr mit der Hand über die Stirn.
„Mein kleines Singvögelchen!“ sagte Doktor Volkmar zärtlich,
[134] indem er sich zu seiner Enkelin niederbeugte und einen Kuß auf ihre Stirn drückte.
„Gelt, Großpapa, meine Stimme hat nicht gerade verloren in den letzten Monaten?“ fragte sie neckisch. „Aber Herrn von Eschenhagen scheint sie doch nicht zu gefallen, er sagt mir kein Wort darüber.“
Sie blickte mit der Miene eines schmollenden Kindes zu Willibald hinüber, der sich jetzt erhob und gleichfalls an das Klavier trat. Auf seinem Gesicht lag eine leise Röthe und in seinen sonst so ausdruckslosen braunen Augen leuchtete es auf, als er halblaut sagte:
„O, es war sehr, sehr schön!“
Die junge Sängerin mochte wohl an andere Komplimente gewöhnt sein, aber sie fühlte doch die tiefe, ehrliche Bewunderung in den lakonischen Worten und bemerkte recht gut, welchen Eindruck ihr Gesang gemacht hatte; sie lächelte deshalb, als sie erwiderte:
„Ja, das Lied ist auch sehr schön. Ich habe jedesmal einen förmlichen Triumph damit gefeiert, wenn ich es als Einlage zu meiner Rolle sang.“
„Zu Ihrer Rolle?“ wiederholte Willy, der sich diesen Ausdruck nicht erklären konnte.
„Nun ja, bei dem Gastspiel, von dem ich eben zurückkomme. O, es ist glänzend verlaufen, Großpapa, und der Direktor hätte es gern verlängert, aber ich hatte schon den größten Theil meines Urlaubs darauf verwandt und wollte doch wenigstens noch einige Wochen bei Dir sein.“
Der junge Majoratsherr hörte in steigender Verwunderung zu. Gastspiel – Urlaub – Direktor – was sollte denn das alles bedeuten? Der Doktor bemerkte sein Erstaunen.
„Herr von Eschenhagen kennt Deinen Beruf noch nicht, mein Kind,“ sagte er ruhig. „Meine Enkelin hat sich zur Sängerin ausgebildet.“
„Wie nüchtern Du das sagst, Großpapa!“ rief Marietta aufspringend; und sich zu der vollen Höhe ihrer zierlichen Gestalt aufrichtend, fügte sie mit komischer Feierlichkeit hinzu:
„Seit fünf Monaten Mitglied eines hochzuverehrenden herzoglichen Hoftheaters, eine Person in Amt und Würden, also – Hut ab, mein Herr!“
Mitglied des Hoftheaters! Willibald zuckte förmlich zusammen bei dem verhängnißvollen Worte. Der wohlerzogene Sohn seiner Mutter theilte deren ganzen Abscheu vor dem „Komödiantenwesen“. Er trat unwillkürlich drei Schritte zurück und starrte entsetzt auf die junge Dame, die ihm so Schreckliches verkündete. Sie lachte laut auf bei der Bewegung.
„Nun, so viel Respekt brauchen Sie nicht zu haben, Herr von Eschenhagen! Ich erlaube Ihnen, hier am Klavier stehen zu bleiben. Hat Ihnen denn Toni nicht gesagt, daß ich beim Theater bin?“
„Toni? – Nein!“ stieß Willibald ganz fassungslos hervor. „Aber sie erwartet mich, ich muß nach Fürstenstein – ich bin schon viel zu lange hier gewesen!“
„Recht artig!“ lachte das junge Mädchen ausgelassen. „Das ist wirklich nicht sehr schmeichelhaft für uns; aber da Sie Bräutigam sind, müssen Sie natürlich zu Ihrer Braut.“
„Ja, und zu meiner Mama,“ sagte Willy, der ein dunkles Gefühl hatte, daß ihm irgend etwas Fürchterliches drohe, und dem seine Mutter als ein rettender Engel erschien. „Ich bitte um Entschuldigung, aber ich – ich bin wirklich schon viel zu lange hier gewesen …“
Er stockte, denn er erinnerte sich, daß er das schon einmal gesagt hatte, und suchte nach anderen Worten, fand sie aber nicht und wiederholte glücklich die Artigkeit zum drittenmal.
Marietta wollte sich ausschütten vor Lachen. Doktor Volkmar aber erklärte höflich, seinen Gast nicht länger aufhalten zu wollen, und bat, seine Empfehlungen an den Oberforstmeister und an Fräulein von Schönau auszurichten. Der junge Majoratsherr hörte kaum darauf, er suchte seinen Hut, machte eine Verbeugung, stotterte einen Abschiedsgruß und lief davon, als ob ihm der Kopf brenne. Er hatte nur den einen Gedanken, daß er so schnell als möglich fort müsse; dies übermüthige, neckische Lachen machte ihn ganz verrückt.
Als Volkmar, der ihn bis zur Thür begleitet hatte, zurückkehrte, wischte sich seine Enkelin, halb erstickt vor Lachen, die Thränen aus den Augen.
„Ich glaube, bei Tonis Bräutigam ist es hier nicht recht richtig!“ rief sie, die zierlichen Finger an die Stirn legend. „Zuerst lief er stumm wie ein Fisch mit dem Koffer hinter mir drein, dann schien er etwas aufzuthauen bei meinem Gesange, und nun bekommt er wieder einen förmlichen Anfall zum Davonlaufen und rennt nach Fürstenstein zu seiner ‚Mama‘, so daß ich ihm nicht einmal einen Gruß an seine Braut mitgeben kann.“
Der Doktor lächelte ein wenig schmerzlich; er hatte besser beobachtet und errieth, woher die plötzliche Veränderung in dem Benehmen seines Gastes stammte.
„Der junge Mann hat wohl noch nicht viel mit Damen verkehrt,“ versetzte er ausweichend, „und er scheint auch noch einigermaßen unter der Vormundschaft seiner Mutter zu stehen; aber seiner Braut gefällt er offenbar ganz gut, und das ist schließlich die Hauptsache.“
„Ja, hübsch ist er!“ sagte Marietta etwas nachdenklich, „sogar sehr hübsch, aber ich glaube, Großpapa, er ist auch sehr dumm.“
Willibald war inzwischen im Sturmschritt bis zur nächsten Straßenecke gelaufen; da blieb er stehen und versuchte, seine Gedanken zu ordnen, die vollständig in Verwirrung gerathen waren. Es dauerte eine ganze Weile, ehe er damit zustande kam, aber er blickte noch einmal nach dem Hause des Doktors zurück, ehe er langsam weiter ging.
Was würde seine Mutter dazu sagen! Sie, die das ganze „Komödiantenvolk“ ohne Ausnahme in Acht und Bann gethan hatte. Und sie hatte recht, Willy spürte ja ganz deutlich, daß so etwas wie Hexerei von diesem Volke ausging, man mußte sich vor ihm hüten!
Aber wenn diese Marietta Volkmar sich nun einfallen ließe, ihre Jugendfreundin in Fürstenstein zu besuchen? der junge Majoratsherr hätte sich doch eigentlich entsetzen müssen bei dem Gedanken und war auch fest überzeugt, daß er sich entsetze; aber dabei trat wieder jenes seltsame Leuchten in seine Augen. Er sah urplötzlich in dem Empfangszimmer am Flügel, wo vorhin seine Braut gesessen hatte, eine zarte, kleine Elfengestalt, die das Köpfchen mit dem lockigen dunklen Haar wie ein Singvögelchen hin und her wiegte, und der Donner des Janitscharenmarsches verwandelte sich in die weichen quellenden Töne des alten Volksliedes, und dazwischen schallte wieder jenes übermüthige, silberhelle Lachen, das auch wie Musik klang.
Und das alles sollte nun verdorben und verloren sein, weil es der Bühne angehörte? Frau von Eschenhagen hatte oft genug solche Ansichten ausgesprochen und Willibald war ein viel zu guter Sohn, um das nicht für ein Orakel zu halten; aber er stieß einen tiefen Seufzer aus, als er halblaut sagte:
„O wie schade! Wie jammerschade!“
Ungefähr in der Mitte zwischen Fürstenstein und Rodeck, da
wo das Waldgebirge sich zu seiner vollen Höhe erhob, lag der
Hochberg, ein beliebter und besuchter Aussichtspunkt, der wegen
seiner weiten Rundsicht berühmt war. Der uralte steinerne Thurm
auf seinem Gipfel, der letzte Ueberrest einer im übrigen längst
verschwundenen Burgruine, war zugänglich gemacht worden, und zu
seinen Füßen hatte sich eine kleine Wirthschaft angesiedelt, die
während der Sommermonate reichlichen Zuspruch aus der Umgegend
fand. Denn Fremde kamen nicht allzuhäufig in diese
wenig bekannten Waldberge und Thäler.
Jetzt im Herbste war der Besuch allerdings spärlich, aber der heutige schöne Tag hatte doch noch einige Menschen zu dem Ausfluge verlockt. Vor einer halben Stunde waren zwei Herren in Begleitung eines Dieners zu Pferde angekommen, und soeben fuhr ein Wagen vor dem Wirthshause vor, der neue Gäste brachte.
Auf der Plattform des Thurmes, an der steinernen Brüstung standen die beiden Herren. und der jüngere war eifrig bemüht, seinem Freunde die einzelnen Punkte der Landschaft zu zeigen und zu erklären.
„Ja, unser Hochberg ist berühmt wegen seiner Aussicht,“ sagte er. „Ich mußte ihn Dir doch endlich einmal zeigen, Hartmut. Nicht wahr, der Blick über dies weite grüne Waldmeer ist unvergleichlich?“
Hartmut antwortete nicht, er schien mit dem Fernglase irgend einen Punkt zu suchen.
„Wo liegt denn Fürstenstein? Ah dort! Es scheint ein mächtiges altes Bauwerk zu sein.“
[135] „Ja, das Schloß ist immerhin sehenswerth,“ meinte Fürst Adelsberg. „Im übrigen aber hattest Du ganz recht, vorgestern zu Haus zu bleiben. Ich habe mich sträflich gelangweilt bei dem Besuche.“
„So? Du schienst doch sehr eingenommen von dem Oberforstmeister.“
„Gewiß, ich plaudere sehr gern mit ihm, aber er war ausgefahren und kam erst kurz vor meinem Aufbruche wieder zurück. Sein Sohn ist jetzt überhaupt nicht in Fürstenstein, er studiert noch auf der Forstakademie, und so hatte ich denn nur dem Fräulein von Schönau aufzuwarten, aber kurzweilig war dies ‚Vergnügen‘ gerade nicht. Alle fünf Minuten ein Wort und zu jedem Wort eine Minute! Sehr viel Wirthschaftlichkeit und Häuslichkeit, und sehr wenig da oben hinter der Stirn! Ich hielt im Schweiße meines Angesichtes die Unterhaltung im Gange und hatte dann noch die Ehre, den Bräutigam der Baroneß kennen zu lernen, einen echten, unverfälschten Landjunker, mit einer sehr energischen Frau Mama, die ihn und die künftige Schwiegertochter gänzlich unter dem Kommando hat. Wir führten unendlich geistreiche Gespräche und kamen schließlich sogar auf die Rübenkultur, über die ich eingehend belehrt wurde. Es wurde erst menschlich, als der Oberforstmeister mit seinem Schwager, dem Baron Wallmoden, zurückkehrte.“
Rojanow hielt das Glas immer noch auf Fürstenstein gerichtet, während er anscheinend gleichgültig zuhörte. Jetzt wiederholte er in fragendem Tone:
„Wallmoden?“
„Der neue preußische Gesandte an unserem Hofe. Eine echte Diplomatenerscheinung, vornehm, kühl, zugeknöpft bis zum Halse, übrigens von sehr angenehmen Formen. Excellenz die Frau Baronin waren nicht sichtbar, was ich mit Fassung ertrug, denn da der Herr Gemahl schon graue Haare hat, so wird sich die Dame wohl auch in dem Alter befinden, dem man nur noch Hochachtung zollt.“
Um Hartmuts Lippen spielte ein eigenthümlich bitterer Ausdruck, als er jetzt das Glas sinken ließ. Er hatte seinem Freunde das Zusammentreffen mit Frau von Wallmoden verschwiegen. Wozu auch diesen Namen erwähnen? Er wollte so wenig als möglich daran erinnert sein.
„Uebrigens wird es mit unserer romantischen Waldeinsamkeit bald vorbei sein,“ fuhr Egon fort. „Wie ich von dem Oberforstmeister hörte, kommt der Hof diesmal zu den Jagden nach Fürstenstein, und ich kann mich dann auch auf einen Besuch des Herzogs in Rodeck gefaßt machen. Sehr entzückt bin ich darüber nicht, denn mein erlauchter Herr Onkel pflegt mir ebenso oft und ebenso eindringlich Moral zu predigen wie der Stadinger, und da muß ich natürlich standhalten. Aber bei Gelegenheit dieses Besuches werde ich Dich vorstellen, Hartmut, Du bist doch einverstanden?“
„Wenn Du es für nothwendig hältst und die Etikette Eures Hofes es gestattet –“
„Bah, die Etikette wird bei uns nicht so streng gehandhabt, und überdies – die Rojanows gehören doch zu den Bojarenfamilien Deiner Heimath?“
„Gewiß!“
„Nun, dann bist Du ohne weiteres zu der Vorstellung berechtigt. Ich halte sie allerdings für wünschenswerth, denn ich habe mir nun einmal in den Kopf gesetzt, Deine ‚Arivana‘ auf unserer Hofbühne zu sehen, und sobald der Herzog Dich und Dein Werk kennt, steht das gar nicht mehr in Frage.“
Die Worte verriethen die ganze leidenschaftliche Bewunderung, die der junge Fürst für seinen Freund hegte; aber dieser zuckte nur leicht die Achseln.
„Möglich, besonders wenn Du dafür eintrittst, aber ich mag das nicht der Protektion verdankest. Ich bin kein Dichter von Beruf, weiß noch nicht einmal, ob ich überhaupt ein Dichter bin, und wenn mein Werth sich nicht selbst den Weg bahnen und erzwingen kann –“
„So wärst Du starrsinnig genug, es der Oeffentlichkeit zu entziehen – das sieht Dir ähnlich! Hast Du denn gar keinen Ehrgeiz?“
„Vielleicht nur zu viel, und daher stammt das, was Du meinen Starrsinn nennst. Ich habe mich nie fügen und unterordnen können im Leben, ich konnte nicht, meine ganze Natur bäumte sich auf dagegen, und für die Verhältnisse an Euren deutschen Höfen bin ich nun vollends nicht geschaffen.“
„Wer sagt Dir denn das?“ fragte Egon lachend. „Man wird Dich dort wie überall verwöhnen und umschmeicheln. Es ist nun einmal Deine Art, wie ein Meteor aufzusteigen, und von solchen Sternen verlangt man es gar nicht, daß sie die gewöhnlichen Bahnen ziehen. Ueberdies hast Du als Gast und Ausländer von vornherein eine Ausnahmestellung, und wenn Dich erst noch der Nimbus des Dichters umgiebt, dann –“
„Denkst Du mich damit in Deiner Heimath festzuhalten!“ ergänzte Hartmut.
„Nun ja denn! Ich allein traue mir nicht die Macht zu, Dich dauernd zu fesseln, Du wilder, ruheloser Gast, aber ein aufsteigender Dichterruhm ist eine Fessel, die man nicht so leicht abstreift, und seit heute morgen habe ich mir geschworen, Dich um keinen Preis wieder fortzulassen.“
Rojanow stutzte und sah ihn forschend an.
„Warum gerade seit heut morgen?“
„Das ist vorläufig mein Geheimniß,“ sagte Egon neckend. „Ah, da kommen noch mehr Gäste, wie es scheint!“
Man hörte in der That Schritte auf der schmalen steinernen Wendeltreppe, und in der Oeffnung, welche auf die Plattform führte, erschien das bärtige Gesicht des alten Thurmwächters.
„Bitte, nehmen Sie sich in acht, Gnädigste,“ ermahnte er, sich besorgt umschauend. „Die letzten Stufen sind sehr steil und ganz ausgetreten – so, da wären wir oben!“
Er wollte der nachfolgenden Dame die Hand reichen, aber sie bedurfte seiner Hilfe nicht, sondern stieg leicht und mühelos vollends empor.
„Welch ein schönes Mädchen!“ flüsterte Fürst Adelsberg seinem Freunde zu; aber dieser machte statt aller Antwort eine tiefe und sehr förmliche Verbeugung vor der Dame, die bei seinem Anblick eine gewisse Ueberraschung nicht verbergen konnte.
„Ah, Herr Rojanow, Sie hier?“
„Ich bewundere die Aussicht des Hochberges, die man wohl auch Ihnen gerühmt hat, Excellenz!“
Das Gesicht des jungen Fürsten verrieth ein grenzenloses Erstaunen, als das „schöne Mädchen“ Excellenz titulirt wurde und er aus der Anrede ersah, daß sie seinem Freunde nicht fremd sei. Er kam schleunigst herbei, um gleichfalls dieser Bekanntschaft theilhaftig zu werden, und Hartmut konnte nicht umhin, den Fürsten Adelsberg der Baronin Wallmoden vorzustellen; aber er berührte nur sehr flüchtig die Begegnung im Walde, denn die junge Frau fand es auch heute für gut, sich in ihre stolze Unnahbarkeit zu hüllen. Es wäre kaum nöthig gewesen, denn Rojanow beobachtete die äußerste Zurückhaltung, sie schienen beiderseits entschlossen, die Bekanntschaft als eine durchaus flüchtige und oberflächliche zu behandeln.
Egon hatte mit einem vorwurfsvollen Blicke seinen Freund gestreift, er begriff nicht, wie man eine solche Begegnung verschweigen konnte, dann aber stürzte er sich mit vollster Lebhaftigkeit in die Unterhaltung. Er stellte sich als Nachbar vor, erwähnte seines vorgestrigen Besuches in Fürstenstein und sprach sein Bedauern aus, Frau von Wallmoden damals verfehlt zu haben. Damit war ein Gespräch eingeleitet, bei dem der junge Fürst seine volle Liebenswürdigkeit entfaltete, während er zugleich in den Schranken gemessenster Artigkeit blieb. Er wußte freilich von Anfang an, daß er der Gemahlin des Gesandten gegenüberstand, der man nicht mit einem kecken Komplimente nahen durfte, wie Hartmut es gegen die Unbekannte gewagt hatte, und dieser heiteren, unbefangenen Liebenswürdigkeit gelang es sogar, den eisigen Hauch zu mildern, der die schöne Frau umgab. Egon hatte schließlich den Vorzug, ihr die Landschaft zeigen und erklären zu dürfen.
Hartmut betheiligte sich nicht so lebhaft an der Unterhaltung, wie es sonst seine Art war, und als er das Fernglas, um das ihn der Fürst gebeten hatte, wieder hervorzog, vermißte er auf einmal seine Brieftasche. Der Thurmwächter erbot sich sofort, sie zu suchen, aber Rojanow erklärte, er werde das selbst thun. Er erinnerte sich noch genau der Stelle, wo beim Heraufsteigen irgend etwas zu Boden geglitten war, das er nicht weiter beachtet hatte. Es war jedenfalls die Brieftasche gewesen, er würde sie mit leichter Mühe finden und dann die Herrschaften wieder aufsuchen. Damit grüßte er und verließ die Plattform.
[136] Egon hätte es unter anderen Umständen vielleicht sonderbar gefunden, daß sein Freund so entschieden das Anerbieten des alten Mannes ablehnte und sich selbst der Mühe des Suchens auf der dunklen Wendeltreppe unterzog, jetzt aber war er gänzlich von seinem Erkläreramte in Anspruch genommen und schien es nicht gerade ungern zu sehen, daß man ihm das Feld allein überließ. Frau von Wallmoden hatte das Fernglas angenommen, das er ihr bot, und folgte mit offenbarer Aufmerksamkeit seinen Erläuterungen, während er ihr die einzelnen Höhen und Ortschaften nannte.
„Und dort drüben, hinter jenen Waldbergen, liegt Rodeck,“ schloß er endlich, „das kleine Jagdschloß, wo wir wie zwei menschenfeindliche Einsiedler hausen, abgeschnitten von aller Welt, nur in Gesellschaft einiger Affen und Papageien, die wir aus dem Orient mitgebracht haben und die auch schon ganz melancholisch geworden sind.“
„Sie sehen aber gar nicht aus wie ein Menschenfeind, Durchlaucht,“ sagte die junge Frau mit einem flüchtigen Lächeln.
„Ich habe allerdings nicht viel Anlage dazu, aber Hartmut hat bisweilen förmliche Anfälle von dieser Krankheit, und ihm zu Gefallen vergrabe ich mich dann auch wochenlang mit in die Einsamkeit.“
„Hartmut? Das ist ja ein urgermanischer Name, und es ist auch überraschend, daß Herr Rojanow das Deutsche mit so vollkommener Reinheit, ohne jede fremdartige Beimischung spricht. Er stellte sich mir doch als Ausländer vor.“
„Gewiß, er stammt aus Rumänien, ist aber in Deutschland bei Verwandten erzogen, von denen er wohl auch den deutschen Vornamen geerbt hat,“ sagte der junge Fürst so unbefangen, daß man sah, er wußte selbst nichts anderes über die Herkunft seines Freundes. „Ich lernte ihn in Paris kennen, als ich gerade im Begriff stand, meine Orientreise anzutreten, und er entschloß sich, mich zu begleiten. Es war mein Glücksstern, der ihn mir zuführte!“
„Sie scheinen sehr eingenommen von Ihrem Freunde zu sein.“ Es lag etwas wie leise Mißbilligung in dem Tone.
„Ja, Excellenz, das bin ich auch,“ fiel Egon aufflammend ein, „und nicht ich allein! Hartmut ist eine von jenen genialen Naturen, die überall, wo sie nur erscheinen, die Menschen im Sturme erobern und gewinnen. Man muß ihn sehen und hören, wenn er sich ganz und voll giebt, ohne jeden Rückhalt, dann flammt es wie Feuer aus seiner Seele in die der anderen, dann taucht er alles um sich in Gluth und Begeisterung, reißt alles mit sich fort, und man muß ihm folgen, gleichviel wohin der Flug trägt.“
Die begeisterte Schilderung fand eine sehr kühle Zuhörerin, die junge Frau schien ihre Sinne ganz der Landschaft zuzuwenden, während sie erwiderte:
„Sie mögen recht haben, Herrn Rojanows Augen verrathen etwas davon, aber auf mich machen solche Feuerseelen einen mehr unheimlichen als sympathischen Eindruck.“
„Vielleicht weil sie den dämonischen Zug tragen, der fast immer dem Genie eigen ist. Auch Hartmut hat ihn, er erschreckt mich bisweilen damit, und doch ziehen mich gerade diese dunklen Tiefen seines Wesens unwiderstehlich an. Ich habe es wirklich verlernt, ohne ihn zu leben, und werde alles dran setzen, ihn hier in meiner Heimath zu fesseln.“
„In Deutschland? Das wird Ihnen schwerlich gelingen, Durchlaucht. Herr Rojanow hegt eine sehr geringe Meinung von unserem Vaterlande, er verrieth das vorgestern bei unserer Begegnung in ziemlich verletzender Weise.“
Der junge Fürst wurde aufmerksam. Die Worte erklärten ihm auf einmal jene kalte Zurückhaltung, deren sich Hartmut einer schönen Frau gegenüber sonst nie schuldig machte und die ihn gleich im ersten Augenblick befremdet hatte. Aber er lächelte.
„Ah, deshalb also schwieg er über das Zusammentreffen! Excellenz haben ihm vermuthlich Ihren Unwillen gezeigt; es geschieht ihm ganz recht, warum lügt er mit einer solchen Beharrlichkeit! Auch mich hat er oft genug gereizt mit dieser angeblichen Geringschätzung, die ich auf Treu und Glauben hinnahm; jetzt freilich weiß ich besser Bescheid.“
„Sie glauben nicht daran?“ Adelheid wandte sich plötzlich von der Aussicht ab und dem Sprechenden zu.
„Nein, und ich habe den Beweis dafür in Händen. Er schwärmt für unsere deutschen Landschaften! Sie sehen mich ungläubig an, Excellenz; darf ich Ihnen ein Geheimniß mittheilen?“
„Nun?“
„Ich suchte Hartmut heut morgen auf seinem Zimmer, fand ihn aber nicht; statt dessen fand ich auf seinem Schreibtische ein Gedicht, das er vermuthlich einzuschließen vergessen hatte, denn für meine Augen war es sicher nicht bestimmt. Ich habe es gestohlen ohne alle Gewissensbisse und trage den Raub noch bei mir; befehlen Sie, daß ich Ihnen den Inhalt –“
„Ich verstehe nicht Rumänisch,“ sagte Frau von Wallmoden mit kühlem Spott, „und Herr Rojanow hat sich schwerlich herabgelassen, in deutscher Sprache zu dichten.“
Egon zog statt aller Antwort ein Papier hervor und entfaltete es.
„Sie sind gegen meinen Freund eingenommen, ich sehe es und ich möchte nicht, daß Sie ihn in dem falschen Lichte betrachten, in das er sich selbst gestellt hat. Darf ich ihn mit seinen eigenen Worten rechtfertigen?“
„Bitte!“
Das Wort klang sehr gleichgültig und doch heftete sich der Blick Adelheids mit einer eigenthümlichen Spannung auf das Papier, das nur einige, augenscheinlich mit flüchtiger Hand hingeworfene Verse enthielt.
Egon begann zu lesen. Es waren in der That deutsche Verse, aber von einer Reinheit und einem Wohllaut, wie sie sonst nur einem Meister der Sprache zu Gebote stehen, und das Bild, das sie vor der Zuhörerin heraufbeschworen, trug so seltsam bekannte Züge. Tiefe, träumerische Waldeseinsamkeit, durchweht von dem ersten Hauch des nahenden Herbstes, endlose grüne Tiefen, die unwiderstehlich locken und winken mit ihren dämmernden Schatten, duftige Wiesen, überfluthet vom goldigen Sonnenlichte, stille kleine Gewässer, die in der Ferne aufblinken, und der schäumende Waldbach, der von der Höhe niederbraust. Und dies Bild hatte Leben und Sprache gewonnen, was darin klang und flüsterte, das war das uralte Lied des Waldes selbst, sein Wehen und Rauschen, sein geheimnißvolles Weben, in Worte gebannt, die wie eine Melodie das Ohr des Hörers bestrickten, und aus dem Ganzen wehte und klagte es wie eine tiefe, eine unendliche Sehnsucht nach diesem Waldesfrieden.
Der Fürst hatte anfangs warm, dann mit voller Begeisterung gelesen, jetzt ließ er das Blatt sinken und fragte triumphirend:
„Nun?“
Die junge Frau hatte regungslos zugehört, aber sie sah den Lesenden nicht an, sondern blickte unverwandt in die Ferne hinaus. Erst bei der Frage zuckte sie leicht zusammen und wandte sich dann hastig um.
„Wie meinten Sie, Durchlaucht?“
„Ist das die Sprache eines Verächters unserer Heimath? Ich glaube nicht!“ sagte Egon in voller Siegesgewißheit; aber so sehr ihn auch die Dichtung seines Freundes in Anspruch nahm, er sah es doch, wie schön Frau von Wallmoden gerade in diesem Augenblicke war. Freilich war es wohl nur die eben sinkende Sonne, die ihrem Antlitz diesen rosigen Schimmer, ihren Augen diesen Glanz lieh, denn ihre Haltung war ebenso kalt wie die Antwort:
„Es ist wirklich überraschend, daß ein Fremder die deutsche Sprache so vollständig beherrscht.“
Egon sah sie betroffen an. Das war alles? Er hatte doch einen anderen Eindruck erwartet.
„Und wie finden Sie das Gedicht selbst?“ fragte er.
„Recht stimmungsvoll, Herr Rojanow scheint in der That viel poetisches Talent zu besitzen. – Hier ist Ihr Fernglas, Durchlaucht! Ich danke; aber ich muß wohl jetzt an das Hinabsteigen denken und darf meinen Gatten nicht zu lange harren lassen.“
Egon faltete langsam das Papier zusammen und barg es in seiner Brusttasche. In seiner warmen, herzlichen Begeisterung empfand er doppelt den eisigen Hauch, der jetzt wieder von der jungen Frau ausging und der ihn bis ins Innerste hinein erkältete.
„Ich habe bereits die Ehre, Seine Excellenz zu kennen,“ sagte er. „Ich darf die Bekanntschaft doch heute erneuern?“
Ein leises Neigen des Hauptes gab ihm die Erlaubniß zu der Begleitung, sie verließen die Plattform, aber Fürst Adelsberg war etwas einsilbig geworden. Er fühlte sich in seinem Freunde gekränkt und bereute jetzt seine Aufwallung, diese Dichtung, deren poetische Schönheit ihn hinriß, einer Dame preisgegeben zu haben, die so gar kein Verständniß für Poesie besaß.
Hartmut war, als er sich verabschiedete, langsam die Wendeltreppe
[137][138] hinabgestiegen. Die angeblich verlorene Brieftasche ruhte sicher an ihrem gewohnten Platze, sie hatte ihrem Besitzer nur den Vorwand liefern müssen, um sich auf kurze Zeit frei zu machen. Adelheid von Wallmoden hatte im Laufe des Gespräches erwähnt, daß sie in Begleitung ihres Gemahls gekommen, daß er aber unten im Wirthshause geblieben sei, weil er das beschwerliche Steigen auf den steilen dunklen Stufen scheue. Hartmut konnte also ein Zusammentreffen mit ihm nicht vermeiden, aber es sollte wenigstens ohne Zeugen stattfinden. Wenn Wallmoden den Sohn des Jugendfreundes, den er ja nur als Knaben gesehen hatte, trotzdem wiedererkannte, so blieb er vielleicht doch nicht Herr seiner Ueberraschung.
Hartmut fürchtete dies Zusammentreffen nicht, wenn es ihm auch peinlich und unbequem war. Es gab nur eins auf der ganzen Welt, was er fürchtete, ein Antlitz, zu dem er nicht gewagt hätte, das Auge zu erheben, und das weilte fern, das sah er voraussichtlich niemals wieder. Jedem anderen trat er mit dem stolzen Trotze eines Mannes gegenüber, der nur sein Recht gebraucht hatte, als er sich einem gehaßten Berufe entzog. Er war entschlossen, es zu keiner Frage und keinem Vorwurfe kommen zu lassen, sondern, wenn er erkannt würde, den Gesandten in der entschiedensten Weise zu ersuchen, gewisse alte Beziehungen, mit denen er völlig gebrochen habe, als nicht mehr bestehend anzusehen. Mit diesem Entschluß trat er in das Freie.
Auf der kleinen Veranda vor dem Wirthshause saß Herbert von Wallmoden mit seiner Schwester. Der Oberforstmeister wurde durch die bevorstehende Ankunft des Hofes, dessen Jagden er zu leiten hatte, sehr in Anspruch genommen, und auch das Brautpaar war zu Haus geblieben, aber der Tag hätte zu dem Ausfluge nicht besser gewählt werden können. Die Aussicht war vollkommen klar und die Luft warm wie im Sommer.
„Dieser Hochberg ist wirklich sehenswerth!“ sagte Frau von Eschenhagen, indem sie die Augen über die Landschaft schweifen ließ. „Aber wir haben hier fast denselben Blick wie droben auf dem Thurme. Wozu da erst klettern und sich erhitzen und den Athem verlieren auf den endlosen Stufen – ich danke dafür!“
„Adelheid war doch anderer Meinung,“ entgegnete Wallmoden, mit einem flüchtigen Blick nach dem Thurme. „Sie kennt freilich keine Ermüdung und Erhitzung.“
„Und auch keine Erkältung. Das zeigte sich vorgestern, als sie so durchnäßt zurückkam, sie hat nicht einmal einen Schnupfen davongetragen!“
„Ich habe sie aber doch gebeten, künftig auf ihren Spaziergängen Begleitung mitzunehmen,“ sagte der Gesandte ruhig. „Sich im Walde verirren, einen Bach durchwaten und sich schließlich von dem ersten besten Jäger führen und zurechtweisen lassen, das sind doch Dinge, die sich nicht wiederholen dürfen. Adelheid sah das auch vollkommen ein und versprach sofort, meinem Wunsche nachzukommen.“
„Ja, sie ist eine vernünftige Frau, eine durch und durch gesunde Natur, der alles Romantische und Abenteuerliche fern liegt,“ lobte Regine. „Aber es scheint noch mehr Besuch auf dem Thurme gewesen zu sein, ich glaubte, wir seien heut die einzigen Gäste.“
Wallmoden blickte gleichgültig dem hochgewachsenen, schlanken Herrn entgegen, der soeben aus der kleinen Pforte des Thurmes trat und nach dem Wirthshause schritt; auch Frau von Eschenhagen sah ihn nur flüchtig an, auf einmal aber schärfte sich ihr Blick und sie fuhr auf.
„Herbert – sieh nur!“
„Was?“
„Den Fremden da – welche seltsame Aehnlichkeit!“
„Mit wem?“ fragte Herbert, der jetzt auch aufmerksam wurde und den Fremden genauer in das Auge faßte.
„Mit – unmöglich, das ist keine bloße Aehnlichkeit. Das ist er selbst!“
Sie war aufgesprungen, bleich vor Erregung, und ihr Blick bohrte sich förmlich in das Gesicht des Nahenden, der eben den Fuß auf die erste Stufe der Veranda setzte. Jetzt begegnete sie seinen Augen, diesen dunklen Flammenaugen, die ihr so oft aus dem Antlitz des Knaben geleuchtet hatten. und jetzt schwand der letzte Zweifel.
„Hartmut! Hartmut Falkenried, Du –“
Sie verstummte plötzlich, denn Wallmoden legte schwer die Hand auf ihren Arm und sagte langsam, aber mit Schärfe: „Du bist im Irrthum, Regine, wir kennen den Herrn da nicht!“
Hartmut stutzte, als er Frau von Eschenhagen erblickte, die seinem Blicke bisher durch das Laubwerk der Veranda entzogen gewesen war; auf ihre Anwesenheit war er allerdings nicht vorbereitet. Aber in dem Augenblick, wo er sie erkannte, trafen auch jene Worte des Gesandten sein Ohr, und er verstand nur zu gut diesen Ton, der ihm das Blut in die Schläfe trieb.
„Herbert!“ Regine sah ungewiß den Bruder an, der ihren Arm noch immer fest hielt.
„Wir kennen ihn nicht!“ wiederholte er in dem gleichen Tone. „Muß ich Dir das erst sagen, Regine?“
Sie begriff jetzt auch die Mahnung, mit einem halb drohenden, halb schmerzlichen Blicke wandte sie dem Sohne des Jugendfreundes den Rücken und sagte mit tiefer Bitterkeit:
„Du hast recht – ich habe mich geirrt.“
Hartmut zuckte zusammen und wie im auflodernden Zorne trat er einen Schritt näher.
„Herr von Wallmoden!“
„Sie wünschen?“ fragte dieser, ebenso scharf und ebenso verächtlich wie vorhin.
„Sie kommen meinen Wünschen zuvor, Excellenz,“ sagte Hartmut, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend. „Ich wollte Sie soeben ersuchen, mich nicht zu kennen. Wir sind uns also fremd.“
Damit wandte er sich um und trotzig, hoch aufgerichtet davonschreitend, trat er durch einen anderen Eingang in das Haus.
Wallmoden sah ihm mit gerunzelter Stirn nach, dann wandte er sich zu seiner Schwester.
„Konntest Du Dich nicht besser beherrschen, Regine? Wozu die Scene bei einer derartigen Begegnung! Dieser Hartmut existirt nicht mehr für uns.“
Regines Gesicht verrieth nur zu sehr, wie das Zusammentreffen sie erschüttert hatte, ihre Lippen bebten noch, als sie erwiderte:
„Ich bin kein gewiegter Diplomat wie Du, Herbert. Ich habe es noch nicht gelernt, ruhig dazusitzen, wenn einer, den ich längst gestorben und verdorben glaubte, urplötzlich leibhaftig vor mir steht.“
„Gestorben? Das war wohl nicht anzunehmen bei seiner Jugend. Verdorben? Das mag allerdings zutreffen – sein bisheriges Leben war danach!“
„Das weißt Du?“ fuhr Frau von Eschenhagen betroffen auf. „Kennst Du dies Leben etwa?“
„Wenigstens theilweise. Falkenried steht mir denn doch zu nahe, als daß ich nicht hätte nachforschen sollen, was aus seinem Sohne geworden ist. Selbstverständlich schwieg ich darüber gegen ihn und auch gegen Dich, aber sobald ich damals auf meinen Posten zurückgekehrt war, benutzte ich unsere diplomatischen Verbindungen, die ja überall hinreichen, um Nachrichten einzuziehen.“
„Nun, und was erfuhrst Du?“
„Im Grunde nur das, was sich voraussehen ließ. Zalika hatte sich mit ihrem Sohne zunächst nach ihrer Heimath gewendet. Du weißt ja, daß ihr Stiefvater, unser Vetter Wallmoden, bereits todt war, als sie nach der Scheidung zu ihrer damals noch lebenden Mutter zurückkehrte. Seitdem wurden die Beziehungen unsererseits abgebrochen, jetzt aber erfuhr ich, daß sie kurz vor ihrem Wiederauftauchen in Deutschland in Besitz der Rojanowschen Güter gelangt war.“
„Zalika? Hatte sie nicht einen Bruder?“
„Allerdings, und er war auch etwa zehn Jahre lang Herr der Güter, aber er starb unvermählt und plötzlich durch einen Unfall auf der Jagd, und da die zweite Ehe der Mutter kinderlos geblieben war, so trat Zalika allein die Erbschaft an – wenigstens dem Namen nach, denn bei dieser verlotterten Bojarenwirthschaft gehörte natürlich das Meiste den Wucherern. Gleichviel, sie fühlte sich als Herrin und plante nun jenen Gewaltstreich, mit dem sie ihren Sohn an sich riß. Einige Jahre wurde dann noch das alte, wilde Leben auf den Gütern fortgesetzt und unsinnig weiter gewirthschaftet, dann brach die Herrlichkeit zusammen. Es kam zum Bankerott und Mutter und Sohn gingen wie ein paar Zigeuner in die weite Welt hinaus!“
Wallmoden berichtete das alles mit derselben kalten Verachtung, die er vorhin Hartmut gegenüber gezeigt hatte, und auch in den Zügen seiner Schwester malte sich der Abscheu, den die pflichttreue, [139] sittenstrenge Frau vor einem derartigen Treiben empfand. Trotzdem verrieth sich eine unwillkürliche Theilnahme in ihrer Stimme, als sie fragte:
„Und seitdem hast Du nichts wieder von ihnen gehört?“
„Doch, noch einige Male! Als ich bei der Gesandtschaft in Florenz war, leitete mich ihr Name, der zufällig genannt wurde, auf die Spur; sie waren damals in Rom, einige Jahre später tauchten sie in Paris wieder auf, und von dort erhielt ich auch die Nachricht von dem Tode der Frau Zalika Rojanow.“
„Also sie ist todt!“ sagte Regine leise. „Wovon mögen sie denn gelebt haben in all den Jahren?“
Wallmoden zuckte die Achseln.
„Wovon leben all die Abenteurer, die unstet durch die Welt ziehen! Vielleicht hatten sie noch etwas gerettet aus dem Schiffbruch, vielleicht auch nicht, jedenfalls verkehrten sie in den Salons von Rom und Paris. Eine Frau wie Zalika findet ja überall Hilfsquellen und Protektion. Als Bojarentochter führte sie den Adelstitel, und die rumänischen Güter, von deren Zwangsverkauf man schwerlich wußte, mögen wohl ihre Rolle gespielt haben bei diesem Auftreten. Die Gesellschaft öffnet sich nur zu bereitwillig solchen Elementen, sobald sie sich äußerlich zu behaupten wissen, und das scheint der Fall gewesen zu sein. Durch welche Mittel – das ist freilich eine andere Frage.“
„Aber Hartmut, den sie gewaltsam mit hineinriß in dies Leben! Was mag aus ihm geworden sein?“
„Ein Abenteurer – was sonst!“ sagte der Gesandte mit vollster Härte. „Die Anlage dazu hatte er von jeher, in dieser Schule wird sie sich wohl entwickelt haben. Seit dem Tode seiner Mutter, der vor drei Jahren erfolgte, hörte ich nichts weiter von ihm.“
„Und mir machtest Du ein Geheimniß aus dem allem?“ klagte Regine vorwurfsvoll.
„Ich wollte Dich schonen, Du hattest diesen Buben, den Hartmut, nur allzusehr ins Herz geschlossen, und überdies fürchtete ich, Du könntest Dich Falkenried gegenüber zu irgend einer Andeutung hinreißen lassen.“
„Das war eine unnöthige Sorge. Ich habe es nur ein einziges Mal gewagt, von der Vergangenheit zu sprechen, ich hoffte, die starre Eisrinde zu durchbrechen, mit der er sich auch mir gegenüber umgab. Er sah mich nur an – ich werde den Blick nicht vergessen – und sagte mit einem geradezu furchtbaren Ausdruck: ‚Mein Sohn ist todt, das wissen Sie ja, Regine, lassen Sie die Todten ruhen!‘ Ich nenne den Namen sicher nicht wieder vor ihm.“
„So brauche ich Dir nicht erst Schweigen zu empfehlen, wenn Du nach Haus zurückkehrst,“ entgegnete Wallmoden. „Du solltest aber auch Willibald nichts von diesem Zusammentreffen mittheilen, seine Gutmüthigkeit könnte ihm doch einen Streich spielen, wenn er weiß, daß der einstige Jugendfreund in seiner Nähe ist; es ist besser, er erfährt nichts davon. Ich werde bei einer immerhin möglichen zweiten Begegnung diesen ‚Herrn‘ einfach ignoriren und Adelheid kennt ihn ja überhaupt nicht, sie weiß nicht einmal, daß Falkenried einen Sohn gehabt hat.“
Er brach ab und erhob sich, denn soeben trat die junge Frau mit ihrem Begleiter aus dem Thurme. Man begrüßte sich, erneuerte die Bekanntschaft von vorgestern, und Fürst Adelsberg erkundigte sich ganz harmlos, ob sein Freund Rojanow, dessen Verschwinden er sich nicht erklären konnte, hier vorübergekommen sei.
Ein Blick Wallmodens warnte seine Schwester, die diesmal auch der Ueberraschung stand hielt; er selbst bedauerte höflich, den betreffenden Herrn nicht gesehen zu haben, und erklärte zugleich, er sei im Begriff, mit seinen Damen aufzubrechen, und habe nur auf die Rückkehr seiner Frau gewartet. Der Befehl zum Anspannen wurde auch sofort gegeben, Egon leistete den Herrschaften bis zur Abfahrt Gesellschaft und begleitete sie an den Wagen. Mit einer tiefen Verbeugung verabschiedete er sich von dem Gesandten und seiner Gemahlin, aber er blickte noch minutenlang dem davonrollenden Wagen nach.
In dem Gastzimmer des Wirthshauses, wo sich sonst niemand befand, stand Hartmut am Fenster und sah gleichfalls der Abfahrt zu. Auf seinem Gesicht lag wieder dieselbe fahle Blässe wie damals, als er zuerst den Namen Wallmoden hörte, aber jetzt war es die Blässe eines wilden Zornes, der ihn fast erstickte.
Er war auf Fragen und Vorwürfe gefaßt gewesen, die er freilich hochmüthig abweisen wollte, und begegnete statt dessen einer Nichtachtung, die seinen Stolz tödlich verletzte. Die schroffe Mahnung Wallmodens an seine Schwester: „Wir kennen ihn nicht! Muß ich Dir das erst sagen?“ hatte sein ganzes Wesen in Aufruhr gebracht, er fühlte das vernichtende Urtheil, das darin lag. Und auch die Frau, die ihm stets eine mütterliche Liebe bewiesen hatte, auch Regine von Eschenhagen stimmte bei und wandte ihm den Rücken wie einem Menschen, den man sich schämt, einst gekannt zu haben – das war zu viel!
„Nun, da bist Du endlich!“ klang Egons Stimme von der Thür her: „Du warst ja wie vom Erdboden verschwunden! Hat sich die unglückliche Brieftasche denn nun endlich gefunden?“
Rojanow wandte sich um, er mußte sich erst auf den Vorwand besinnen, den er gebraucht hatte.
„Jawohl,“ antwortete er zerstreut, „sie lag auf der Wendeltreppe.“
„Nun, dann würde sie wohl auch der Thurmwächter gefunden haben. Warum bist Du denn nicht zurückgekommen? Recht artig, Frau von Wallmoden und mich so ohne weiteres im Stich zu lassen! Du hast Dich bei der Dame nicht einmal empfohlen, die allerhöchste Ungnade ist Dir gewiß.“
„Ich werde dies Unglück zu tragen wissen,“ sagte Hartmut achselzuckend; der junge Fürst kam näher und legte neckend die Hand auf seine Schulter.
„So? Vermuthlich, weil Du vorgestern schon in Ungnade gefallen bist. Es ist doch sonst Deine Art nicht, davonzulaufen, wenn es die Unterhaltung mit einer schönen Frau gilt. O, ich weiß bereits Bescheid, Ihre Excellenz haben geruht, Dir den Text zu lesen bei Deinen beliebten Ausfällen auf Deutschland, und der verwöhnte Herr hat das übelgenommen. Nun, von solchen Lippen kann man sich immerhin die Wahrheit sagen lassen.“
„Du scheinst ja ganz hingerissen zu sein,“ spottete Hartmut. „Nimm Dich in acht, daß der Herr Gemahl nicht eifersüchtig wird, trotz seiner Jahre!“
„Ja, es ist ein seltsames Paar,“ sagte Egon halblaut wie in Gedanken verloren. „Dieser alte Diplomat, mit seinen grauen Haaren und seinem kalten, unbewegten Gesicht, und diese junge Frau, mit ihrer strahlenden Schönheit wie –“
„Ein Nordlicht, das aus einem Eismeer aufsteigt! Es ist nur noch die Frage, wer von den beiden tiefer unter dem Gefrierpunkte steht!“
Der junge Fürst lachte laut auf bei dem Vergleich.
„Sehr poetisch und sehr boshaft! Uebrigens hast Du nicht ganz unrecht, ich habe auch etwas von diesem Polarhauch gespürt, der mich einige Male sehr erkältend anwehte, und das ist ein Glück, denn sonst würde ich mich rettungslos in die schöne Excellenz verlieben. – Aber ich denke, wir brechen jetzt auch auf, meinst Du nicht?“
Er ging nach der Thür, um den Diener herbeizurufen. Hartmut, im Begriff, ihm zu folgen, warf noch einen Blick hinaus, wo an einer freien Stelle des Weges der Wagen des Gesandten wieder sichtbar wurde, und seine Hand ballte sich unwillkürlich.
„Wir sprechen uns noch, Herr von Wallmoden!“ murmelte er. „Jetzt werde ich bleiben! Er soll nicht glauben, daß ich seine Nähe fliehe, jetzt werde ich mich von Egon einführen lassen und alles dran setzen, daß mein Werk einen Erfolg erringt. Wir wollen doch sehen, ob er es dann noch wagt, mich wie den ersten besten Abenteurer zu behandeln. Er soll mir diesen Blick und diesen Ton bezahlen!“
In Fürstenstein rüstete man sich zu dem Empfange des Hofes.
Es handelte sich diesmal nicht um einen kurzen Jagdausflug, sondern
um einen Herbstaufenthalt, der mehrere Wochen dauern sollte und
zu dem auch die Herzogin erwartet wurde. Die oberen Stockwerke
des Schlosses mit ihren zahlreichen Räumen wurden gelüftet und
in stand gesetzt, ein Theil der Hofbeamten und der Dienerschaft
war bereits eingetroffen und in Waldhofen traf man festliche Anstalten
für die Ankunft des Landesherrn, der auf seiner Fahrt durch
das Städtchen kommen mußte.
Auch der Aufenthalt Wallmodens, der unter anderen Umständen nur ein sehr kurzer gewesen wäre, verlängerte sich dadurch. Der Herzog, der den Gesandten in jeder Weise auszeichnete, hatte erfahren, daß dieser zu einem Familienfeste nach Fürstenstein reiste, und den bestimmten Wunsch ausgesprochen, ihn und seine Gemahlin [140] noch dort zu finden. Das war so viel als eine Einladung, der man nachkommen mußte; Frau von Eschenhagen mit ihrem Sohne wollte gleichfalls noch bleiben, um sich die „Hofgeschichte einmal in der Nähe anzusehen“, und der Oberforstmeister, der mit den voraussichtlich stattfindenden großen Jagden Ehre einlegen wollte, hatte täglich Berathungen mit seinen Ober- und Unterförstern und brachte das ganze Forstpersonal auf die Beine. Es herrschte jetzt schon ein ungewöhnlich reges Leben in dem Schlosse.
Aus dem Zimmer des Fraulein von Schönau klang lustiges Geplauder und helles, übermüthiges Lachen. Marietta Volkmar war auf ein Plauderstündchen zu der Jugendfreundin gekommen und fand wie gewöhnlich des Lachens und Erzählens kein Ende. Toni saß am Fenster und neben ihr stand Willibald, der auf Befehl seiner Mutter hier die Rolle einer Schildwache spielen mußte.
Frau von Eschenhagen hatte vorläufig ihren Willen noch nicht durchgesetzt, ihr Schwager war hartnäckig geblieben und auch bei der künftigen Schwiegertochter, die sich sonst so fügsam zeigte, stieß sie auf unerwarteten Widerstand, als sie den Abbruch jenes Verkehrs forderte. „Ich kann nicht, liebe Tante,“ hatte Toni geantwortet. „Marietta ist so lieb und brav, ich kann sie wirklich nicht so bitter kränken.“
Lieb und brav! Frau Regine zuckte die Achseln über diese Unerfahrenheit des jungen Mädchens, dem sie nicht die Augen öffnen mochte; aber sie fühlte sich verpflichtet, einzugreifen, und beschloß nunmehr, in diplomatischer Weise vorzugehen.
Willibald, gewohnt, seiner Mutter alles zu beichten, hatte ihr auch seine Begegnung mit der jungen Sängerin haarklein berichtet, und Frau von Eschenhagen war natürlich außer sich darüber gewesen, daß der Majoratsherr von Burgsdorf einer „Theaterprinzessin“ den Koffer nachgetragen hatte. Dagegen nahm sie die Schilderung seines Entsetzens, als er erfuhr, weß Geistes Kind diese Dame eigentlich sei, und seines Davonlaufens mit höchstem Wohlgefallen entgegen und fand es auch nur lobenswerth, daß er sich anfangs förmlich angstvoll gegen die ihm angesonnene Aufpasserrolle sträubte. Er scheute natürlich jede Berührung mit einer solchen Person. Da seine Mutter es aber unter ihrer Würde hielt, diesen Zusammenkünften beizuwohnen, so sollte er seine Braut beschützen.
Er erhielt gemessenen Befehl, die jungen Mädchen nie allein zu lassen und ausführlich zu berichten, wie diese Marietta sich denn eigentlich benehme. Bei dem ersten derartigen Berichte, der sicher haarsträubend ausfiel, wollte Frau Regine ihrem Schwager zu Gemüth führen, welchem leichtsinnigen Umgange er sein Kind preisgegeben hatte, wollte ihren Sohn als Zeugen aufrufen und dann gebieterisch den Abbruch dieser Beziehungen verlangen. Willibald hatte sich denn auch gefügt, er war dabei gewesen, als Fräulein Volkmar das erste Mal nach Fürstenstein kam, hatte seine Braut bei dem Gegenbesuche in Waldhofen begleitet und stand auch heute wieder auf Posten.
Fern im Süd, im schönen Spanien, trafen wir uns das erste Mal. Die Kunde von der Septemberrevolution, von der die Spanier allzukühn eine Wiedergeburt ihres Vaterlandes erhofften, hatte aus allen vier Weltgegenden Männer der Presse nach Madrid gezogen, einige von bereits anerkanntem Rufe, andere wieder erst aufkeimende Berühmtheiten, einzelne auch, denen eine nichts weniger als schöne Zukunft bestimmt war. So ziemlich alle aber waren in dem Bewußtsein einig, daß sie in dem schönen Pyrenäenland eine mindestens ebenso wichtige Sendung zu erfüllen hätten als die konstituirenden Cortes, über deren Reden und Thaten sie berichteten. Von den Franzosen thaten einige freiwilligen, andere bezahlten Dienst für den Orleanismus, indem sie sich die Finger für den Herzog von Montpensier wund schrieben, der die Verschwörung gegen seine Schwägerin Isabella angezettelt hatte; die meisten, wie E. Maison vom „Journal des Débats“, G. de Coutouly vom „Temps“, mein alter Stuttgarter Schulkamerad und nunmehr unzertrennlicher Reisegefährte in Spanien, jetzt französischer Gesandter in Bukarest, glaubten, man könne der republikanischen Sache Frankreichs nicht besser dienen, als indem man die Rückkehr der Monarchie in Spanien verhindere; die übrigen schließlich, wie Elie Reclus, später Vorstand der Nationalbibliothek, und sein Gesinnungsgenosse, der alte Garibaldiner Lucien Combatz, später Vorstand des Postwesens unter der Pariser Commune, hielten den spanischen Boden für geeignet, Bakunins anarchistische Ideen aufzunehmen. Während etliche holländische und deutsche Schwärmer für die Rückberufung der einst durch die Inquisition vertriebenen Juden wirken zu können vermeinten, arbeitete Chamerovzow vom „Morning Star“, wenn er seinen politischen Wochenbericht fertig hatte, an der Bekehrung der Spanier zum Protestantismus, indem er als Bevollmächtigter einer englischen Missionsgesellschaft Traktätchen an alle Firmen schickte, die er in einem dickleibigen spanischen Geschäftskalender fand. Einige Berufsgenossen schrieben und sprachen theils für, theils gegen die Sklavenbefreiung, ein Nordamerikaner eiferte dafür, Spanien solle, um aller seiner Schwierigkeiten los zu werden, Cuba an die Vereinigten Staaten verkaufen: kurz, es herrschte der denkbar größte Wirrwarr der Meinungen unter dem internationalen Federvolke auf der Zuhörertribüne des Kongresses, daneben aber auch, wie in freundlicher Erinnerung an jene Zeit bestätigt werden darf, ein herzlicher Verkehr der Berufsgenossen unter einander und mit den Mitgliedern der Cortes selbst. Man besuchte in Gesellschaft die herrlichste Gemäldesammlung der Welt im Museo real, die Stiergefechte und Hahnenkämpfe, Volkssänger und Tänzer, Schauspielhäuser und öffentlichen Bälle und lud sich zu gemeinsamer Tafel ein. Mehr als einmal schickte der Präsident des Hauses, zu dessen Vollmachten auch die Vertheilung von Bonbons unter die Kongreßmitglieder gehörte, die süßesten seiner Süßigkeiten, die Mahonesas (Bonbons aus Mahon) zu uns Herren von der Feder herauf. Und mehr als einmal vereinigten sich Abgeordnete, denen wir zu ihren rednerischen Erfolgen Glück gewünscht hatten, mit uns zur Plünderung eines mit Leckereien und Malagafläschchen gefüllten Korbes, der den Weg vom Abgeordnetenbuffet zu uns gefunden. Neues Leben brachte noch in unsern Kreis ein Paar seltsamer Käuze, das mit dem Anfang des Juni (1869) aus Paris angerückt kam: der eine, klein und bucklig, das blasse, geistvolle, semitische Gesicht von einer undurchdringlichen Mähne schwarzen Haares eingefaßt, der andere, eine lange, dürre Hopfenstange, mit mongolischer Gesichtsbildung, die rothblonden Haare kurz geschoren. Jener, Alfred Naquet, damals noch Chemiker seines Zeichens und wüthender Republikaner, später Senator und Urheber des berühmten Ehescheidungsgesetzes in Frankreich und darnach Schleppträger des Generals Boulanger; dieser der fruchtbare russische Romandichter und panslavistische Wühler Boborykin: beide natürlich gleichfalls mit unfehlbaren Allheilmitteln für die Rettung Spaniens versehen. Leider konnten sie dieselben aber nicht öffentlich anpreisen, denn sie litten dermaßen unter der allerdings schon zu Anfang des Sommers sehr starken Hitze, daß sie vorzogen, ihre Tage in einem dunkel verhängten Zimmer und abwechselnd in einer stets aufs neue mit frischem Wasser gefüllten Badewanne zuzubringen. Ein unvergeßlicher Anblick, wenn, einem Böcklinschen Meergreise vergleichbar, Naquet in der Wanne kauerte, während sein russischer Freund im Bademantel mit Riesenschritten das Zimmer auf- und abwandelte oder der letztere seine dürren Beine über den Rand der Wanne heraushing und den Strom der südfranzösischen Beredsamkeit seines auf einem Lehnstuhl neben ihm hockenden Freundes über sich ergehen ließ!
In welche Kategorie von Politikern und Menschen gehörte aber der letzte fremde Ankömmling, der mit einem Mal auf unseren Bänken erschien? Es war ein untersetzter, breitschulteriger Mann, eher einem kühnen Geschäftsunternehmer als einem Schriftsteller ähnlich, mit blitzenden, durchbohrenden Augen unter kraftvoll herausgewölbter Stirne, die Backenknochen stark hervortretend, die Oberlippe mit einem dünnen Bärtchen bedeckt, das Kinn energisch herausgearbeitet, das dichte, dunkle Haupthaar nach rückwärts gestrichen. Schweigend pflegte er einige Tage hindurch in unserer Mitte Platz zu nehmen; die Verhandlungen über die neue spanische Verfassung schienen ihm nur geringer Aufmerksamkeit würdig; um so eifriger beobachtete er das Gebahren der maßgebenden Persönlichkeiten der Revolution, Prims, Serranos, [141] Topetes u. a. Das Eis brach denn auch, als Prim einmal ein besonders heftiges Donnerwetter gegen die Republikaner losließ; da zupfte er mich am Aermel und frug mich: „Prim es muy …“ (Prim ist sehr …), ohne im Spanischen weiter zu können; ich suchte ihm mit dem Französischen auf die Spur zu helfen, aber ohne Erfolg. Er kam erst ins richtige Fahrwasser, als ich ihm mit Englisch aufwartete. Nun wurde er warm und entwickelte mir im Fluge seine Meinung, daß alle die langen Verhandlungen über die beste Regierungsform keinen Deut werth seien und alles vielmehr davon abhänge, welcher der Revolutionsgenerale in der entscheidenden Stunde die größte Entschlossenheit und Macht besitze. Es schien ihn zu freuen, daß ich dieser seiner Ansicht eine gewisse Berechtigung zuerkannte, und er stellte sich nun als Henry Stanley, Berichterstatter des „New-York-Herald“, vor.
Im Unterschiede von den anderen fremden Berufsgenossen, die in Gasthöfen oder sogenannten Casas de Huespedes wohnten, hatte sich Stanley gleich nach seiner Ankunft in Madrid häuslich eingerichtet; dies habe er auch in Frankreich, woher er komme, überall so gehalten. Und wie behaglich es sich unter seinem Zelte leben ließ, erfuhren wir alsbald, als wir, Coutouly, Boborykin, Naquet und ich, seiner Einladung zum Essen folgten. Der amerikanische Kollege erfüllte seine Wirthspflichten aufs gewandteste und liebenswürdigste; Speisen und Getränke ließen nichts zu wünschen übrig; und was uns Stanley vom abessinischen Feldzuge, den er mitgemacht hatte, zu erzählen wußte, war für mich wenigstens ebenso anregend wie Boborykin; und Naquets Scherzchen aus dem Lateiner Viertel zu Paris. Einmal platzten freilich die Geister etwas lebhaft auf einander, als Stanley, dessen stärkste Leidenschaft damals sein Yankeestolz war, die Verdienste der Nordamerikaner um die Menschheit denjenigen der alten Kulturvölker Europas gleich stellte und sich hierfür im wesentlichen auf die Zahl der in Amerika gedruckten Bibeln und die Leistungen der amerikanischen Wohlthätigkeitsanstalten berief. Wohl mochte Boborykin beim Nachhausegehen bedenklich den Kopf darüber schütteln, wir hatten aber doch schon damals den Eindruck einer ungewöhnlich starken Persönlichkeit. Und zwei Dinge sind mir von dem jungen Stanley besonders lebhaft in der Erinnerung geblieben, sein Berufseifer und die Liebe zu seiner Mutter und Schwester, von denen er mir oftmals sprach, während er sonst eine geringe Achtung vor dem weiblichen Geschlechte zur Schau trug.
Gegen Mitte des Monats Juni erging von seiten einiger spanischer Freunde an die Vertreter der auswärtigen Presse die Einladung zu einer Fahrt nach dem schönen Andalusien. Auch Stanley schloß sich uns an, und ich weiß, daß manchmal auch ihn in den afrikanischen Urwäldern und Wüsteneien die Erinnerung an unsere damaligen phantastischen Erlebnisse erheitert hat. Wer weiß, welcher Begriff von unserer Bedeutung und unserem Einfluß in der Welt den ohnedies leicht erregbaren südspanischen Bevölkerungen beigebracht worden sein mochte: kurz, als wir in der sonst so stillen Stadt Cordoba anlangten, wurden wir durch die Hochrufe von Tausenden, durch Ansprachen des Alcalden und verschiedener Arbeiterabgesandtschaften empfangen und in feierlichem Zuge nach der Fonda de Suiza (Schweizer-Hof) geleitet, wo ein Festmahl unser harrte. Auf die Willkommreden der Vertreter der Provinz und des Gemeinderathes von Cordoba hieß es nun, in gleichfalls möglichst begeisterungsvoller Rede zu antworten; die Franzosen entledigten sich zumeist ihrer Aufgabe, indem sie feurige Glückwünsche auf die nahe Verkündigung der spanischen Republik ausbrachten; ich sprach von der stolzen Stellung Spaniens im Schriftthum der Welt; und endlich erhob sich Stanley, wie wenn er sich auf der Platform eines nordamerikanischen Wahlbezirkes befände, um mit Donnerstimme, und indem er sich häufig mit der Faust auf seine wie ein Faß erdröhnende Brust schlug, in viertelstündiger Rede auszuführen, die Zeit der lateinischen Rasse in der Neuen Welt gehe zu Ende, die Angelsachsen allein seien berufen, das Sternenbanner der Freiheit und Gesittung von einem Ende Amerikas bis zum andern zu tragen. Zum Glück sprach er englisch, das die spanischen Zuhörer nicht verstanden; aber es bedurfte immerhin einer sehr diplomatischen Uebersetzungskunst, um einen ungünstigen Eindruck dieser rednerischen Leistung Stanleys abzuwenden. Eine ernstere Verwicklung drohte sich an einen andern Zwischenfall dieses Tages zu knüpfen. Wir hatten, auf die Einladung des Gemeinderathes, vom Balkon des Rathhauses aus einer Volksversammlung angewohnt, in der, wie damals üblich, die opfermuthigsten Beschlüsse zu Gunsten der Republik gefaßt wurden, und wir waren, ohne übrigens die Sache weiter zu beachten, einigermaßen erstaunt, als uns Stanley abends mittheilte, er habe ein Kabeltelegramm von mehreren hundert Worten über die Vorgänge des Tages nach New-York geschickt. Die Frage, was ihm denn so wichtig erschienen sei, ließ er unbeantwortet. Als wir aber von der Rundfahrt durch Sevilla, Cadiz und andere andalusische Städte, wo sich die Festlichkeiten von Cordoba wiederholten, nach Madrid zurückgekehrt waren, sahen wir zu unserem allerdings nicht geringen Staunen den langen Drahtbericht im „New-York-Herald“, dem zufolge am Tag unserer Anwesenheit in Cordoba ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den Monarchisten und Republikanern ausgebrochen und die letztere Partei Sieger geblieben wäre!
Bei Stanley waren die rauschenden Redensarten der Volksredner auf der Stelle zu blutigen Thatsachen geworden. Aber der Russe Boborykin kam schlecht weg, als er dem Amerikaner Vorstellungen hierüber machen wollte. Stanley gab ihm gar keine Antwort, sondern eilte zu mir mit dem Ansinnen, seine Forderung an Boborykin zu überbringen, der außer acht gelassen habe, daß sich ein Gentleman nicht in die Geschäfte eines andern mengen dürfe! Zum Glück gelang es, wieder einen leidlichen Frieden zwischen den beiden Heißspornen herzustellen, und die übrige Zeit, die wir noch zusammen auf spanischem Boden zubringen durften, verlief ohne aufregenden Zwischenfall. Aus jenen spanischen Tagen stammt die mir gewidmete Photographie Stanleys, deren Nachbildung diesem Aufsatze beigegeben ist.
Als wir von einander Abschied nahmen, gaben wir uns Stelldichein in – Afrika. Und ich freute mich nicht wenig darauf, an Stanley, namentlich wegen seiner gerühmten Kenntniß des Arabischen, einen tüchtigen Führer drüben zu finden. Nun wollte es der Zufall, daß ich nach langen Monaten eines Abends auf dem Esbekieh-Platz in Kairo mit ihm zusammentraf und ihm mit meinen paar Brocken Arabisch im Handel mit einem Eseltreiber half, mit dem er sich nicht verständigen konnte. Wir machten nun mehrere Ausflüge in die Umgebung der ägyptischen Hauptstadt und schließlich in größerer Gesellschaft die herrliche Fahrt nach den Nilfällen bei Philä. Vor einigen Wochen erst hatte [142] ich Gelegenheit, mit L. Pietsch, der sich in unserer Mitte befand, die mancherlei Erlebnisse dieser Nilreise wieder durchzusprechen. Mit Stanley befanden sich auf einem Boote u. a. der berühmte, inzwischen verstorbene Berliner Archäolog Professor Friedrich und die Franzosen Cambon und Elie Reclus. Diese wunderten sich sehr, daß Stanley sich allabendlich unter englische Reisewerke über Aegypten vergrub und ohne aufzublicken dicke Hefte daraus zusammenschrieb. Auf die Frage, was er da mache, erwiderte Stanley, er schreibe an einem Geschichtswerke über Aegypten; die Frage, ob er denn Altägyptisch verstehe, verneinte er. Als sich darob das Gemüth des deutschen Gelehrten Friedrich entsetzte, sagte Stanley stolz, er habe auch, ohne ein Wort Griechisch zu kennen, eine in Amerika vielgelesene Geschichte Griechenlands verfaßt; dies war mehr, als der deutsche Gelehrte vertragen konnte; es fiel das Wort „Leichtfertigkeit“ von der einen, „Schulfuchserei“ von der andern Seite, und ein peinlicher Zusammenstoß war jeden Augenblick zu befürchten. Bei mir beklagte sich Stanley bitter über die alten Zöpfe, die aus Mißgunst die aufstrebenden Jungen niederzudrücken suchten. Es stand sich hier auch wirklich die Alte und die Neue Welt in unversöhnbarem Gegensatze gegenüber. Inzwischen ließ sich Stanley doch über die wahren Gesinnungen und Beweggründe des deutschen Gelehrten aufklären und er blieb einige Tage recht nachdenklich, als ihn E. Reclus mit folgenden Worten vor den Scheideweg gestellt hatte: „Wollen Sie durch Ihre Werke einen kleineren Kreis auserwählter Geister befriedigen, so müssen Sie allerdings einige Jahre Ihres Lebens opfern, um auf irgend einer Hochschule nachzuholen, was Ihnen an klassischer Bildung fehlt; ist es Ihnen aber bloß darum zu thun, bei den Massen in Ihrem Vaterlande sich einen Namen zu machen und sich hierdurch vielleicht eines Tages den Posten eines Senators zu erobern, so fahren Sie getrost auf dem bereits eingeschlagenen Wege fort.“
Stanley dankte es einem gütigen Geschicke, daß seine ungeschulte, aber auch unbeugsame Arbeits- und Thatkraft bald in eine Bahn gelenkt wurde, aus der er mit der Weltberühmtheit zugleich die Anerkennung der ernsten Männer der Wissenschaft ernten durfte. Noch bevor wir uns trennten, hatte Stanley Ursache, seinerseits mir einmal den Kopf tüchtig zu waschen. Wir lagerten nach glücklich vollendeter Bergfahrt bei frohem Mahle unter den Tempel-Ruinen von Philä, als ein Mitglied der Expedition S. Bakers, von der ein Theil noch bei Assuan vor Anker lag, mit dem Antrage bei mir erschien, ich solle mich dem englischen Unternehmen als Geschichtschreiber desselben anschließen. Das Abenteuer einer mit bis dahin unerhört großartigen Vorbereitungen unternommenen Fahrt nach Innerafrika war für einen jungen, gesunden Mann verlockend genug; auch die äußeren Bedingungen entsprachen so ziemlich; ich hätte rasch nach Kairo zurückfahren, meine Ausrüstung daselbst auf Bakers Kosten bewerkstelligen und dann so schnell als möglich zur Mannschaft desselben stoßen sollen. Stanley war denn auch die ganze Zeit hinter mir her, ich solle mit beiden Händen zugreifen. Es war aber ein Punkt in dem Antrage, der nur nicht zu Sinne wollte; ich hätte mich auf fünf Jahre verpflichten müssen und dieses Zeitopfer schien mir besonders deswegen zu groß, weil ich als Laie in den Naturwissenschaften mir keinerlei dauernden Gewinn fürs Leben von der Theilnahme an dem Unternehmen versprechen konnte. Als ich denn endgültig ablehnte, fand Stanley nicht Worte genug, mich ob einer solchen Unbegreiflichkeit auszuschelten. Er selber hatte freilich auch kaum Lust, statt meiner einzutreten, denn er wollte damals nichts mit Engländern zu thun haben.
Im übrigen hat sich später das Geschick der Expedition
Bakers mit dem persönlichen Geschick Stanleys auf eine wundersame
Weise verflochten, von der nicht viele Kenntniß haben dürften.
Man kennt die romantische Geschichte, wie der reiche Besitzer des
„New-York-Herald“ eines Tages seinen Berichterstatter Stanley
nach Paris zu sich berief und ihm in einer Unterredung von
wenigen Minuten den Auftrag und die Mittel gab, Livingstone
zu suchen. Es war aber beim Gelingen der Fahrt zu Livingstone
wie beim frühen Mißlingen der Bakerschen Expedition auch der Einfluß
des damaligen Khedive Ismail Pascha sehr erfolgreich thätig
gewesen. Der Khedive, der Baker anfangs in jeder Weise gefördert,
ihm ägyptische Soldaten zum Schutze mitgegeben und ihn mit
Empfehlungen an die innerafrikanischen Stammeshäuptlinge ausgestattet
hatte, wurde bald von Mißtrauen beschlichen, daß die Engländer
bei ihrem Vordringen neben den wissenschaftlichen auch für
ihn sehr bedenkliche politische Zwecke verfolgten. Seinen Verdacht
bestärkten die Briefe Bakers an den Prinzen von Wales, die sein
schwarzes Cabinet in Kairo erbrach und ihm vorlegte, und die, mit
bösen Bemerkungen über des Khedive zweideutige Haltung, insbesondere
seine Beziehungen zu den Sklavenhändlern im Innern erfüllt,
zu seinem immer größeren Verdrusse, regelmäßig nachdem sie der
Prinz von Wales gelesen hatte, wortgetreu in der „Times“ ab-
gedruckt wurden. Dafür wußte sich nun der Khedive in doppelter
Weise zu rächen. Zunächst begegnete der Weitermarsch Bakers,
dem zuvor alle Wege geebnet schienen, mit einem Male solchen
Schwierigkeiten, daß bald nichts anderes als die Rückkehr der
Expedition übrig blieb. Und dann konnte dem englischen Nationalgefühl,
das noch nicht so dickhäutig war wie bei der späteren
Preisgebung Gordons, der empfindlichste Schlag versetzt werden,
wenn es ein Amerikaner mit Erfolg unternahm, Livingstone aufzusuchen,
zu dem keiner seiner englischen Landsleute mehr vorzudringen
wagte. In Stanley, der sich damals noch längere Zeit
in Kairo aufhielt, hatte Ismail Pascha den richtigen Mann zur
Ausführung seines Gedankens gefunden; und wir glauben auch in
diesem Punkte, daß der Ruhm, den sich Stanley mit der Reise zu
Livingstone und mit allen seinen späteren afrikanischen Thaten verdiente,
nur noch heller erstrahlen muß, wenn man auf seine kleinen
Anfänge vor zwanzig Jahren zurückblickt. Stanley selber bewahrt
jenen Zeiten, die doch so weit hinter ihm liegen, eine lebendige,
freundliche Erinnerung, und so oft er aus dem Dunkel Afrikas wieder
zum Licht emportaucht, beweist er durch Briefe voll rührender Anhänglichkeit
an seine Freunde, daß in seiner von dreifachem Erz umschirmten
Brust ein gutes und treues Herz schlägt.
W. Lauser.
Die Erforschung der Meere.
Wir haben am Schluß unseres vorhergehenden Artikels[1] das offene Meer mit der Steppe verglichen, auf welcher allerlei Thiere in Scharen von Weide zu Weide ziehen. Schon die frühere Forschung hat uns interessante Einblicke in die Lebensgeheimnisse der Meeresthierwelt enthüllt. Auf der Hochsee begegneten wir neben den Fischen auch zahllosen winzigen Geschöpfen, wir möchten nur an die Foraminiferen, Radiolarien und namentlich die winzigen Algen erinnern. Die letzteren bedecken oft große Strecken des Meeres, und so sahen z. B. die Naturforscher des „Challenger“ auf ihrer Fahrt tagelang solche Anhäufungen von Diatomeen, wahre Algenwiesen, die gleich Sümpfen rochen. Diese Pflänzchen, diese winzigen Thiere, selbst viele von einer Größe, die man noch ganz gut mit unbewaffnetem Auge unterscheiden kann, können gegen die Gewalt der Wogen nicht ankämpfen, sie müssen willenlos den Meeresströmungen folgen, sind ein Spiel von Wind und Wellen, und Professor Viktor Hensen hat diese Gesammtmasse der Organismen mit dem Namen „Plankton“ bezeichnet, sie bilden den „Auftrieb“ des Meeres, von dem sie umhergeworfen werden, wie der vielgewanderte Odysseus, der gleichfalls so sehr „umhergetrieben“ wurde, wie Homer von ihm singt.
Keine der Expeditionen zur Erforschung der Meere, die wir bis jetzt erwähnt haben, hat sich eingehender mit diesem Plankton beschäftigt, ja es fehlten sogar der Wissenschaft Mittel, um ein genaueres Beobachten dieser winzigen Wesen zu ermöglichen, in wie weit dieselben in dem großen Haushalt des Meeres in Frage kommen. Niemand wagte sich an die schwierige Ausgabe, den Auftrieb des Meeres zu zählen und aus den gewonnenen Zahlen untrügliche Schlüsse zu ziehen; auf den ersten Blick mochte auch ein derartiges Unterfangen ebenso mühsam erscheinen, wie wenn man den Sand am Meeresufer hätte zählen wollen.
- ↑ Siehe Halbheft 3 dieses Jahrgangs.
[143] Dem Scharfsinn und der Ausdauer eines deutschen Forschers ist es gelungen, diese Aufgabe zu lösen, und seine Mühe wurde aufs reichlichste belohnt, indem seine Planktonstudien der Wissenschaft neue Bahnen eröffneten. Dieser Begründer des neuen Forschungszweiges ist Prof. Viktor Hensen in Kiel.
Zunächst ersann er ein Netz, mit dem er diese zumeist unsichtbaren Wesen fangen konnte: das „Planktonnetz“, welches aus drei Theilen besteht. Oben ist ein Trichter aus undurchlässigem Zeug angebracht, durch welchen das Wasser in das eigentliche Netz gelangt. Dieses ist aus Müllergaze Nr. 20 gearbeitet, einem feinen Seidengewebe, dessen Maschen nur 0,05 mm weit sind und nur den allerkleinsten Organismen, wie den Bakterien, freien Durchgang gestatten. Unter diesem Netz befindet sich endlich ein Eimer, dessen untere Wandungen gleichfalls aus Müllergaze Nr. 20 hergestellt sind. Das Wasser, welches das Netz durchlaufen hat, gelangt in den Eimer. Das Planktonnetz ist nicht groß; seine obere Oeffnung beträgt nur 0,1 qm.
Mit diesem Netze wird in folgender Weise „gefischt“: man senkt es in die Tiefe hinab – wir wollen annehmen 20 m tief. Hierauf wird es langsam heraufgezogen. Was nun vorgehen muß, ist klar. Die ganze Wassersäule, die sich über der Netzöffnung befindet, sickert durch das Netz hindurch, sie wird bei dem langsamen Heraufziehen förmlich filtrirt; die kleinen Organismen bleiben auf dem Filter, d. h. im Netze, zurück und selbst diejenigen, welche durch die engen Maschen des Netzes hindurchgeschlüpft sein sollten, werden von dem zweiten Filter des Eimers festgehalten. Ist das Netz wieder an die Oberfläche gelangt, so wird der Inhalt durch einen kräftigen Wasserstrahl in den Eimer ausgespült und dann das Plankton in einen Glascylinder gegossen, wo es sich am Boden sammelt.
Wir haben bei unserem Versuch mit 20 m Tiefe eine Wassersäule filtrirt, die 20 m hoch ist und eine Grundfläche von 0,1 qm besitzt – in dieser Säule sind 2 cbm Wasser enthalten; die Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß beim Heraufziehen des Netzes 10 Prozent dieser Wassermasse seitlich abfließen, ohne filtrirt zu werden; wir haben somit in dem Glascylinder diejenige Menge des Planktons gesammelt, welche in 1,8 cbm Wasser enthalten ist; wir können sie zählen, wie man die Blutkörperchen unter dem Mikroskope zählt, und daraus den Reichthum bestimmter Meeresgebiete an diesen winzigen Organismen berechnen.
Prof. Hensen hat zuerst seine Planktonstudien in der Ostsee gemacht. Hier als Beispiel die Aufzählung dessen, was man einmal in 1,8 cbm Ostseewasser gefunden. Es befanden sich darin gegen 5 700 000 große und kleine Organismen. Die Hauptmasse bildeten die Algen, an Peridineen befanden sich in dieser Wassermenge fast 5 Millionen, an Diatomeen 630 000 Stuck; dann waren kleine Krebschen, Copepoden oder Ruderfüßler, in der beträchtlichen Zahl von 80 000 Individuen vorhanden, der Rest von 10 000 Stück vertheilte sich auf verschiedene andere Thierarten.
Was lehren uns diese Zahlen? Sehr viel; denn sie zwingen uns, unsere alte Anschauung über das Meer von Grund aus zu wechseln. Die Salzfluth galt uns immer als etwas unfruchtbares, und wie sehr thaten wir ihr Unrecht! Vergleichen wir sie mit den Wiesen des Festlandes, welche zahllosen Herden Nahrung bieten! Ein Quadratmeter Wiesenland erzeugt im Durchschnitt 179 g Heu. Denken wir uns nun die Meeresfläche bis zu 50 m Tiefe gleichfalls als ein Wiesenland und fragen, wie viel Heu, d. h. trockene organische Substanz, die auf dieser Wiese lebenden winzigen Pflänzchen des Planktons liefern! Die Forscher geben uns in betreff der Ostsee die Antwort, daß 1 Quadratmeter derselben 150 g dieser Substanz liefere; somit erzeugt die oberste Fläche des Meeres beinahe ebensoviel an pflanzlicher Nahrung wie unsere Wiesen und sicher mehr als die dürren Hochebenen Tibets, in denen so große Herden von wilden Yaks, wilden Kulanpferden und Antilopen gedeihen.
So erscheint uns an der Hand dieser Zahlen das Meer keineswegs als die unfruchtbare Salzfluth; vor unseren geistigen Augen enthüllt es sich als eine grünende Flur, auf welcher die pflanzenfressenden Seethiere reichliche Nahrung finden können, in der sie wirklich weiden wie die Büffel und Antilopen auf der Steppenflur! Und wie auf den Festlandswiesen der Graswuchs mit den Jahreszeiten wechselt, so scheint auch der Reichthum der winzigen Pflänzchen in dem Meere Schwankungen unterworfen zu sein, scheint auch hier ein Aufblühen und Verwelken zu herrschen. Wir stehen erst am Anfang dieser Forschung, aber wir können bereits auf deren hohe Bedeutung hinweisen. Von den Algen nähren sich manche Fische, wie z. B. die Sardinen, von ihnen leben auch die frei umherschwimmenden Copepoden, welche oft in großen Massen das Meer bedecken und wieder von den Häringen verzehrt werden. Daraus erhellt die Bedeutung des Planktons in dem Haushalt des Meeres und vor allem die Bedeutung desselben für die Ernährung der Nutzfische. In den pflanzlichen Bestandtheilen des Planktons haben wir die „Urnahrung“ aller Seethiere vor uns; denn nur die grüne Pflanzenzelle vermag aus anorganischen Stoffen organische zu erzeugen, und die großen Algen und Tange, die an den Küsten wachsen, liefern nicht genug Vorrath, um die ungeheuren Bedürfnisse aller Seethiere zu decken. Sicher erhalten auch die Thiere der Tiefsee einen Theil ihrer Nahrung aus den oberen durchleuchteten Räumen, in welchen Pflanzen noch gedeihen.
Diese Beispiele mögen genügen, um dem Leser die Natur und die hohe Bedeutung der Planktonforschung verständlich zu machen. Ihr Begründer, Prof. Hensen, konnte bis vor kurzem nur die deutschen Meere, die Ostsee und die Nordsee, untersuchen, für die Wissenschaft war es aber dringend wünschenswerth, diese Forschungen auch auf andere Meere, namentlich aber auf den freien Ocean auszudehnen. Ein deutscher Forscher hatte in der Meereskunde eine neue Bahn eröffnet, die erste größere Expedition, welche zur Erforschung des Planktons in den Ocean hinaussteuerte, sollte auch eine deutsche sein. Dank dem Entgegenkommen des deutschen Kaisers wurden aus verschiedenen Fonds die Mittel gewährt, welche eine Forschungsfahrt nach dem Atlantischen Ocean ermöglichten, und unter der Leitung Viktor Hensens fand im vorigen Sommer die „deutsche Plankton-Expedition“ auf dem Dampfer „National“ statt. Als Zoologen schlossen sich der Expedition Prof. Brandt und Dr. Dahl an, als Botaniker wurde Dr. Schütt gewählt; Prof. Krümmel übernahm den Theil der Aufgaben, die sich auf die Physik des Meeres bezogen, während Prof. Dr. Fischer als Arzt der Expedition sich mit Untersuchung der noch äußerst wenig bekannten Bakterien des Meeres beschäftigte.
Mitte Juli begann die Fahrt, über deren äußeren Verlauf die Tageszeitungen ausführlich berichtet haben. Die Reise an und für sich war eine merkwürdige. Der „National“ wandte sich zunächst nach Norden, wo er die Grenze des Treibeises erreichte und wo Eisberge in Sicht kamen; dann steuerte er durch die Nebel der Neufundlandbank nach dem Golfstrome, bei welcher Gelegenheit die Forscher in 24 Stunden aus dem Winter in den vollen heißen Sommer gelangten, fliegende Fische, weiße Tropikvögel, treibende Bündel des Sargassotanges, belebt mit den ihm eigenthümlichen Krebsen und Fischen, erblickten. Von den Bermudainseln kreuzten sie dann das Sargassomeer, besuchten die Kapverdischen Inseln und dampften nach der einsamen Insel Ascension, die wie ein Schiff vor Anker im Ocean liegt. Von Para an der brasilianischen Küste wollten sie in den Amazonenstrom eindringen, um auch das Plankton eines tropischen Riesenflusses zu untersuchen. Die unzuverlässigen Lotsen setzten jedoch den Dampfer wiederholt auf eine Sandbank, so daß dieser Theil des Programms unausgeführt bleiben mußte. Anfang November kehrte die Expedition nach Kiel zurück; hier aber können die gelehrten Mitglieder noch nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, im Gegentheil, daheim beginnt erst für sie die langwierigste Arbeit.
Die Bestimmung und Zählung eines Fanges mit dem Planktonnetz ist mühseliger, als viele von unseren Lesern denken dürften. In der Ostsee ist das Plankton ziemlich gleichmäßig zusammengesetzt, und dennoch erfordert die Auszahlung eines Fanges 8 Tage, den Tag zu 8 Arbeitsstunden berechnet. Im Ocean ist der Reichthum des Planktons an Arten größer und das erschwert derart die Arbeit, daß bei jedem Oceanfang etwa 14 Tage zum Auszählen nöthig sein werden. Die Expedition hat nun 140 Planktonfänge gemacht, und so wird es noch lange dauern, bis das mitgebrachte, konservirte Material genau bestimmt sein wird, bis die vollen Ergebnisse vorliegen werden. Aber schon heute ist es möglich, einige Ergebnisse der Expedition nach den Berichten, welche Prof. Krümmel und Prof. Brandt in der „Gesellschaft für Erdkunde“, in Berlin abgestattet haben, mitzutheilen.
Man war von der Vermuthung ausgegangen, daß sich überall auf hoher See eine aus kleinsten Thieren und Pflanzen bestehende treibende Masse vorfinden müsse, welche gleichmäßig [144] genug vertheilt sei, um zu gestatten, daß aus wenigen Fängen ein Rückschluß aus den belebten Inhalt weiter Meeresstrecken gemacht werde. Diese Vermuthung hat sich für die von dem „National“ durchlaufene Strecke von 28 900 km als richtig erwiesen, sie dürfte daher auch für die Meeresflächen der ganzen Erde richtig sein. Aus den Fängen läßt sich schon heute nach oberflächlicher Schätzung bestimmen, daß der Ocean, was die Masse anbelangt, verhältnißmäßig weniger Plankton enthält als die Ostsee; es konnte auch bereits festgestellt werden, daß die nördlichen Theile des Atlantischen Oceans reicher an Plankton sind als die südlichen, während man doch zu der Annahme geneigt war, daß gerade die Fülle von Wärme und Licht unter den Tropen ein reicheres Thier- und Pflanzenleben in der Salzfluth erzeugen müsse.
Aber auch nach anderen Richtungen hin führte die Expedition zu wichtigen Beobachtungen.
Auf Grund des Berichtes von Prof. Krümmel können wir unsere früheren Mittheilungen über die Durchsichtigkeit des Meereswassers (vergl. den 2. Artikel in Halbheft 3) erweitern. Zur Messung derselben wurde u. a. eine große Segeltuchscheibe in die Tiefe versenkt, und die Anwendung derselben förderte in der Sargassosee ein überraschendes Ergebniß zu Tage. Die Sargassosee war arm an Thieren. „Dagegen bewunderten wir,“ berichtet Prof. Krümmel, „das unvergleichlich transparente Blau und die erstaunliche Durchsichtigkeit des Wassers, in welchem die Planktonnetze immer in 40 m, die große Segeltuchscheibe einmal in 58 m Tiefe, das andere Mal in 66 in Tiefe gesehen wurden.“ Das ist die größte bekannte Sichttiefe der Meere.
Sehr wichtig waren ferner die Ergebnisse, welche das Schließnetz lieferte. Die Netze der früheren größeren Expeditionen zur Erforschung der Meere hatten keine Schließvorrichtung, sie wurden offen hinabgelassen und offen heraufgezogen. Bei dieser Art des Fanges war die Bestimmung der Tiefe, in welcher die frei umherschwimmenden Thiere gefangen wurden, eine mißliche. Wenn z. B. das Netz aus einer Tiefe von 1500 m heraufgeholt wurde, so brauchten die Thiere, die in demselben sich gefangen hatten, durchaus nicht aus dieser Tiefe zu stammen; sie konnten auch unterwegs, in höheren Schichten, in das Netz gelangt sein. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat man Netze ersonnen, die wie eine Reisetasche geschlossen hinabgelassen werden, beim Heraufziehen aber sich selbstthätig öffnen und nach Durchlaufen einer gewissen Strecke wieder selbstthätig schließen. Mit diesen Netzen kann man also beliebige Wasserschichten zwischen dem Meeresboden und der Oberfläche abfischen und mit Sicherheit behaupten: der Fang stammt aus dieser oder jener Tiefe, z. B. aus der Wasserschicht von 3500 bis 2000 m Tiefe. Dieses Schließnetz, welches v. Petersen, der frühere Ingenieur der deutschen zoologischen Station in Neapel, erfunden hat und welches von Prof. Chun in Königsberg und Prof. Hensen vervollkommnet wurde, kam auch bei der deutschen Planktonexpedition zur Anwendung.
Die Schließnetzzüge bestätigten zunächst die Annahme, daß das Leben vorzüglich an der Oberfläche und am Grunde des Meeres vertreten ist, während die dazwischen liegenden Schichten arm an Thieren sind. Fünf Schließnetzzüge aus 3500 bis 2000 m Tiefe ergaben von Thieren, die man mit bloßen Augen sehen konnte, nur zwei Arten: einige Copepoden und Phaëdarien (Strahlenthiere).
In einer Beziehung aber war das Ergebniß des Schließnetzes durchaus unerwartet: aus 2200 bis 1000 m Tiefe wurden mit ihm einmal zahlreiche lebende Exemplare einer winzigen Meeresalge Halosphaera viridis herausgeholt, während man doch nach dem Ausspruche der Naturforscher des „Challenger“ in etwa 350 m Tiefe die äußerste Grenze der Pflanzenverbreitung im Meere gefunden zu haben glaubte!
Der Hauptnachdruck war jedoch bei dieser Expedition auf die Planktonforschung gelegt. Täglich zweimal wurde das Planktonnetz in Tiefen von 200 bis 400 m ausgeworfen; dabei mußten noch andere für die Planktonerscheinungen wichtige Beobachtungen angestellt werden; es wurde die Temperatur des Wassers gemessen, man entnahm Wasserproben, um den Salzgehalt des Seewassers zu bestimmen, man suchte die Richtung der Meeresströmung und die des Windes festzustellen; denn das Plankton ist ja ein Spiel von Wind und Wellen!
Da gab es genug zu thun, um diesen wichtigsten Punkt der gestellten Aufgabe zu erfüllen, und so mußten die Forscher, wenn auch mit schwerem Herzen, auf die Untersuchung anderer Fragen verzichten. So kamen die Lothungen und die Tiefseeforschung sehr kurz weg; denn es fehlte an Zeit und auf dem kleinen Schiffe auch an helfenden Händen, um größere Maschinen und größere Netze zu handhaben. Das Schiff war ja nur für dreieinhalb bis vier Monate gemiethet; weiter reichten die Mittel nicht, und so war die Planktonfahrt des „National“ ein hastiger Rekognoscirungszug. Aber die in so kurzer Zeit gewonnenen Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Die letzte deutsche Expedition zur Erforschung der Meere ist keine sklavische Nachahmung der amerikanischen, englischen und französischen Expeditionen gewesen. Auf ihr sind ganz neue Bahnen eingeschlagen worden, welche über die meisten Fragen, die das Leben im Meere betreffen, ein neues Licht verbreiten. Das unermeßliche Leben, welches sichtbar und unsichtbar alle Meeressräume durchdringt, erscheint uns als ein organisches Ganzes, Tausende, Millionen Fäden verknüpfen, wie uns die Platonforschung zeigt, die stumme Tiefsee mit der rauschenden Hochsee. Die engen Grenzen, welche noch vor Jahren der Verbreitung der Pflanzen in Meerestiefen gezogen wurden, scheinen erweitert; ebenso ist der durchleuchtete Raum der Meeresabgründe als bedeutend größer erkannt worden.
Sollen wir uns mit diesen ersten Erfolgen befriedigt erklären und auf weitere Arbeit verzichtete? Das würde einer großen Nation nicht würdig sein. England rüstete auf die Versuchsfahrten des „Lightning“ und „Porcupine“ die große „Challenger“- Expedition aus, Frankreich ließ auf die Fahrten des „Travailleux“ das Kriegsschiff „Talisman“ auf wissenschaftliche Eroberungen auslaufen.
Es ist eine Ehrenpflicht der deutschen Nation, die von deutschen Forschern in neue Bahnen gelenkte Meeresforschung kräftig zu fördern; wie vor Jahren die „Gazelle“, so sollte auch in nächster Zeit ein deutsches Kriegsschiff für eine entsprechend lange Zeit in den Dienst der Wissenschaft gestellt werden. Dank der wohlwollenden Gesinnung unseres Kaisers ist die erste „Plankton-Expedition“ möglich geworden; hoffen wir, daß die Reichsbehörden für den weiteren Ausbau dieser Forschung sorgen werden, die in der Geschichte der Wissenschaft für alle Zeiten eine ruhmreiche Stelle einnehmen wird.
„Das ist nun also Dein Heim, Lehnert, das Dir eine Friedensstätte werden möge!“ sagte Toby. „So soll ich Dir im Auftrage des Vaters sagen. Er hat dies Zimmer für Dich ausgesucht, weil er meint, die Berge drüben würden Dich freuen.“
„Das werden sie; danke Deinem Vater dafür! Und nun sage mir, wie hab’ ich mich drüben zu meinem Nachbar zu stellen? Er ist ein Franzose?“
Ja. Von Geburt. Aber es ist sein nicht geringer Stolz und wie Du bald erfahren wirst, auch sein Lieblingsthema, die nationalen Vorurtheile hinter sich zu haben. Er war ein Mitglied der Kommune, ja mehr, ein Führer derselben, und hat den Erzbischof von Paris erschießen lassen und sollte dann später selbst erschossen werden. Nur durch ein Wunder kam er mit dem Leben davon. All das sind Dinge, wovon ich Dir, wenn er’s nicht selber thut, ein andermal erzählen werde. Heute nur das noch, daß er Deinen Frieden nicht stören wird, höchstens Deine nächtliche Ruhe. Denn er ist ein unruhiger Geist, den mitunter die Lust anwandelt, ein paar Stunden in der Nacht zu plaudern. Vielleicht ist es auch sein Gewissen, was ihn wach halt. Und dann wankt er durch das Haus und weckt jeden und einmal war er selbst bei
[145][146] dem Vater. Und dann spricht er wie irr und deklamiert lange Gedichte vom Menschengeist, der seine letzten Fesseln abwerfen müsse.“
„So nehmt Ihr ihn also einfach als einen Irren?“
„O nein, durchaus nicht; er ist nicht irr, im Gegentheil, er ist grundgescheit und kann alles und weiß alles. Er ist nur ein Fanatiker und thut das Aeußerste, sonst aber ist er wie ein Kind. Er ist der Friedliebendste von uns allen und er ist rührend, wenn er Ruth sieht. Dann verklärt sich sein Gesicht und ich glaube, wenn sie’s befühle, so ging er nach Neu-Caledonien und Numea zurück. Von da floh er nämlich und kam bis hierher. Aber was sprech’ ich nur von Monsieur L’Hermite! Du wirst ihn kennen lernen, und unter allen Umständen ist er kein Gesprächsstoff für Deinen Einzug an dieser Stelle. Denn es ist Blut an seinen Händen, ungesühntes Blut.“
Lehnert brannte der Boden unter den Füßen, als Toby so sprach, und es war ihm, als ob er fliehen müsse. Toby aber, völlig ahnungslos, welche Wirkung seine harmlos hingesprochenen Worte hervorgerufen hatten, trat in diesem Augenblick an ein mit allerhand Matten und Kissen belegtes, zugleich als Sofa dienendes Bambusgestell und sagte, während er auf zwei darüber aufgehängte Bildchen in schwarzem Rahmen hinwies: „Das ist der Remter in Marienburg . . . Und das hier ist Kloster Oliva. Kennst Du sie? Sie sind das einzige Preußische, was wir noch von alter Zeit her im Hause haben.“
Es war nicht ohne Verlegenheit, daß Lehnert Namen und Dinge nennen hörte, die jenseit seiner Kenntniß lagen, es blieb ihm aber erspart, diese Nichtkenntniß gestehen zu müssen, denn Toby brach ab, ohne auf Antwort zu warten, und verließ das Zimmer. Als er schon draußen war, wandt’ er sich noch einmal zurück und sagte:, „Ich hoffe, daß nichts fehlt. Wenn aber etwas fehlen sollte, hier ist der Knopf, auf den Du drücken mußt; es ist eine Drahtleitung, die wir Monsieur L’Hermite verdanken. Monsieur L’Hermite ist nämlich ein Erfindergenie; nun, Du wirst ihn ja kennen lernen. Und nun Gott befohlen!“
Jetzt war Lehnert allein, ein Augenblick, nach dem er sich gesehnt hatte. Benommen von der Fülle von Eindrücken, die diese wenigen Stunden ihm gebracht hatten, ging er auf das mit Matten und Kissen überdeckte Lager zu, streckte sich nieder und schloß die Augen. Er wollte nicht sehen, um die Bilder seiner Seele desto deutlicher vor Augen zu haben. Da war der Alte, lächelnd, vornehm überlegen. Dann trat Monsieur L’Hermite vor ihn hin, das Käppi zurückgeschoben und das Gesicht über den Schraubstock gebeugt. Und dann wieder sah er Ruths halb noch kindliche Gestalt und ein Gefühl unendlicher Sehnsucht ergriff ihn. Wonach? Nach einer ihm verloren gegangenen Welt?
Er stand auf und hielt in dem Zimmer Umschau. Schlicht und sauber war alles. Alle Stühle von Bambus, sogar der Schaukelstuhl am Fenster, und am Pfeiler daneben zwei Stiche: Washington und General Grant. Sonst nur noch ein Bett und ein Tisch und eine Bibel darauf. Und er nahm die Bibel, und der Gedanke kam ihm, er wollte sein Schicksal darin lesen und ob er den Frieden finden würde. Und nun schlug er auf: es war ein Psalm, und er las: „Zähle meine Flucht, fasse meine Thränen, ohne Zweifel, Du zählst sie. Was können mir die Menschen thun? Ich hoffe, auf Dich, Du hast meine Seele vom Tode gerettet.“ Er war tief ergriffen und Thränen entstürzten seinem Auge. Dann schritt er auf das Fenster zu, öffnete beide Flügel und sah hinaus. Greifbar nah’, so wenigstens erschien es ihm, zog sich das bis auf den Kamm hinauf mit Tannen und allen Arten von Nadelholz bestandene Gebirge, dazwischen aber schlängelte sich ein Weg hernieder und wo der Weg ins Thal mündete, stand ein weißes Haus, zerfallen und ohne Dach, vordem ein Fort, das Fort O’Brien. Darüber lag der blaue Himmel und ein heller Wolkenstreifen zog den Kamm entlang, den an dieser Stelle nur ein einziges mächtiges Felsenstück überragte.
„Das ist der Mittagsstein.“
Und dann sah er wieder hinaus und suchte hinauf, ob er nicht noch andere Punkte zur Vergleichung und Erinnerung fände. Zuletzt aber ruhte sein Blick immer wieder bei dem weißen Haus unten am Abhang aus und eine Stimme rief ihm zu, daß sich seine Geschicke dort erfüllen würden.
Aber die Stimme sagte nicht, ob zu Glück oder Unglück.
Anderthalb Wochen waren um und Lehnert hatte sich eingelebt. Er sah kein Regieren und einfach ein Geist der Ordnung und Liebe sorgte dafür, daß alles nach Art eines Uhrwerks ging. Der Tag begann mit einer Andacht, die der Alte klug genug war, wenigstens als Regel knapp und kurz einzurichten, weil er sich sagte, daß Ermüdung der Tod aller Erbauung sei. Gewöhnlich las er einen Psalm oder etwas aus der Patriarchengeschichte, wenn er nicht vorzog, an mehr oder weniger wichtige Tagesereignisse mit Spruch und Betrachtung anzuknüpfen. War dann unmittelbar nach der Andacht das Frühstück eingenommen, so gab er persönlich die Weisungen für den Tag, was er, gestützt auf eine genaue Kenntniß seines Grund und Bodens und andererseits auch mit Hilfe der ihm am Abend vorher durch Toby oder Kaulbars oder Lehnert erstatteten Berichte, sehr wohl konnte. Begegnungen um die Mittagsstunde fielen aus, weil ein guter Imbiß entweder gleich mitgenommen oder auf die Felder hinaus geschickt wurde, was denn zur Folge hatte, daß man sich erst um sieben Uhr abends zum zweiten Male zu gemeinschaftlicher Mahlzeit versammelte, woran sich dann der Abendsegen und eine kurze Plauderei schloß. Bald danach zog man sich zurück, denn der Tag begann früh wieder.
Es war kein herzlicher, aber doch ein unausgesetzt friedlicher Verkehr, in dem man lebte, was Lehnert um so mehr Wunder nahm, als die bunte Menschenmasse, daraus sich das Hauswesen von Nogat-Ehre zusammensetzte, nicht einmal durch das Band gemeinsamer kirchlicher Anschauungen zusammengehalten wurde. Die Kaulbarse, Vollblutmärker, hielten zu Luther, Maruschka, die Polin, war katholisch und fuhr alle Jahre zweimal zur Beichte nach Denver, und L’Hermite war schlechtweg Atheist, so daß von der ganzen Obadjaschen Hausgenossenschaft, selbstverständlich mit Ausnahme der eigentlichen Familie, nur die dienenden Cherokee- und Arapahoindianer, Männer und Frauen, zur „Gemeinde“ gehörten, in die sie, nach zuvor empfangenem Unterrichte, meist mit zwanzig bis vierundzwanzig Jahren einzutreten pflegten. Wenn Lehnert das alles überdachte, sah er sich dadurch mehr als einmal an einen nach Art eines großen Vogelbauers eingerichteten Schaukasten in San Francisko erinnert, drin nicht nur ein Hund, ein Hase, eine Maus und eine Katze sammt Kanarienvogel und Uhu, sondern auch ein Storch und eine Schlange friedlich zusammengewohnt hatten. „Eine glückliche Familie“ stand als Aufschrift darüber, und wenn Lehnert so beim Frühstück und Abendessen den langen Tisch musterte, kam ihm der Schaukasten immer wieder in den Sinn und er sprach dann wohl leise vor sich hin: „Eine glückliche Familie!“ Sann er dann aber weiter nach, wodurch dies Wunder bewirkt werde, so fand er keine andere Erklärung als den „Hausgeist“, als Obadja, der das Friedensevangelium nicht bloß predigte, sondern in seiner Erscheinung und seinem Thun auch verkörperte.
Die Folge davon war ein Gefühl immer wachsender Verehrung und Dankbarkeit auf seiten Lehnerts. Wer so wahr und aufrichtig dies Gefühl war, so kam er demohnerachtet zu keiner rechten Freudigkeit. Er fühlte sich vereinsamt und brachte sich’s gelegentlich zu geradezu schmerzlichem Bewußtsein, daß er in seinen schwersten und schlimmsten Tagen, ja vor Jahr und Tag noch bei den zweifelhaften Leuten am Sakramente, heiterer und fast auch glücklicher gewesen sei, als hier unter den Bekehrten und Nichtbekehrten von Nogat-Ehre. Friede und Freundlichkeit waren da, aber was er mehr und mehr vermißte, war Verkehr und Vertraulichkeit. Obadja, mit all seinen Vorzügen, war doch unnahbar, die Geschwister zu jung, Maruschka zu kindisch und Monsieur L’Hermite zu zurückhaltend und zu ablehnend.
Bei diesem Befunde verblieben ihm nur seine Landsleute, die beiden Kaulbarse, und das war hart, weil ihre Nüchternheit keine Grenzen kannte. Dennoch, so nüchtern sie waren und in so lächerlich wichtiger Weise sie sich mit ihrer Lieblingswendung „mein Mann sagt auch“ oder „meine Frau sagt auch“ auf einander zu berufen pflegten, Berufungen, von denen aus ein weiterer Appell nicht wohl mehr möglich war – dennoch sah Lehnert ein, daß er, in Ermanglung von etwas Besserem, durchaus bemüht sein müsse, mit ihnen auf einem möglichst guten Fuße zu leben und das um so mehr, als ihn beide die Thatsache nicht entgelten ließen, daß ihre Machtstellung, das Mindeste zu sagen, durch sein Eintreten [147] in die Wirthschaft halbiert worden war. Und so verging denn kein Tag, an dem er nicht an der Seite von Kaulbars den Versuch einer ’mal flüchtigeren, ’mal eingehenderen Unterhaltung über Nahes und Fernes, über Wirthschaftliches und Persönliches gemacht hätte.
Kaulbars’ Lieblingsthema war es, mit seiner ganzen zur Schau getragenen Ueberlegenheit den Amerikanern ihre Sünden und Mangelhaftigkeiten vorzuhalten.
Eines Tages war es ein Gespräch über Ruth und Toby, von dem aus die Brücke zu diesem Lieblingsthema mit gewohnter Geschicklichkeit geschlagen wurde.
„Die beiden Kinder sind doch der Sonnenschein von Nogat-Ehre,“ sagte Lehnert. „Ueber Ruth ist gar nicht zu streiten; ich kann sie nicht sehen, ohne an die Lilien auf dem Felde zu denken. Aber auch Toby, wie brav und wie gescheit ist er, und wie gewandt! Wenn Obadja heute stirbt, was Gott verhüten wolle, so nimmt er die Wirthschaft in die Hand.“
„Ja, das thut er, die Einbildung dazu hat er, die haben sie hier alle. Kaum ist einer trocken hinter den Ohren, oder auch noch nich ’mal, so wird er ein Reverend oder ein Magistrate, oder sie schicken ihn als Gesandten nach der Türkei . . . Na, für die Türken mag es gehen. Un’ is nu gar ein bißchen Krieg in der Luft und soll es gegen Texas losgehen oder Utah oder gegen Mexiko, na, denn hast Du nich gesehen, denn backen sie die Generale und Obersten wie die Semmeln. Und wer heute noch ein Advokat is oder ein Chemist oder ein Lieferant, der is morgen ein Oberst, und nu geht’s ans Schlachtenschlagen. Und denn fahren sie los und singen Jankee-Doodle und thun, als ob sie wenigstens die Welt erobern wollten, und so lange sie die Schienen unter den Beinen haben, so lange geht es. Aber wenn nu das Marschieren anfängt und das erste Camp kommt oder das erste Bivouac, ja, du himmlischer Vater, da haben wir denn die Bescherung: Da is nichts da, da fehlt die Verpflegung und das Gehungre geht los und wenn sie vierzehn Tage lang im Modder gelegen und noch keinen Feind gesehen haben, dann fallen ihnen die Stiebel vom Leibe und keine Naht hält mehr, und wenn sie dann den Feind zu sehen kriegen, dann platzen die Flinten oder gehen gar nicht los, weil das Pulver nichts taugt oder die Patrone nicht paßt. Und warum is es so? Weil es alles bloß Spielerei is und kein Ernst nich, und Ernst is bloß, daß der Lieferant sein Geld kriegt für die Tornister, die immer drücken, und für seine Mäntel von Löschpapier. Ich habe welche gesehen . . . “
Lehnert wollte widersprechen, aber Kaulbars litt es nicht und fuhr in gleich überlegenem Tone fort: „Ich habe welche gesehen, sag’ ich, die wie Zunder vom Leibe fielen. Und warum? Weil alles Geschäft is, und wo alles Geschäft is, is alles Schwindel. Und wenn ich nu frage: ,Warum is es alles Schwindel?’ so kann ich bloß sagen, ’weil sie nichts kennen als Geld und nichts wollen als Geld und nichts anbeten als Geld und weil sie keinen richtigen Gott haben. Und woran liegt es? Weil sie verloddert sind. Und warum sind sie verloddert? Weil sie nicht dienen. Und der Toby hat auch nicht gedient und von Strammheit und richtiger Propreté ist keine Rede nich. Blaue Krawatte trägt er und hat ’ne schlappe Haltung, aber ein blauer Shlips is nicht Proprete, und eine lange Stakete, die hin und her schwankt und immer schlenkert, weil kein Rückgrat drin is, is nich Strammheit.“
Hier hatte sich Kaulbars vorläufig erschöpft und Lehnert fand Gelegenheit, einzuwerfen: „Ich bin überrascht, Mister Kaulbars, Sie so streng zu sehen. Als hier der große Krieg war, Anno 63, da waren wir beide noch drüben und haben beide nichts gehört und nichts gesehen, und was wir nachher, als wir ’rüber kamen, gehört haben, nu hören Sie, Mister Kaulbars, da muß man doch Respekt haben vor dem, wie’s damals hergegangen ist; sie haben sich geschlagen wie die besten Truppen und sind auch richtig verpflegt worden und war keine Rede von vor Hunger sterben. Und so mein’ ich denn, es kann nicht alles bloß Schwindel sein.“
„Es is Schwindel, sag’ ich, und wer gedient hat . . . “
„Ich habe auch gedient, Mister Kaulbars.“
Kaulbars lächelte. „Wobei denn?“
„Bei den Görlitzer Jägern.“
„Na, hören Sie, mit die Jäger, das is immer bloß so so. Das is nich Fisch und nich Vogel und geht eigentlich immer bloß auf Jagd und wilddiebt ein bißchen und is kein richtiger Soldat nich. Ich habe bei die Vierundzwanziger gestanden, Hauptmann von Goerschen, fünfte Compagnie. Haben Sie von dem ’mal gehört? Ich meine von Goerschen. Das heißt, es gab eigentlich zwei Goerschens, einer hieß Franz, der war auch ganz gut, aber unserer hieß Otto und wir nannten ihn ‚unseren Otto’ und war schon mit bei Düppel, Schanze drei. Ich sag’ Ihnen, die Schanze war weg wie Schnupftabak. Ja, so sind die Vierundzwanziger, Ruppin und Havelberg, und Rathenow und die ‚Zietenschen‘, das gehört eigentlich auch noch mit dazu. Hören Sie, die Görlitzer mögen ja so weit ganz gut sein, man soll nicht streiten und soll nich nein sagen, wenn man’s nich weiß. Aber das sag’ ich Ihnen, Mister Lehnert, aufs Dienen kommt es an und jeder muß ’mal Rekrut gewesen sein und muß die Honneurs gelernt haben und muß die Signale gelernt haben. Und das is gewiß, wenn der Hornist blies und war das Signal von der fünften Compagnie, da gab es ein Ohrenspitzen wie ’n Kavalleriepferd und mitten im Schlaf. Und wenn dann der alte Oberst von Unruh mit seiner Krähstimme kommandierte: .Präsentiert das Gewehr’, und dann der Prinz, unser Prinz, die Front abschritt und die Spielleute spielten und wir mit .Augen rechts’ dastanden wie die Puppen, und ich sag’ Ihnen, Lehnert, was für Puppen! – ja, das hätten Sie sehen sollen, das hatte so seine Art, das war ein Vergnügen, und wenn der Prinz dann sagte: ,Ja, das sind meine Vierundzwanziger; Kinder, wenn ich Soldaten sehen will, dann seh’ ich mir die Vierundzwanziger an. Es lebe der Kaiser!’ ja, Mister Lehnert, das war was, das kommt vons Dienen und vons Gehorchenkönnen und von der Strammheit und der Propreté, und wenn Sie die ganzen achtunddreißig ‚States‘ umstülpen und hier unser Indianterritory mit dazu und alle Mennoniten und den alten Obadja auch, so was fällt nich ’raus un’ kann auch nich ’rausfallen, weil’s nich drin is und weil alles Schwindel is . . . Und Miß Ruth, nu ja, Miß Ruth ist ein hübsches Ding, geb’ ich zu, meinetwegen, und Mister Toby guckt in die Welt wie die Maus aus der Heede. Hübsch sind sie und gewaschen und haben so was wie Prinz und Prinzessin. Aber, bei Lichte besehen, das ist eben der Unsinn. Wer kein Prinz is, darf auch nicht wie ’n Prinz aussehen. Prinz Friedrich Karl, der durfte, der war einer. Aber Toby? Toby weiß alles am besten und is doch bloß noch ein Quack. Aber das is hier alles eins, und mit zwanzig ist er bei der Gesandtschaft in Japan und mit vierundzwanzig ist er Oberpriester in Nogat-Ehre. Denn der Alte wird klapprig und ewig kann er doch nicht leben und wenn er auch so fromm wäre wie Abraham oder wie Hiob.“
So verliefen die Gespräche, welche die beiden preußischen „Kameraden“, wenn sie morgens auf die Felder hinausritten, miteinander führten, Gespräche, die Lehnert nur zu deutlich zeigten, daß mit dem guten Kaulbars (und mit der Frau lag es nicht viel besser) Wohl ein friedlicher, aber kein freundschaftlicher Verkehr möglich sei.
Und so würde denn das Gefühl von Vereinsamung, das ihn sehr bald nach seinem Erscheinen in Nogat-Ehre zu quälen begann, sehr wahrscheinlich in einem beständigen Wachsen geblieben sein, wenn ihm nicht der anfangs mit so viel Mißtrauen und Abneigung angesehene Monsieur Camille L’Hermite mit jedem Tage theurer geworden wäre. Monsieur L’Hermite hatte nichts von der selbstgefälligen Enge, darin sich beide Kaulbarse gefielen, und so kam es, daß sich für Lehnert mit dem „lieben Landesfeinde“ – „mon cher ennemi“, wie Monsieur L’Hermite sagte – nach und nach ein Verhältniß anbahnte, das ihm der deutsche Landsmann nicht gewähren konnte.
Den ersten Anstoß zu dieser Wendung gab ein ganz kleiner Vorfall, der sich schon während der ersten Wochen ereignete. Wenn von Tisch aufgestanden und nach kurzem und meist die Wirthschaft betreffendem Gespräche der Rückzug in die Zimmer des oberen Stocks angetreten wurde, schloß sich Lehnert diesem Rückzug nicht immer an, sondern zog es mitunter vor, in einer jenseit der Akazienallee gelegenen Garten- und Parkanlage, darin sich auch die von Obadja aus großen Feldsteinen aufgeführte Familiengruft befand, noch eine halbe Stunde lang auf und ab zu gehen, wobei Ruths Neufundländer ihn meistens begleitete. Stieg er dann, wenn’s dunkel geworden war, auch seinerseits die Treppe hinauf, [148] so klang regelmäßig vom linken Korridor ein Choral herüber oder ein geistliches Lied: Ruth sang und Toby begleitete. Was aber Lehnerts Gemüth mehr noch als dieser Gesang in Anspruch nahm, war, daß er mal auf mal, wenn er an Monsieur L’Hermites Zimmer vorüber kam, in aller Deutlichkeit hören konnte, wie dieser die Thür leis ins Schloß drückte, ganz so, wie wenn er’s verbergen wollte, dem Gesange Ruths gelauscht zu haben. Einmal aber traf es sich, daß L’Hermite, trotz aller Vorsicht, auf seinem Lauscherposten von Lehnert doch überrascht und dadurch in eine kleine augenblickliche Verlegenheit versetzt wurde. Seine französisch gute Laune half ihm aber rasch darüber hin und sein Käppi zurückschiebend, wie seine Gewohnheit bei jeder Ansprache war, trat er an Lehnert heran und sagte, während er nach dem linken Korridor hinüber deutete: „Nicht übel! Nicht wahr?“ Und als Lehnert nickte, nahm er dessen Arm und sagte: „Bitte, treten Sie ein, mein lieber Feind!“
Lehnert folgte denn auch der freundlichen Aufforderung und nahm in einem Schaukelstuhle Platz, während sich L’Hermite mit übereinandergeschlagenen Beinen auf den durch eine grüne Schirmlampe nur mäßig erleuchteten Arbeitstisch setzte. Die mäßige Beleuchtung war denn auch Ursache, daß viele Stellen des Zimmers, der eigentlichen Ecken und Winkel ganz zu geschweigen, in einem Halbdunkel verblieben; aber sie gab immer noch Licht genug, um den Umschau haltenden Lehnert erkennen zu lassen, daß der ganze Raum ein merkwürdiges und sehr unordentliches Durcheinander von Schlosserwerkstatt und chemischem Laboratorium, von physikalischem Kabinett und Mineraliensammlung war. Das Chemische herrschte vor, im übrigen aber lief der Gesammteindruck darauf hinaus, daß es nichts auf der Welt gäbe, was hier nicht entdeckt und erfunden werden könnte. Welchem Zweck das alles diente, gab zu denken, und Lehnert, der immerhin einiges von L’Hermites Vergangenheit in Erfahrung gebracht hatte, würde beim Anblick all dieser Kolben und Retorten sicherlich auf einige für Europa bestimmte Nihilistenbomben gerathen haben, wenn nicht Nogat-Ehre so ganz den Stempel des Friedens getragen und Obadja selbst bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit einer besonderen Vorliebe von Monsieur L’Hermite gesprochen hätte.
Lehnerts Verweilen an diesem ersten Besuchsabend war nur von kurzer Dauer gewesen, aber es hatte doch ausgereicht, beide einander zu nähern und in weiterer Folge sogar regelmäßige Zusammenkünfte herbeizuführen. An jedem dritten Tage, wobei zwischen hüben und drüben gewechselt wurde, traf man sich zu ziemlich später Stunde und plauderte dann bis Mitternacht. Das war die Regel, die, wenn Lehnert Wirth war, streng galt. An den L’Hermite-Abenden aber – an denen, außer einigen anderen Verpflegungsfinessen, auch ein in Galveston erstandener und mit Cognac und Absynthflaschen reichlich ausgestatteter Rosenholzkasten eine Rolle spielte – ging ihr Geplauder gelegentlich bis über die zwölfte Stunde hinaus. Obadja wußte von diesem Rosenholzkasten und daß ihm, vor allem von L’Hermite selbst, fleißig zugesprochen würde, was er, wie sich denken läßt, mißbilligte; trotzdem ließ er es geschehen, einmal weil ihm alles Erziehen, wenn es sich nicht von selbst machte, zuwider war und fast mehr noch, weil er sich nicht das Recht zuschrieb, die Lebensgewohnheiten eines Mannes zu regeln, der, wenn auch ein Flüchtling, so doch immerhin ein unbeanstandeter Gast und auch eine Person von praktischer Bedeutung für Nogat-Ehre war. Und so störte denn niemand diese Zusammenkünfte, die bald beider Freunde besondere Lust und Freude wurden.
Nur eines, was übrigens die Freude nicht minderte, fiel Lehnert bei diesen abendlichen Zusammenkünften auf, und das war die Zurückhaltung, mit der L’Hermite seine „große Zeit“, seine historische Vergangenheit behandelte. Nicht als ob er Lust bezeigt hätte, sich von ihr loszusagen, durchaus nicht, er vermied nur einfach, ohne Veranlassung davon zu sprechen, und beschränkte sich, wenn diese Veranlassung eintrat, auf das unbedingt Nöthigste. Der furchtbare Ernst der Scene, darin er mitgespielt hatte, war ihm gegenwärtig und ein feines ästhetisches Gefühl, das ihn überhaupt auszeichnete, hielt ihn ab, von einem Hergange zu sprechen, dessen Erwähnung, wenn es die Verhältnisse nicht geradezu geboten, entweder renommistisch oder cynisch berühren mußte. Als Lehnert erst klar darin sah, stimmte er seinem Flurgenossen zu, vorher aber war er doch wochenlang von dem Verlangen erfüllt, über den interessanten Hergang Ausführlicheres zu hören, und schwankte nur, nach welchem Plane er Verfahren solle, um seine Neugier zu befriedigen. Schließlich entschied er sich dafür, auf einem Umwege vorzugehen und das Gespräch zunächst auf die langen Einschließungstage von Paris zu lenken. Es seien langweilige Tage gewesen, auch für sie draußen, und das Zerstreuliche hab’ erst eigentlich begonnen, als die Franzosen untereinander ins Scharmützeln gerathen seien, die Versailler gegen die Pariser. Da haben er und seine Kameraden oft viele Stunden lang auf dem Höhenzuge zwischen St. Germain und St. Denis gestanden und dem Kriege wie einem richtigen Kriegsschauspiel zugesehen. Und einmal hab’ er ganz deutlich beobachten können, wie die Parisischen durch eine geschickte Bewegung über die Brücke von Asnisres alles, was von Regierungstruppen in der großen Seine-Schleife gestanden, abgeschnitten hätten. Aber das sei freilich auch der letzte Sieg gewesen und schon am nächsten Tage sei der Triumphbogen von dem von St. Cloud vorgehenden Bataillone erstürmt worden. Und wenn er sich vergegenwärtige, was er bei der Gelegenheit alles gesehen habe, so begreif’ er nur zu gut, was seitens der Kommunarden geschehen sei, und könne von Grausamkeit keine Rede sein.
Monsieur L’Hermite hatte, während Lehnert so sprach, still vor sich hingeblickt und eine Cigarette gedreht und erst nach einer Weile das Wort genommen. Es sei so, wie Lehnert sage. „Die Sache da draußen am Trocadero war kein Spaß und darauf hin wurden die Geiseln erschossen . . . Und der letzte war der Erzbischof . . . Ich übernahm selber das Kommando . . . Er ist gestorben wie ein Held!“
Lehnert sog jedes Wort ein, als L’Hermite so sprach, und glaubte, jetzt sei der Augenblick für vertrauliche Mittheilungen gekommen. Aber er sah sich abermals getäuscht, und sein Wissen blieb im wesentlichen auf dem Punkt, auf dem es schon vorher gestanden hatte.
Nicht viel besser erging es ihm, als er auf einem ähnlichen Umwege den Versuch machte, näheres über seines Flurgenossen Flucht aus Numea, wohin dieser deportiert worden war, herauszuholen. L’Hermite wiegte den Kopf hin und her und sagte dann, während er, um damit zu spielen, eine große Feile vom Arbeitstische nahm: „Es machte sich schnell. Wir waren unser drei, die’s wagten, weil wir gut schwimmen konnten, und schwammen denn auch wirklich, trotz Brandung, auf ein Schiff zu, von dem wir wußten, daß der Kapitän mit unserer Sache sei. Meinen beiden Kameraden aber ging die Kraft aus; ich für mein Theil konnte noch gerad’ ein Tau fassen, das mir von Deck aus zugeworfen wurde. Das ergriff ich denn auch und eine Minute später zogen sie mich an Bord. In derselben Stunde noch ging’s nach Portland. Und da war ich frei. Das andere wißt Ihr; Ihr kommt ja auch von San Francisko her. Ist eins wie das andere.“
So knapp waren Monsieur L’Hermites Erzählungen, wenn es seine historische Zeit galt, aber desto mittheilsamer war er, wenn er auf seine mit Technik und Mechanik und vor allem mit dem Bergwerkswesen in Zusammenhang stehenden Pläne zu sprechen kam. War er doch vor allem ein Entdecker und Erfinder, und wenn er auch unzweifelhaft an seiner kommunistischen „Idee“ mit einem stillen Fanatismus festhielt, so gab es doch eins, was in seinen Augen der „Idee“ gleich kam, das war das „Projekt“. Ja, er war vielleicht über alles andere hinaus seiner ganzen Natur nach nichts als ein Projektenmacher, und was er die „Durchführung seiner Idee“ nannte, war eigentlich auch nur Projekt und hätt’ ihn, wenn es anders gewesen wäre, schwerlich in seinem Gemüthe derart ergriffen, wie’s jetzt thatsächlich der Fall war. Er hielt Lesseps für den größten Mann des Jahrhunderts, und Isthmusdurchstechung oder eine Tunneleisenbahn unter dem Kanal zwischen England und Frankreich hin, Ausschöpfung der Zuydersee und Füllung der Saharawüste mit Oceanwasser waren Dinge, die seiner Seele mindestens so hoch standen, vielleicht noch höher als der Sieg der Kommune.
Es war in einer Nacht nach einem solchen Gespräch mit L’Hermite. Lehnert schlief noch nicht lang, als ein Klopfen ihn weckte. Wer es sein könne, war ihm kaum zweifelhaft, und erging auf die Thür zu und öffnete. Wirklich, es war L’Hermite, nur in Pantoffeln und weitem Beinkleid und sein Käppi wie gewöhnlich im Nacken. In der Linken hielt“ er einen Leuchter, drin ein Lichtstümpfchen, mit einem Dieb am Docht, steckte, das ein rußigqualmendes, flackerndes Flämmchen gab. Das Groteske ging unter in dem Schmerzlichen der Erscheinung. Er mühte sich,
[149][150] überlegen drein zu schauen, und schien über sich und die Welt lachen zu wollen, aber ein mächtigeres Gefühl hielt seinen Spott im Bann, und er sah aus wie der Tod auf der Maskerade, der tanzen will. Endlich nahm er Platz, während Lehnert sich ihm gegenüber setzte.
„Ihr könnt nicht schlafen, Monsieur L’Hermite. Was giebt es?“
„Es sah wer in mein Fenster.“
Wer?“
„Ich sah ihn nicht. Aber er hielt ein Kreuz vor der Brust.“
„Das war das Fensterkreuz und der Mondschein dahinter.“
L’Hermite lächelte. Lehnert aber, der das Grauen, das ihn mit erfaßt hatte, dem Freunde wie sich selber wegreden wollte, suchte bei seinem zwangsweis angeschlagenen Heiterkeitstone zu beharren und sagte: „Sinnestäuschung, Monsieur L’Hermite! Wer Euch ins Fenster sehen will, muß von unten her eine Leiter anlegen.“
„Oder von oben!“
Er sprach das so, daß Lehnert verstummte. Und nun saßen sie sich einander gegenüber und zwischen ihnen schwebte das Licht, dessen Flackerschein von dem Spiegelchen zurückgeworfen wurde.
So verging eine Weile. Dann sagte Lehnert: „Es giebt eine Himmelsleiter und die Engel steigen hernieder, so steht geschrieben . . . Und vielleicht auch die des Gerichts. Glaubt Ihr solche Dinge?“
„Nein! Aber das Märchen hat nun mal Gewalt über uns, das Eiapopeia, das uns schon von der Wiege her gesungen wird. Da liegt es. Wir zittern vor dem Spuk und haben kein Mark in der Seele.“
Lehnert schwieg. Endlich sagte er: „Monsieur L’Hermite, drüben ist der Mond und der Mond ist nicht jedermanns Sache. Bleibt hier, legt Euch auf das Ruhebett!“
L’Hermite aber erhob sich wieder von seinem Platz, legte seine Hand auf Lehnerts Schulter und sagte: „Nein, wir wollen lieber in die Kapelle gehen; ich will da das Kreuz vom Altar nehmen und es Hochhalten und den Geist anrufen. Denn der Geist ist die Idee. Die Kapelle soll ’mal etwas anderes hören, als die Geschichte von Pharaos Traum und den ewigen sieben Kühen. Obadja persönlich ist eine fette Kuh, aber seine Predigt ist eine magere. Kommt! Ich will sein Tabernakel in einen Tempel der Idee verwandeln und will bloß vor zweien sprechen, vor Euch und dem Mond. Das ist nur genug.“ –
Es war nicht leicht, Monsieur L’Hermite von seinem Vorhaben ab- und in sein Zimmer zurückzubringen. Endlich gelang es, und nachdem Lehnert, des noch immer draußenstehenden Mondes halber, die Läden des einen Fensters geschlossen hatte, ging er in sein eigenes Zimmer zurück, um hier wieder sein Lager aufzusuchen. Er war nun selber Zeuge gewesen von der gelegentlichen Geistesgestörtheit L’Hermites, von der er schon gehört hatte. „Wenn es nicht sein Gewissen ist“, hatte Toby damals hinzugesetzt. Und Lehnert wiederholte jetzt Tobys damalige Worte.
Der andere Tag war ein Sonntag. Lehnert erschien zur Morgenandacht, beurlaubte sich aber gleich danach für den ganzen Tag, um ins Gebirge zu reiten, in die Ozark-Mountains, deren viele Meilen langen Zug er nun seit einer Reihe von Wochen in beinah’ nächster Nähe vor sich sah, ohne daß es ihm bisher möglich gewesen wäre, sie zu besuchen. Die Woche gehörte der Arbeit und der Sonntag der Betrachtung und Ruhe, worauf Obadja mit einer ihm sonst nicht eigenen Strenge hielt. Ausnahmen waren aber statthaft, und Lehnerts musterhafte Innehaltung aller Hausgesetze während seiner jetzt mehr als zweimonatigen Anwesenheit in Nogat-Ehre ließ es Obadja nicht schwer fallen, heute einen solchen Ausnahmefall eintreten zu lassen.
Es war der zweite September, und als Lehnert eben eine leis ansteigende Ebereschenallee hinauf ritt – er hatte sich für einen kleinen Umweg entschieden – entsann er sich mit einer gewissen Freudigkeit, daß es der Sedantag war. Er versenkte sich wieder in die Vorgänge von damals und sah wieder den Angriff der Chasseurs d’Afrique und wie die Säbel und rothen Käppis der attakierenden Schimmelschwadron in der Sonne blitzten.
Solche Bilder vor der Seele, ritt er weiter, allmählich aber bog die Ebereschenallee wieder nach links ein und ging in einen Birkenweg über, der sich alsbald in geringer Entfernung von dem in Trümmern liegenden Fort O’Brien ins Gebirge hineinzog. Als er in Höhe dieser Stelle war, stieg er ab und band sein Pferd an einen Baum, um, eh’ er weiter ritt, erst dem merkwürdigen Trümmerhaufen, auf den sich, von seinem Fenster aus, sein Auge manches liebe Mal gerichtet hatte, seinen Besuch zu machen. Fort O’Brien war vor kaum mehr als zwanzig Jahren in einem der vielen kleinen Kämpfe mit den Indianern von diesen erstürmt und zerstört worden, wobei Dach und Inneres gänzlich verbrannt, der Wallgang aber sammt seinen Palissaden und vor allem ein an einer Ecke stehender abgeflachter Steinthurm in leidlich gutem Zustände verblieben waren. Lehnert kroch, als er das Fort erreicht hatte, überall umher, erstieg den Thurm auf einer noch wohlerhaltenen Wendeltreppe und sah nun zurück nach Nogat-Ehre hin. Die Entfernung war ziemlich bedeutend, aber die wundervolle Klarheit der Luft ließ ihn alles aufs bestimmteste erkennen. Das Eckfenster zur Linken, das war das seine, und das an der anderen Ecke, da wohnte Ruth. Es war ihm, als sah’ er sie, und indem er ihrer gedachte, gedacht’ er auch schon des Augenblicks der Rückkehr und sah sich die Treppe hinaufsteigen und vernahm andächtig den Choral, den sie mit klarer Kinderstimme sang. Und nun bog er in den Korridor ein und hörte wieder deutlich, wie die Thür ins Schloß fiel, und wie sich Monsieur L’Hermite wie herkömmlich von seinem Lauscherposten zurückzog. Und während er das alles im Geiste vorwegnahm, trat er, sich wieder erinnernd, wo er war, an die Brüstung des alten Thurmes heran und pflückte, sich bückend, allerlei kleine Blumen, die hier aus dem zerbröckelten Gestein reichlich aufsproßten, und band einen Strauß, den er mitnehmen und Ruth überreichen wollte.
Das Pferd nagte noch ruhig an den Birkenzweigen, als er nach einer Weile zurückkam, um wieder in den Sattel zu steigen. Der Weg aber, der immer steiler anstieg, erschien ihm jetzt mehr und mehr wie die Krummhübler Straße zwischen dem „Goldenen Frieden“ und dem „Waldhaus“, und der Gebirgsbach, der da neben ihm schäumte, das war die Lomnitz, die vom Mittagsstein und den Teichen herunter kam. Und unwillkürlich sah er auch nach dem Inselchen aus und ob er das Haus sähe, sein Haus, mit den zwei Brückenstegen und dem Schindeldach und dem sich am Haus hin und dann bis aufs Dach hinaufrankenden gelben Rosenstrauch. Er sah aber nichts als Tannen und wieder Tannen und dann und wann eine Lichtung, und dabei wurde der Weg immer enger und steiler, bis zuletzt ein Quell kam, der aus einer niedrigen, aber senkrechten Felswand sprang und dicht darunter in einen aus vier mächtigen Steinen gebildeten Kessel fiel. Und an dem Kessel hin lief ein Pfad und dahinter kam ein Moorstreifen, und verdorrtes Gras und Huflattich . . . Und dann kam ein Kussetgebüsch . . . Und da lag wer . . .
Und Lehnert hielt an und fuhr mit der Hand über Stirn und Auge, wie wenn er das Bild verscheuchen wollte. Aber es wich nicht. Und zuletzt gab er dem Pferde die Sporen und ritt, so rasch es der Weg zuließ, immer Höher bergan.
Nur einmal noch sah er nach der Stelle zurück.
„Das ist der, der bei L’Hermite ins Fenster sah.“
Mitte September war herangekommen. Die Ernte war herein und es traten Tage der Ruhe ein für Lehnert. Nicht so für Obadja; denn ihm brachte der Herbst das große Fest der Fußwaschung, welches die Gemeinde der Mennoniten alljährlich um diese Zeit zu feiern Pflegte. Aus weitem Umkreise kamen die Lehrer und Prediger, und mit ihnen viele bekehrte Rothhäute, Männer und Frauen, die während des Festes in die Gemeinde der „Taufgesinnten“ ausgenommen werden sollten. In dem großen Betsaal zu Nogat-Ehre waren überall Laub- und Blumengewinde gezogen, am reichsten an der dem Eingang gegenüberliegenden Empore, auf welcher Ruth mit dem Chore der Mennonitentöchter ihren Platz hatte.
Die feierliche Taufhandlung war vorüber und Obadja war von dem Taufbecken wieder an den Altar getreten, um die eigentliche Predigt zu halten, die – wie gewöhnlich bei diesen Jahresfesten – die Hauptunterscheidungspunkte der mennonitischen Lehre betonen sollte. Der Text aber, den er seiner Predigt zu Grunde gelegt hatte, war der: „Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen“ und daneben der andere Spruch: „Die Rache ist mein, spricht der Herr“. Er sah, als er diese Worte sprach, zu Lehnert hinüber, der sein Auge vor dem ruhigen Blicke des Alten senkte. Dann aber wandte sich dieser der Auslegung seiner Textesworte zu und [151] }stellte die Bilder kriegerischen und friedlichen Lebens einander gegenüber. Alles Blut, das flösse, flösse zum Unheil, und nur einmal sei Blut zum Heil geflossen, freilich nicht zum Heile derer, die’s vergossen, wohl aber zum Heile der Menschheit, um deretwillen es floß. Alles andere Blutvergießen aber sei Sünde, zumeist wenn es flösse der Rache des einzelnen zu Liebe. Das führe zu sicherem Untergang und Verderben. Aber auch der große Krieg sei Sünde, auch das Blutvergießen um Land und Herrscher und selbst um des Glaubens und der Freiheit willen. Und so hab’ er denn auch in diesem gesegneten Lande den Krieg beklagt, den Nord und Süd um die Frage der Befreiung ihrer schwarzen Brüder geführt hätten, so sehr er dieser Befreiung selbst entgegengejubelt habe, Fortschritt und Freiheit sollten freilich ihren Einzug halten in die Welt, aber auf einer Palmenstraße, nicht auf einer Straße, da die Kriegsknechte zu beiden Seiten am Wege stehen. Absage dem Krieg, das sei die Lehre der Taufgesinnten. „Und so höret denn zum Schluß: Uebermuth macht Krieg, Demuth macht Frieden. Und der Frieden im Gemüth ist das Glück und die Vorbereitung zum ewigen Heil. Selig sind die Friedfertigen, selig sind, die reines Herzens sind. Die Rache ist mein, spricht der Herr.“
Obadja schwieg jetzt, und im Augenblick, als er die Stufen verließ, klangen von der Mittelempore her die Töne eines Chorals.
Es war Ruth, deren Stimme mit wunderbarer Klarheit durch den Saal drang, während die jungen sie umstehenden Mädchen die Palmenzweige, die sie in ihren Händen trugen, immer Höher über ihr emporhielten. Lehnert sah hinauf, zitternd vor innerster Bewegung, und wollte die Friedensstätte meiden, die seine Stätte nicht mehr war. Aber eh’ er sich erheben konnte, da war der letzte Vers zu Ende und Ruth trat, fast verdeckt von den über sie gehaltenen Zweigen, in den Hintergrund der Empore zurück.
L’Hermite, der trotz seiner abweichenden Ansichten dieser Feier mit großem Eifer folgte, wurde nicht müde, stille Zeichen des Beifalls zu geben und huldigend hinauf zu grüßen, aber ehe er noch einen Gegengruß eintauschen konnte, vernahm er unmittelbar neben sich einen schweren Fall und sah, sich wendend, daß Lehnert, wie vom Schlage getroffen, zusammengebrochen war.
Alles drängte herzu, Marnschka und Toby und zuletzt auch Obadja und Ruth.
„Er ist todt.“
„Nein, erlebt,“ sagte Ruth im festen Glauben ihres Herzens.
Und ihr Auge leuchtete, als sie so sprach.
Am andern Tage aber wurde Lehnert, nach voraufgegangener Beichte, selbst in die Gemeinde der Taufgesinnten ausgenommen.
Tobias und Ruth hatten von Anfang an eine Liebe zu Lehnert gehabt, die sich jetzt, nachdem er ein Mitglied der Gemeinde geworden war, unbefangener zeigen durfte, was dann selbstverständlich auch das Vertrauen auf Lehnerts Seite steigerte, so weit, daß es allmählich zur Vertraulichkeit wurde. L’Hermite, ganz unkleinlich und jedenfalls frei von jeder Eifersuchtsregung, hatte seine Freude daran, und so begann denn bei beiden ein Wetteifer nicht nur in ihrer Liebe zu den Geschwistern, sondern auch in der Erfüllung aller Wünsche, die Ruth und Toby hegten. Ja, die beiden sonderbaren Schwärmer, von denen der eine den Erzbischof von Paris und der andere den Förster Opitz auf dem Gewissen hatte, kannten nichts Schöneres, als für Miß Ruth zu denken und zu arbeiten, und fühlten sich belohnt, wenn sie lachte, nickte, dankte.
Der gemeinsamen Abende Lehnerts und L’Hermites wurden in natürlicher Folge davon immer weniger und an ihre Stelle traten Familienabende, zu deren Abhaltung man sich auf Ruths Zimmer versammelte. L’Hermite, so sehr er sich dieser Abende freute, kam freilich seinerseits nur selten und immer nur auf besondere Aufforderung, desto häufiger aber stieg der Alte die Treppe hinauf und mit herzlicher Genugthuung erzählten alsbald die Kinder, daß der Vater, seit der Mutter Tode, kaum jemals in ihrer Mitte so fröhlich und guter Dinge gewesen sei wie gerade jetzt.
Musikabende wechselten mit Leseabenden, und an einem der letzteren kam Pestalozzis „Lienhardt und Gertrud“ an die Reihe. Die Geschichte zog bald Alt und Jung ins Interesse, voran in lebhafter Theilnahme stand aber Lehnert, vielleicht weil er aus vielem, was da erzählt wurde, seine eigene Lebensgeschichte heraushörte. Lienhardt, das war er selbst, und der böse Vogt, der den armen Lienhardt quält und zum Schlechten verführt, das war Opitz. Er wollte immer mehr hören und war beinahe mißgestimmt, als man auf Obadjas Geheiß plötzlich abbrach und die Vorlesung bis auf den andern Abend vertagte. Wenigstens das nächste Kapitel, das sich „Niedriger Eigennutz“ betitelte, hätt’ er gern noch kennen gelernt, und so nahm er denn, als man sich bald danach zurückzog, das von Ruth auf einen Ecktisch gelegte Buch zur Befriedigung seiner Neugier mit in sein Zimmer hinüber und las bis Mitternacht. Dann schritt er noch eine Zeitlang auf und ab, um seiner Aufregung Herr zu werden, und öffnete dabei das Fenster und lehnte hinaus und sah nach dem in klaren Umrissen daliegenden Gebirge hinüber. Darüber flimmerten die Sterne. Ihm war es, als erblick’ er die Leiter, von der L’Hermite, in jener Mond- und Spuknacht gesprochen hatte, nur mit dem Unterschiede, daß er statt ihn ängstigender Schatten Engel und Lichtgestalten auf- und niedersteigen sah. Und nun schloß er das Fenster wieder und sah Ruth, wie sie drüben in halber Beleuchtung gesessen und in den Lesepausen des Vaters Hand gestreichelt hatte.
„Ja, wer so geboren wird, wen das Leben so wiegt und trägt . . . Armer Mensch, ich, arm und elend und verloren, wenn Gott nicht ein Wunder thut . . . Aber wie’s auch komme, doch gut, daß ich das alles noch erlebt . . . Und wenn er ein Wunder thäte! Hah’ ich es verwirkt? Ist ein Wunder unmöglich? Nie, sonst wär’ es kein Wunder.“
Und er lebte sich in diese Vorstellung ein und legte sich’s zurecht und sah wieder heiter in die Zukunft. Unklare, verschwimmende Bilder von Besitz und Glück und Ruhe stiegen vor ihm auf.
So verstrich die Zeit bis Weihnachten, und ehe man sich’s versah, war der heilige Abend da. Die Bescherung für die Hausgenossen Obadjas und für die Mennonitenkinder war vorüber, und unter den Klängen von Obadjas Lieblingslied
„Valet will ich Dir geben.
Du arge falsche Welt“
waren die Kinder mit den Lehrern hinausgezogen aus der großen Halle, sich in die benachbarten Farmen zu vertheilen, wo sie für die Nacht Unterkommen finden sollten. Die Hausangehörigen blieben noch beisammen, in traulichem Gespräche um den Kamin gruppirt.
„Hast Du das Lied gekannt, das die Kinder sangen?“ fragte Obadja, zu Lehnert gewendet.
Ja, sagte Lehnert, er hab’ es gekannt, denn es habe dem Liederschätze seiner heimathlichen Dorfkirche mit angehört.
„Dann weißt Du auch wohl, von wem es ist?“
„Nein.“
„Aber das solltest Du doch. Es ist ein Landsmann von Dir, der es gedichtet hat, er hieß Valerius Herberger. Ihr Schlesier seid überhaupt bevorzugt in solchen Stücken, und ich möchte wohl, ich könnte von meiner alten heimischen Weichsel- und Nogatgegend dasselbe sagen. Wir sind arm und Ihr seid reich. Da habt Ihr den herrlichen Mann, den Zinzendorf, denn die Sachsen und Lausitzer sind schon wie halbe Schlesier, und da habt Ihr den herrlichen Paul Flemming und vor allem auch den Opitz.“
Lehnert verfärbte sich.
Als er aber sah, daß der Name voll Unbefangenheit gesprochen worden war, kam er rasch wieder zu sich und folgte mit scharfem Ohr, während Obadja fortfuhr: „Und zu diesen Erwählten unter Euch, die nun dastehen als eine Säule der neuen Kirche, zählt auch der Valerius Herberger, und wie sein Glaube in seinen Liedern lebt, so lebt er auch in seinen Werken. Und ich beuge mich vor diesem Manne. Kein Märtyrer, im Sinne der alten Kirche, hat er doch dem Tode Tag um Tag ins Auge gesehen. Er war Prediger in Fraustadt in Schlesien und in neun Wochen starb die Stadt aus, denn der schwarze Tod ging in ihr um. Mehr als dreihundert hat er persönlich unter Schulgesang mit bestatten helfen und doch blieb er bis zu Ende ohne Furcht. Manche Leiche begrub er mit dem Todtengräber ganz allein. Er ging voran und sang; der Todtengräber aber führte ihm die Leiche auf einem Karren nach, an dem ein Glöckchen hing, damit die Leute der Begegnung ausweichen konnten. Sein Trost war: wer Gott im Herzen und ein gut Gebet und’ einen ordentlichen Beruf hat und den Vorwitz meidet, dem kann der Teufel nicht ankommen und die Seuche noch weniger.“
[152]
[153] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [154] „Ah, das ist schön,“ sagte Ruth. Obadja aber nickte Ruth zu und fuhr dann fort: „Und als die Seuche fort und aus dem Lande war, da schrieb er: ‚es war all die Zeit über, als ob ein Engel mit dem Schwert mein Haus vertheidigt hätte, so daß mir kein Leid widerfahren durfte.‘ Und während dieser Zeit war es auch, daß er das schöne Lied dichtete, das, wie’s ihn aufrichtete, seitdem so viel tausend andere mit aufgerichtet hat.“
Die Lichter am Baum waren schon lange vorher gelöscht worden. Auch im Kamin fiel das Feuer zusammen und glühte nur noch dunkel. Aber die goldnen Nüsse blinkten in dem tiefen Licht nur um so goldner und der Christengel schwebte darüber.
„Ich denke, wir trennen uns,“ sagte Obadja. „Ruth, singe mir noch einmal die erste Strophe. Das soll heute mein Nachtgebet sein.“
Ruth that, wie ihr geboten.
Dann nahm Obadja das zunächststehende Licht, grüßte die noch Versammelten und ging auf sein Zimmer zu.
Auch die andern erhoben sich. In Lehnert aber reifte in dieser Nacht ein Entschluß, mit dem er seit Wochen und Monaten gerungen. Unter den überwältigenden Eindrücken der Feier, während der Ton von Ruths Gesang noch fortklang in seinem Ohre, drang es in ihm durch: es muß ein Ende gemacht werden, so oder so!
In der Halle war es um die Mittagszeit des folgenden Festtages leer und still. Die Indianerkinder hatten nach dem Frühgottesdienst die Erlaubniß bekommen, die Geschenke, die sie am Abend zuvor erhalten, von der großen Tafel wegzunehmen, und waren fröhlich lärmend nach ihren Dörfern abgezogen. Nur der Weihnachtsbaum ragte in dem Dämmerlichte – der Tag war trüb und grau – empor und erzählte von den glücklichen Stunden, die an ihm vorübergerauscht waren.
Obadja hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen und eine halbe Stunde später erschien Ruth, um ihm das Frühstück zu bringen, das er um diese Zeit zu nehmen Pflegte. Sie setzte das Tablett vor ihn hin und wollte wieder gehen, aber er hielt sie fest.
„Du bist so still, Ruth. Hast Du mir nichts zu sagen?“
„Nein. Oder doch nur das eine, das Du längst weißt, daß ich glücklich bin und Dich liebe.“
„Und bist Du glücklich?“
„Ja.“
Sie sagte das mit einem Ton, der jeden Zweifel ausschloß. Und dann küßte sie seine Hand und verließ das Zimmer.
Sie wollte an dem Weihnachtsbaum vorüber die Halle durchschreiten, fuhr aber zusammen, als ihr Lehnert, den der Baum bis dahin verdeckt hatte, plötzlich entgegen trat. Indessen es währte nicht lang; im nächsten Augenblicke lachte sie wieder. „Lehnert, Du hier? Du schleichst ja wie durch den Forst.“
Sie wußte nicht, wie das Wort ihn traf, und setzte scherzhaft und in wiedergewonnener guter Laune hinzu: „Du darfst nicht vorher die goldnen Nüsse zählen; dazu ist Zeit heut abend, wenn wir den Baum plündern.“
Lehnert versprach alles und fragte dann, ob der Vater in seinem Zimmer sei.
„Willst Du zu dem?“
„Ja.“
„Und das heut am Weihnachtstag und gleich nach der Predigt? Ei, das muß etwas Großes sein.“
„Ist es auch. Ich will ihn um etwas bitten. Und höre, Ruth, dabei fällt mir ein, Du könntest mir Glück dazu wünschen.“
„Wenn es etwas Gutes ist.“
„Ich glaube, daß es etwas Gutes ist.“
„Nun, dann von ganzem Herzen!“
Sie gab ihm die Hand, und während sie nach links hin und weit um den Tisch herum, auf den offenstehenden Flur zuschritt, ging Lehnert auf Obadjas Zimmer zu, von dessen Thür er den Vorhang zurückschlug.
Obadja saß an seinem Arbeitstisch, genau wie damals, als Lehnert zum ersten Male hier eintrat, und ganz wie damals gab er sich und seinem Stuhl eine rasche halbe Wendung und sagte: „Nun, Lehnert, was bringst Du? Nimm Platz!“
Lehnert setzte sich auch wirklich, schwieg aber befangen. Endlich war er seiner Verlegenheit Herr und begann damit, ihm für das zu danken, was er gestern abend über den Valerius Herberger gesagt habe. Das hab’ ihn die ganze Nacht nicht schlafen lassen. Er fühle, daß das das rechte Leben sei: sich, mit Gott im Herzen, vor dem Tode nicht zu fürchten. Und solches Leben zu führen, das sei so recht seine Sehnsucht. Und wenn ihn der Teufel der Eitelkeit und Selbstgerechtigkeit nicht verblende, so möcht’ er wohl sagen dürfen, er glaube, daß er nicht bloß die Sehnsucht, sondern auch die Kraft dazu habe.“
„Glaub’s, Lehnert, glaub’s . . . Aber Du wolltest mir etwas anderes sagen.“
„Ja,“ bestätigte Lehnert, „das wollt’ ich. Und wenn es vermessen und hoffnungslos ist, was ich sagen werde, dann will ich fort und zwar lieber heut wie morgen.“
Und nun hielt er inne, gewärtig dessen, was Obadja sagen würde.
Der aber schwieg beharrlich und schien nur durch Blick und Handbewegung andeuten zu wollen, daß Lehnert weiter sprechen möge. Da fiel denn auch alle Furcht von ihm ab und er ließ sein Herz nicht bloß reden, sondern ihm alle Zügel schießen. Er liebe Ruth. Er wisse wohl, daß er ein schlechter Mensch und des Glückes, das er begehre, durchaus unwürdig sei. Selbstgerecht und gewaltthätig sein, das seien die Fehler seiner Jugend gewesen und die Wurzeln des Verbrechens, um dessentwillen er seine Heimath habe meiden müssen, aber er glaube sagen zu dürfen, das alles liege jetzt weit zurück, und seit dem Tage, der seine Bekehrung gebracht, steh’ es fest in ihm, daß die Reinheit und der Friede des Herzens das einzige Heil seien. Das Lied, das damals gesungen worden sei, das hab’ ihn bekehrt und wenn nicht das Lied, so die Stimme.
„Und wenn nicht die Stimme, so Ruth,“ lächelte Obadja. Aber Lehnert sah es nicht. Er hörte nur heraus, was freundlich darin klang, und wiederholte mit Unbefangenheit: „Ja, Ruth! Sie ist es, der ich alles schulde, und sie wird mir auch dann noch das Glück bedeuten, wenn ich es in diesem Augenblicke für immer hinschwinden sehe. In Noth und Armuth und in noch Schlimmerem bin ich großgezogen worden. Das heimathliche Haus hat nichts für mich gethan und die Schule nicht viel, und alles, was ich bin, das hat zu Gutem und Schlimmem das Leben aus mir gemacht. Ich sehe hinauf zu Ruth. Aber meine Liebe ist groß und gleich groß mein Wille, sie glücklich zu machen. Mein, Wille und hoffentlich auch meine Kraft.“
Und nun sah er Obadja fest an und erwartete sein Urtheil. Der Alte schwieg aber und begegnete seinem Blicke mit nichts als freundlicher Ruhe. Dann erhob er sich, ging auf Lehnert zu und sagte: „Weiß Ruth davon?“
„Nein.“
„Nun, dann gedulde Dich, Lehnert! Es ist Rahel, um die Du wirbst . . . Ich werde Dir Antwort sagen.“
„Gedulde Dich! Ich werde Dir Antwort sagen.“ Hundert mal wiederholte sich’s Lehnert, und als Obadja am andern Morgen die Andacht gehalten und wie herkömmlich ein Bibelkapitel gelesen hatte, hoffte Lehnert, daß nun das Wort, das über sein Leben entscheiden sollte, gesprochen werden würde. Aber das Wort blieb aus und er verzehrte sich tagelang darüber, daß es ausblieb. Er wurde wie krank im Gemüth und mied es nach Möglichkeit, mit Ruth und mehr noch mit Obadja zusammenzutreffen. Als aber, ohne daß ein Wort laut geworden wäre, das neue Jahr angebrochen war, war er entschlossen, mit dem Elend ein Ende zu machen und sich wieder in sein altes Leben zurückzufinden.
Das wär’ ihm nun freilich einfach unmöglich gewesen, wenn die Haltung Obadjas irgend etwas gezeigt hätte, was auf Mißstimmung oder gar auf Uebelwollen und Ablehnung hätte gedeutet werden können. Aber eher das Gegentheil war der Fall. Keine Begegnung verging, ohne daß Lehnert einen freundlichen Blick erhascht hätte, was noch wuchs, als Obadja sich überzeugte, daß in der That keine Heimlichkeiten zwischen den jungen Leuten bestanden und Ruth ohne jede Ahnung von dem Schritte war, den Lehnert gethan hatte. So kehrte denn ein gewisser Zustand der Ruhe, wenigstens äußerlich, zurück, und wenn Lehnert jetzt, was nur zu oft geschah, seines Weihnachtzwiegespräches mit Obadja gedachte, so hielt er sich immer nur das eine vor, daß der Alte hinzugesetzt hatte: „es ist Rahel, um die Du wirbst.“ Das war, das sah er jetzt ein, mit gutem Bedachte gesagt worden [155] und jedenfalls zu dem Zweck, ihn wissen zu lassen, daß es einer langen Probezeit bedürfe.
Ja, der frühere Zustand der Ruhe kehrte zurück, und als der Winter auf die Neige ging und der Frühling anbrach, wurden auch die Feldarbeiten im ganzen Umfange wieder ausgenommen. Ueberall gab es ein Pflügen und Säen, und Lehnert war bei Beaufsichtigung der Arbeit oft bis halben Wegs nach Darlington oder auch, nach der andern Seite hin, bis an den Abhang der Berge hinaus. Auch Toby war mit Uncas viel draußen, um auf Hühner zu jagen, welche Form der Jagd der Alte, trotz grundsätzlicher Bedenken, gelten ließ, ja geradezu begünstigte, da zu seinen kleinen Schwächen auch die gehörte, den Freuden der Tafel nicht abgestorben und besonders in Bezug auf Bekassinen ein Feinschmecker zu sein.
Eine dieser Jagden auf Hühner hatte sich an einem schönen Märztage bis an eine fast schon zu Füßen von Fort O’Brien gelegene Sumpfstrecke gezogen, und Toby, gegen abend mit reicher Ausbeute heimkehrend, zeigte sich entzückt von dem landschaftlichen Anblick, den er kurz vor Beendigung seines Jagdausfluges von dem Wallgange des halbverfallenen Forts aus gehabt habe; der ganze Hügelabhang habe ihm den Anblick eines großen Blumengartens gewährt, viel, viel schöner als irgend etwas derart, was er je gesehen habe, denn in beinahe felderartigen Streifen sei die ganze Schrägung mit Frühlingsblumen überdeckt gewesen. Ruth, anfänglich ungläubig, war endlich doch von seiner Begeisterung mit hingerissen worden und hatte bei dem abschließenden Vorschläge, am andern Nachmittag eine Partie hinaus zu machen und auf der von Palissaden umstellten Bastion ein Picknick abzuhalten, ihre alte Dienerin Maruschka wie selig am Arm genommen und war mit ihr durch die Stube getanzt. Zugleich aber hatte sie sich vorsorglich erboten, den Vater nicht bloß zur Zustimmung, sondern selbst zur Theilnahme bewegen zu wollen, was ihr, wie sie wohl wußte, nicht schwer werden konnte, da sie seine Pläne kannte, das Fort von der Regierung zu kaufen und nach erfolgtem Ausbau zum Mittelpunkt eines neuen Vorwerks zu machen. Ein solcher Ausflug aber, so rechnete sie, würde ihm erwünschte Gelegenheit bieten, die ganze Sache mit unbefangenem Auge nochmals zu prüfen.
Und siehe da, Ruth hatte sich nicht verrechnet. Obadja war auf alles mit bemerkenswerther Freudigkeit eingegangen, und so ward denn die zweite Nachmittagsstunde des folgenden Tages für den Ausflug nach Fort O’Brien festgesetzt.
In zwei Wagen fuhr man hinaus und fand die mit den Eßvorräthen vorausgefahrenen Kaulbarse bereits am Eingang in die Bergschlucht vor, an einer geschützten Stelle, von der aus eine links einbiegende Steintreppe beinahe unmittelbar bis nach Fort O’Brien hinaufführte. Man begrüßte sich herzlich, und als man, oben angelangt, an ein Auspacken der seitens der Kaulbarse mitgebrachten Körbe ging, überzeugte man sich, daß dieselben in ausgiebigster Weise für das leibliche Wohl vorgesorgt hatten. Topf- und Blechkuchen, Mohnstrietzel und Marineladentöpfe stiegen in großen Mengen aus der Tiefe der beiden Körbe herauf.
„Aber nun ein Feuer,“ sagte Toby. „Wir können nicht die Verwegenheit haben, uns trocken durch diesen Kuchenberg hindurch essen zu wollen; daran würde selbst Maruschka scheitern. Also Kaffee, viel Kaffee, sonst sind wir verloren, und hier unter dieser Ahornplatane, die nicht bloß Schatten giebt, sondern auch warm und behaglich unterm Winde liegt, hier wollen wir das Feuer machen. Ich denke, wir holen uns alte Bretter aus dem Fort, das Jungholz hier herum ist noch zu naß, und wenn wir keine Bretter finden, nun, so brechen wir einen Pfahl heraus, sind ihrer ja die Menge vorhanden, und auf Vernichtung von Staatseigenthum werden wir wohl nicht verklagt werden.“
Und so sprechend, trat er an die mit spitzen Pfählen dicht umstellte Brüstung des alten Wallganges heran und versuchte mit aller Anstrengung, eine der Palissaden herauszuwuchten; Ruth wollte ihm behilflich sein und mühte sich, einen ziemlich großen Stein loszumachen, der dicht neben eben diesem Palissadenpfahl eingebettet lag. Ihre kleinen Hände waren aber zu schwach, und so sprang denn Lehnert herzu, um ihr bei dem Lockern des Steins nach Möglichkeit behilflich zu sein. Und es gelang auch. Aber im selben Augenblicke, wo der Stein sich löste, fuhr eine Kreuzotter darunter hervor, biß Ruth in das Handgelenk und war dann im Nu die Palissade hinab und in dem Blumengewirr verschwunden.
Mit einem Schrei sank Ruth in die Kniee und sagte mit unaussprechlich trauriger Stimme: „Nun muß ich sterben.“
Aber kaum daß sie diese Worte gesprochen hatte, warf sich Lehnert neben sie nieder, ergriff ihre Hand und sog mit leidenschaftlicher Gewalt und ehe sie’s hindern konnte, das Gift aus der Wunde.
Das Ganze war wie ein Blitz; Gefahr und Rettung nur ein Augenblick. Ruth aber verblieb in ihrer knieenden Stellung und sagte: „Nun stirbst Du.“
„Nein, Ruth, nein! Und wenn . .. Was liegt an mir?“
Lehnert wurde tags darauf von einem heftigen Fieber befallen und alle fürchteten für sein Leben. Ruth und Maruschka waren in Thränen und L’Hermite wetterte durch das Haus hin und hielt Reden. Jeder klagte, selbst Martin Kaulbars, der freilich seiner glücklichen Beanlagung nach nicht umhin konnte, seiner Klage zugleich etwas von einer Anklage zu geben, „Das Gift auslutschen, sei der reine Unsinn und sollte bloß so was sein; ausbrennen, das sei das Richtige, das wisse jedes Kind, und das wäre auch für Miß Ruth das Beste gewesen und für den guten Schlesier auch. Nu wert’ er wohl dran glauben müssen. Und ob Miß Ruth durchkäme, das wär auch noch so so. Aber das käme davon, wenn man von nichts wisse und in allem zurück sei.“
Zum Glück kam es anders und alle Herzensnoth Ruths und alle Neunmalweisheit Martin Kaulbars’ erwiesen sich als ungerechtfertigt. Das Fieber, das Lehnert heimsuchte, hatte mit denn Gift nichts zu schaffen und war einfach eine Folge großer Aufregung und hinzugetretener Erkältung, so daß am dritten Tage schon der aus der Nachbarschaft von Fort Mac Culloch herbeigerufene Doktor Morrison die Versicherung einer vollständigen Genesung geben und selbstverständlich an dem Fest- und Freudenmahl, das Obadja denselben Abend noch veranstaltete, theilnehmen konnte.
Lehnert war sehr glücklich und empfing, als nun alle Sorgen abgethan waren, noch einmal die Danksagungen der Familie. Sein Glück wuchs aber noch, als am andern Morgen Obadja das Gebet sprach, worin es mit besonderer Betonung hieß, daß die Liebe der einzige Lohn für treues Dienen sei. Und gleich danach nahm der Alte die Bibel und las: „Und Jakob gewann die Rahel lieb und sprach: Ich will Dir sieben Jahre um Rahel dienen. Und Laban antwortete: Es ist besser, ich gehe sie Dir, denn einem andern. Also dienete Jakob um Rahel sieben Jahr und däuchten ihn, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie.“
Ruth erröthete. Denn ohne daß ein Wort zwischen ihr und Obadja gesprochen worden wäre, wußte sie doch Mir zu wohl, daß der Vater in ihrem Herzen gelesen hatte.
Ja, Lehnert war glücklich, und nur eines war es, was ihm fehlte: sich über sein Glück aussprechen zu können. Er fühlte, so widerstrebend er sich dies auch eingestand, noch kein Recht dazu, denn das Wort, das ihm Obadja verheißen hatte, war noch immer ungesprochen geblieben, und so hielt er es denn einfach für seine Pflicht, in Zurückhaltung und Schweigen zu verharren.
Vielleicht, daß er trotz dieses starken Gefühls von dem, was sich vorläufig einzig und allein für ihn zieme, sein Schweigen dennoch durchbrochen hätte, wenn ihm L’Hermite, sein treuer Gefährte, mit mehr Neugier entgegengekommen wäre. Dieser vermied es aber offenbar, irgend eine Frage zu thun, ja zeigte sich geradezu sorglich beflissen, einem Gespräch über Ruth und Lehnert und ihr Verhältniß zu einander aus dem Wege zu gehen. Lehnert zerbrach sich den Kopf darüber, und zu der Pein des Schweigenmüssens gesellte sich auch noch die Frage, warum L’Hermite seinerseits jede Frage vermeide. Von Neid oder Eifersüchtelei konnte keine Rede sein, das lag nicht in L’Hermites Charakter oder war etwas längst Ueberwundenes, und wenn dieser, wie ganz augenscheinlich, der Liebe seines Freundes Lehnert zu Ruth trotzdem nicht froh wurde, so mußte ’was anderes vorliegen. Das Unbehagen, das Lehnert über diese Wahrnehmung empfand, war so groß, daß er schließlich, allen entgegenstehenden Selbstgelöbnissen zum Trotz, doch den Entschluß faßte, sich bei nächster Gelegenheit Gewißheit darüber verschaffen zu wollen.
Diese Gelegenheit bot sich denn auch bald. Es war ein Musikabend gewesen und Ruth hatte Lehnerts und auch L’Hermites Wunsch nachgegeben und ganz zum Schlusse noch einmal das Lied vorgetragen, das sie während der Septemberfesttage so schön und für Lehnert so entscheidungsvoll gesungen hatte. Dieser [156] war denn auch, ähnlich wie damals, von den Liebesworten und mehr noch von Ruths Stimme ergriffen worden und hatte Thränen im Auge, als das Lied schwieg. Auch L’Hermite war bewegt, und beide, wie wenn sie gewillt gewesen wären, sich den Eindruck nicht stören zu lasten, brachen früher als gewöhnlich auf und gingen in ihren Korridor hinüber. Einen Augenblick schwankten sie hier, wohin sich wenden, aber L’Hermites Zimmer, überhaupt das bevorzugtere, ward es auch heut, und nach rechts hin eintretend, nahmen beide Platz, Lehnert auf einem Schaukelstuhl, L’Hermite wie gewöhnlich mit untergeschlagenen Beinen auf seinem Arbeitstisch, den Schraubstock neben sich.
„Nun,“ sagte L’Hermite, während er eine kleine Eisenstange aus dem Schraubstock herauszog und damit zu spielen begann, „Lehnert, was giebt’s? Ich glaube, Ihr wollt mir etwas sagen.“
„Ja, seit lange schon.“
„Nun denn.“
„Ich liebe Ruth.“
L’Hermite lächelte. „Wer nicht?“
„Ah, ich versteh’. . . Ihr findet es anmaßlich“ – L’Hermite schüttelte den Kopf – „oder vielleicht ein Unrecht.“
„Weder das eine noch das andere.“
„Oder Ihr meint, sie liebe mich nicht?“
„Im Gegentheil.“
„Nun, was dann?“
„Mein lieber Lehnert,“ sagte L’Hermite und setzte sich in eine Art Positur, „Ihr wißt, daß ich nicht viel glaube. Aber ich glaube an Eines, an ein Fatum. Und weil es ein Fatum giebt, geht alles seinen Gang, dunkel und räthselvoll, und nur mitunter blitzt ein Licht auf und läßt uns gerade so viel sehen, um dem Ewigen und Räthselhaften, oder wie sonst Ihr’s nennen wollt, seine Launen und Gesetze abzulauschen.“
„Nun?“
„Und ein solches Gesetz ist es auch: wenn man erst ’mal heraus ist, kommt man nicht wieder hinein. Und da hilft kein Hoherpriester und kein Prophet, und wenn es Obadja selber wäre, gleichviel ob der alte oder der neue. Das Fatum ist eben stärker, und es ist das beste, lieber Lehnert, Ihr lebt Euch mit diesen, Gedanken ein. Ich Hab’ es gethan. Und wenn Euch das glückt, so werdet Ihr wenigstens Eines davon haben, dasselbe, was ich davon gehabt habe: das Glück der Einsamkeit. Und Ihr steht dann von Stund an über dieser armen Komödie, die Welt und Leben heißt.“
Lehnert starrte ihn an.
L’Hermite aber, dessen Bewegungen immer nervöser wurden, fuhr fort: „Gebt Ruth auf! Ihr kriegt sie nicht. Und wenn morgen die Hochzeit sein soll und die gute Frau Kaulbars so viel Kringel und Krausgebackenes bäckt, daß der Fettgeruch bis ans Ende der Welt zieht – ich sag’ Euch, Lehnert, Ihr kriegt sie doch nicht, Ihr fallt todt vorm Altar nieder. Und wenn nicht Ihr, so Ruth. Glaubt mir, es soll nicht sein. Es ist da so was Merkwürdiges in der Weltordnung, und Leute wie wir – Pardon, ich sage mit Vorbedacht, wie wir – die nimmt das Schicksal unter die Räder seines Wagens und zermalmt sie, wenn sie glücklicher sein wollen, als sie noch dürfen.“
(Schluß folgt.)
Welchen lebendigen Reiz zu humorvoller Betrachtung die Wasserkur auf Reuter ausübte, das ersehen wir aus seinen Schilderungen der „Waterkunst“ in der „Stromtid“ und aus den bisher abgedruckten Briefen. Aehnlichen Tons muß auch das nicht mehr vorliegende Schreiben gewesen sein, das er zwischen dem 19. November und dem 7. Dezember an Fritz Peters richtete. Auf dieses nimmt der nachstehende Brief an Frau Peters Bezug.
„Stuer, den 7. Dezember 1847.
Meine vortrefflichste Freundin!
Habe ich an Fritz nichts als dummes Zeug geschrieben, so bitte ich, mir dies von Ihrer Seite zu verzeihen; eine Entschuldigung will ich nicht wagen, da ich weiß, wie hartnäckig Sie auf seiner Seite stehen und wie vergeblich es sein würde, Ihnen begreiflich zu machen, daß er diese Strafe für sein Schweigen verdiene. Sie werden aus solchen Tollheiten den Schluß auf mein Wohlbefinden machen können, das sich zuweilen fast zu wahrem Uebermuth steigert und mich manchen Kummer und Sorge vergessen läßt, der billig von mir nicht leicht genommen werden sollte. Ich bin überhaupt in einer sonderbaren Lage, heiter durch Gesundheit, keck durch Sorglosigkeit, frei von allen Schranken, könnte ich augenblicklich der glücklichste Mensch sein, wenn nicht die Briefe aus Ludwigslust[1] mir alles dies raubten und mich mit Selbstvorwürfen über meine Lustigkeit erfüllten, wenn ich bedenke, daß, während ich in lustiger Stimmung schwelge, dort die arme Luise mit überhandnehmender Kränklichkeit und erbärmlicher Engherzigkeit zu kämpfen hat. Die Klagen über ihr Unwohlsein haben zugenommen, und wenn sie auch mir es bis dahin verschwiegen hat, so hat sie meinem Drangen doch nachgeben müssen und mir die Wahrheit sagen, die für mich so peinlich und schmerzlich gewesen ist, daß ich mich genöthigt gesehen habe, an ihren Arzt, den Medicinalrath B. zu schreiben, um durch diesen ihren jedenfallsigen Abgang zu Weihnacht d. J. zu bewirken. Ob sie mir folgen wird, weiß ich nicht, so viel aber weiß ich, daß ich in der höchsten Angst bin, eben weil es die höchste Zeit zu sein scheint. Ihre Briefe sind im übrigen herzlich und freundlich, sowie ich es nur hoffen kann. Ich würde Sie nicht mit solchen Nachrichten beschweren, wenn ich nicht wüßte, daß Sie mir zu gut sind, um nicht theilnehmend zu sein, und zu theilnehmend, um nicht wirklich zu wünschen, helfen zu können. Spornen Sie gefälligst die Trägheit Ihres verehrten Gemahls zu irgend einer Antwort und bedecken Sie meine Unbescheidenheit mit dem Schleier Ihrer Nachsicht. Ich denke viel an Thalberg und an das schöne Weihnachtsfest, wollte Gott, ich könnte dort sein und mich an den Kindern, an P.s großen Augen ergötzen, denn die wird der Junge bei den vielen Lichtern machen. – – – Grüßen Sie Ihr kleines Gewürm von Onkel Eute. – – – Leben Sie wohl, meine liebe Madame – – – denken Sie an mich fortwährend, als an
Ihren
dankbarsten F. Reuter.“
Der folgende Brief entstammt der Zeit des Uebergangs von der landwirthschaftlichen Thätigkeit zum dichterischen Schaffen. Reuter hat seine Luise heimgeführt und ist nach Treptow, ganz nahe bei Thalberg, gezogen, um sich dort – zunächst recht kümmerlich – durch Ertheilen von Privatunterricht zu ernähren.
„Treptow, den 30. Juni 1851.
Meine liebe, gute Madame Peters!
Jetzt erst ernstlich. – Viele tausend Grüße von meiner Luise, einen herzlichen Gruß von meiner Schwiegermutter[2] und einen Kuß auf Ihre Hand von mir. – Heute ist es mir unmöglich, zu Ihnen zu kommen und persönlich dies alles auszurichten an Sie und Ihren alten Fritz und vor allem an Großmama; aber morgen bin ich bei Ihnen, morgen hoffentlich zu Mittag, heute habe ich noch Bestellungen, Besorgungen etc. zu machen, daß ich an nichts weiteres denken kann. – Nun scherzando: Endlich ist jenes Zimmer, welches ich zu einer Speisekammer erhob, weil ich darin späterhin Speisen aufbewahren wollte, wirklich zu einer Speisekammer geworden. Mein natürlicher Instinkt trieb mich heute nach meiner Ankunft in dies räthselhafte Gemach und ich gewahrte dort einen gewissen, geheimnißvoll verschleierten Korb.[3] Dreistigkeit ist meine Sache, und mit Gagerns kühnem Griffe fuhr ich hinein. Mein Glück war größer! Er griff einen Reichsverweser, ich eine Wickelwurst. – Eine Wickelwurst ist eine schöne Idee; aber jedenfalls [157] eine unreife, wenn sie nicht gar ist; ich griff weiter! – Eine Partie schöner Lichter! Das ist ’ne gute Sache, aber nicht für’n hungrigen Magen. Wie ich nun diese Griffe riskirt hatte, schlug mir mein Gewissen und schamröthlich zog ich mich zurück von dem Inhalt des geheimnißvollen Korbes; aber auch hungrig! Die Untersuchung bleibe Luisen; ich will keine vorwitzigen Enthüllungen machen, nur sehr ernstlich will ich danken für Ihre Güte, für Ihre liebevolle Vorsorge und Ihren Besuch in meiner keinen Klause. Möge Gott Ihnen diese Freundschaft, die Sie mir und meinem lieben Weibe erweisen, dort wiedervergelten, wo Ihr Herz mit tausend Banden gefesselt ist, an dem Glücke Ihres alten Fritz und Ihrer Kinder; möge er mir es gestatten, noch lange in Gemeinschaft mit Luisen Zeuge Ihres Glückes zu sein und möge nie ein Schatten zwischen uns sein.
Morgen bin ich bei Ihnen! Fritz verreiset vielleicht; geben Sie ihm zu den gewöhnlichen 26 bis 27 Küssen, die er des Abends als Deputat empfängt, noch einen 28. in meinem Namen; aber so einen, daß er es merkt, daß er von mir kommt, so halb zwischen Küssen und Beißen.
Grüßen Sie Mutter, und Gott erhalte Sie; also morgen! Mit der aufrichtigsten Liebe
Ihr
F. Reuter."
Hatte Reuter in den Jahren der Dürftigkeit gern und leichten Sinnes entbehrt, so genoß er in der späteren besseren Zeit „froh, was ihm beschieden“. Es ist daher nicht zum Verwundern, daß die materielle Seite seiner Erfolge ihn nicht am wenigsten erfreute, und er spricht sich darüber sehr offen und munter seinem Freunde gegenüber aus. In eine besonders freudige Stimmung versetzt ihn die Schaffung eines eigenen Heims, und wenn auch diese Stimmung zuweilen getrübt wird durch die unerwartet hohen Kosten, so wird Reuter doch nicht müde, dem Freunde bis ins kleinste auszumalen, wie alles werden soll. Getreulich berichtet er auch über die vielfachen Zeichen der Zustimmung, welcher seine Werte in nah und fern begegnen und der in der mannigfaltigsten Weise Ausdruck gegeben wird.
„Neubrandenburg, den 24. Juli 1858.
"Lieber Fritz!
Wie in aller Welt, mein theurer Junge, kannst Du und Deine gute Frau Euch von uns vergessen glauben: diese Umstände treten bei uns nicht ein, aber andere Umstände, Verhältnisse und Rücksichten (köstliche Wörter, wenn man eine Entschuldigung zu schreiben hat) haben uns verhindert, Euch so recht mit Lust und Liebe unter die Augen zu treten. – – – In den letzten acht Tagen war meine Schwägerin E. hier, die gestern kurz nach Ankunft Deines Schreibens mir meine Frau entführt hat, wohin? das weiß der liebe Gott; ich bin nicht klug daraus geworden und soll ich erst von Wismar aus das endliche Schicksal dieser Weiberpläne erfahren. Soviel kann ich Dir verrathen, daß Schwaan und Rostock und Wismar und Roggensdorf und Bokenhagen und Warnemünde sehr viel durchgearbeitet worden sind und daß Dein Schreiben den Namen Thalberg auf eine höchst reuevolle, bedauernde Weise dahinein verweben ließ. Dies alles würde nun für mich keine Entschuldigung abgeben, – – – wenn ich nicht wirklich ein erbärmlich geplagtes Thier wäre. Ich hatte mir vorgenommen, ‚Läuschen un Niemels‘ diesen Sommer zu schreiben, und das wäre auch gut gewesen und gut gegangen, da kitzelt mich die Lust und ich schreibe eine Posse nebenbei; das wäre auch noch gegangen; aber dazu sollen nun noch Couplets gemacht werden; die Musik will nicht dazu passen; also müssen diese abgeändert werden etc. Du siehst, soviel habe ich noch nicht geschmiert wie
[158] jetzt. Ich bleibe nun wohl noch 8 Tage hier in den Sielen[4]; dann wird die Posse in Rostock aufgeführt, also dann dorthin, dann zu Lisette nach Schwaan, dann über Schwerin nach Berlin, nach Leipzig, nach Jena, wenn Gott mir Gesundheit und Geld dazu sendet, und dann nach Roggensdorf, und dann nach Thalberg, um Euch viel zu erzählen.
– – – Nun lebe wohl, lieber Bruder, und denke ferner an
Deinen aufrichtigen Freund
Fritz Reuter.
Meiner theuren Freundin Marie[5] meinen respektvollsten Gruß, desgleichen an Großmama und für die lieben Jungen auch einen, aber ohne Respekt.“
„Neubrandenburg, den 21. Nov. 1860.
Lieber Fritz!
Längst schon wäre es meine Schuldigkeit gewesen, Dir für Dein Buch[6] meinen herzlichsten Dank zu sagen; aber die Aussicht, Euch vielleicht hier zu sehen, und der Wunsch, gleiches mit gleichem zu erwidern, ließ mich noch immer warten – bis denn nun endlich mein Hanne Nute muthig Deinen ökonomischen Lehren in diese böse Welt gefolgt ist. Ich sollte eigentlich nicht ,muthig’, sondern ,zaghaft’ sagen, denn Dein Buch hat einen Erfolg, der noch gar nicht dagewesen ist. – – –
Also Glück auf! mein alter Doppelkollege als Oekonomiker und als Schriftsteller. Wer hätte uns wohl vor 15 Jahren angesehen, als wir Boston spielten und Preßkopf aßen, daß Thalberger Speis’ und Trank sich dermaleinst in uns zu einer geistigen Thätigkeit entpuppen würde, die in Mecklenburg und Pommern den Leuten ein Licht aufsteckt! Aber nun paß auf! Du wirst dem Fluche der Schriftstellerei nicht entgehen: erstens wirst Du verdammt werden, weiter zu schreiben, und zweitens wird sich der Neid an Deine Sohlen heften. Habe ich meinen G.[7] gefunden, wirst Du Deinen H.[8] finden; oder hast Du ihn schon? – Ich möchte den alten galligen Spitzbuben wohl mal photographiren lassen, wenn er in Deinem Buche liest. – – –
Dein Fritz Reuter.“
„Eisenach, den 21. Sept. 1863.
– – Mein alter, lieber Junge, wenn wir ehrlich sein wollen, so haben wir uns beide nicht über die Ungerechtigkeit des Schicksals zu beklagen und können dem Leiter aller menschlichen Dinge ein dankbares Loblied anstimmen. – Nun, es sind wohl ab und an ein paar Spähne in unsere Suppe hineingefallen; aber sie ist doch noch so geblieben, daß wir sie in alten Tagen mit Behaglichkeit ausessen können. – Ich habe es schon oft gesagt und sage es immer wieder: die sauren, gepfefferten Preßköpfe, die wir im Anfange der 40ger Jahre in Thalberg verzehrten, haben unsern eigenen Köpfen Vorschub geleistet und sind in unserem Organismus zu Gehirn und Gripps[9] geworden. – Gott segne diese Preßköpfe und ihr seliges Angedenken! – Dir und den Deinen wie der ganzen Art Deines Hauses habe ich zum Schlusse in meinem 2. Theile ,Ut de Stromtid’, die jetzt halb gedruckt ist, noch ein freundliches Andenken gestiftet, indem ich den 2. Weihnachtstag in Deinem gastfreien Hause[10] geschildert habe, natürlich mit dem Justizrath.
Wir leben hier in dulci jubilo fort und die Besuche sind noch immer in vollem Gange; die letzte Zeit hat uns neben manchem gleichgültigen auch deren höchst interessante gebracht, und um Euch au fait zu halten, füge ich die Fremdenliste meiner Frau im Auszuge hier bei.[11]
– – Aus dem Arbeiten wird unter solchen Umständen nicht viel, indessen wird es für den Winter anders werden; wenn meine Korrespondenz nur nicht so riesig überhand nehmen wollte. Vor einigen Tagen habe ich eine große Ueberraschung gehabt: Oberappellationsrath Buchka sandte mir zum Dank für das Porträt seines Vaters[12] einen wirklich reizenden Teppich, den seine Mutter, Frau und Schwester für mich gearbeitet haben; natürlich nahm ‚sie‘ ihn mir gleich weg, weil er für mich zu schön sei, und wenn ich mich daran erfreuen will, muß ich zu ,ihr’ gehen. –
F. Reuter.“
Und nun ein Brief, dessen Eingang ein Bild davon giebt, wie der in wenigen Jahren berühmt gewordene Dichter zeitweilig mit Geschenken und Huldigungen überhäuft wurde.
„Eisenach, den 15. Januar 1881.
Lieber Fritz!
Als Eure letzte Sendung bei uns ankam, rief ich aus: ,Herr, halt ein mit Deinem Segen!’ und wenn ich mich jetzt bedanken soll, so weiß ich nicht, soll ich bei der Spickgans anfangen und mit der Lungwurst aufhören, oder mit der Lungwurst anfangen und mit der Spickgans aufhören. Bedankt muß nun aber sein, und darum bitte ich Dich, Dir diesen Dank aus dem Vorstehenden herauszulesen. Wir sind durch Eure Sendungen und die Rauchfleischgeschenke von H. aus Hamburg – bei dem Du ja gewohnt hast, wie er mir schreibt – durch Gothaer Zungenwurst, die W. mitbrachte, durch Leipziger und Lübecker Torten hier in einen Reichthumsglanz versetzt, der den guten Thüringern die Augen verblendet hat. – Na, Gott laß es keinem missen, der das Seine an uns gethan hat, auch dem Bremer nicht, dem braven Unbekannten, der mir 200 Stück Extracigarren schickte, auch dem Zeugschmidt K. nicht, der mir eine Spickgans schickte! Nach Neujahr habe ich noch zweimal eine Freude anderer Art gehabt. Die eine war ein Brief aus Manschester von einem alten Leidensgenossen aus Silberberg[13] mit Namen Wolfs, der jetzt dort in guten Umständen lebt; die andere ein dito Brief von einem alten Friedländer Schulkameraden, Ludwig Meyer, aus Warnemünde gebürtig, der mir aus Kanada vom Huronsee her schreibt. Beide sind durch meine Schriften wieder auf mich aufmerksam gemacht worden, und von letzterem erfahre ich beiläufig, daß man meine Festungsgeschichte theilweise in der New-Yorker „Kriminal-Zeitung“ abgedruckt hat. – Viel Glück, lieber Bruder, viel Glück! und Gott erhalte mich dankbar dafür! – Auch das Reelle, der nervas rerum, strömt auf mich ein: meine Aussichten aus Geldeinnahmen für dies Jahr sind brillant. – – – Alles sehr lieb und gut, wenn nur die Korrespondenz nicht so riesig überhand nähme. Ich bin aber außerdem jetzt sehr fleißig hinter meinem Buch her und denke, ‚schmiedet das Eisen, so lang es noch warm ist,‘ und das ist nächst der grausamen Kälte – wir haben hier 20° – auf der Wartburg sogar 22° – denn auch der Grund, weshalb aus dem Rendezvous in Berlin nichts werden wird; ich muß nothwendig mit meiner Zeit geizen, um das Buch soviel wie möglich zu Ostern fertig zu bringen, und da steckt noch viel Arbeit drin. – Für Deine Anekdoten und Redensarten sage ich Dir um so mehr meinen Dank, als ich weiß, wie sehr knapp auch Dir die Zeit zugemessen ist.[14] – – –
Also H.[15] hat so theuer verkauft, das freut mich; aber ich beneide ihn nicht, vor allem, wenn er nach Demmin zieht; nichts ist schrecklicher, als langweiliger Reichthum:
‚Etwas hoffen und fürchten und sorgen
Muß der Mensch für den kommenden Morgen,
Daß er die Schwere des Daseins ertrage
Und das ermüdende Gleichmaß der Tage.’
Wir beide fürchten und hoffen noch, Fritz, Heil uns! – –
Fritz Reuter.“
„Eisenach, Jakobitag 1864.
Mein lieber Fritz!
Nachgerade wäre es doch wohl Zeit, daß ich an meinen besten Freund ein paar Worte richtete, denn der Schwur, den ich geleistet habe: früher keinen Brief zu beantworten, bevor ich mein Buch[16] nicht fertig hätte – ist Gottlob! gelöst, mein Buch [159] ist fertig und wird wohl 2 bis 3 Wochen das Licht der Welt erblicken. Du glaubst nicht wie ich von allen Seiten Deutschlands darum gequält worden bin, nun sitze ich schon 4 Tage und schreibe Briefe an diese einzelnen Quälgeister, und wenn auch der Haufen der aufgespeicherten Briefe geringer wird, zu Ende bin ich nach lange nicht. – – Wenn Ihr uns im Sommer besucht, so werden wir Euch dafür im Winter abstrafen, denn was meine ist, hat den Einfall: alle Winter reisen wir auf 6 Wochen nach Mecklenburg, da kannst Du dann so viel Plattdeutsch reden als nöthig ist; aber für immer kehren wir nicht wieder zurück, denn die Prügelstrafe kann vielleicht auf Poeten und Litteraten und ihre Frauen ausgedehnt werden und dagegen scheint meine einen natürlichen Widerwillen zu haben. Ach, lieber Fritz, wie muß ein Christ und Mecklenburger sich fressen[17] wenn im Auslande von dem lieben Vaterlande die Rede ist. Man glaubt hier alles mögliche Schlechteste von Mecklenburg und seinen Junkern und Pfaffen, und es sollte mir gar nicht schwer werden, hiesiger Bevölkerung einzureden, daß sich die Rittergutsbesitzer alle Morgen ein keines unschuldiges Tagelöhnerkind zum Frühstück braten ließen.
In der letzten Zeit ist Julian Schmidt mit Frau und Maler Pietsch mit Frau bei uns gewesen; der letztere hat sich mit Hinstorff in Verbindung gesetzt und wird die Stromtid mit Bildern versehen. Prachtvolle Bilder! wunderschöne Figuren! – – Von Otto Speckter (Maler in Hamburg) ist der Hanne Nüte illustrirt; schon alles zum Holzschneider geschickt. – Zu dem Porträt von meinem Päding[18] habe ich mich sehr gefreut, obgleich er dasteht wie ein armer Sünder, der erschossen werden soll und alle Augenblicke die Kugel erwartet. – –
Daß Du einen Bullen ‚Bräsig‘ und ein Schwein ‚Pomuchelskopp‘ getauft hast, hat mir viel Vergnügen gemacht, denn es zeigt mir, daß Du ein richtiges Verständniß dieser beiden Personen hast; aber mit der Taufe Deines neukreirten Gutes bitte ich so lange zu warten, bis Du den Schluß der Geschichte gelesen hast; ich glaube, Du wirst das Ding am Ende Resow nennen müssen, denn mein Rudolph[19] in der vollständigen Entwickelung seines Wesens bist Du, mein alter Fritz. – –
So wie mein Buch herauskommt, schicke ich es Euch, Du wirst auch Deine ‚Inflorentia‘[20] darin finden.
Mit altem treuen Gruß
Mein lieber Fritz!
Heute ist großer Brieftag bei mir; Du bist der siebente, letzte, aber auch liebste, der an die Reihe kommt, um Dir meinen Dank für Deine freundliche Geburtstags-Gratulation[22] zu sagen, obgleich man eigentlich zu 55 Jahren nicht viel gratuliren sollte. – Recht erfreut bin ich, daß Du nicht über Futtermangel klagst; die mecklenburgischen Zeitungen sind ja ebenso voll davon, wie unsere Landleute hier. – Wir leben hier in alter Weise und werden wohl noch bis Anfang März hier bleiben, da mir die Kur im Ganzen gut bekommt, nur daß sich ab und an die Kreuzschmerzen wieder melden; es ist die Sache weiter nicht gefährlich, aber wenn man Geld und Zeit daran setzt, will man die Geschichten doch los werden. Mit meinem Dörchleuchten geht es auch so ziemlich vorwärts und hoffe ich, denselben bis Weihnachten druckreif zu schaffen.–
Vor einiger Zeit war Richard Schröder[23] mit Professor Simrock und Tochter aus Bonn hier bei uns, und in den nächsten Tagen werden wir den Gegenbesuch in Bonn machen. Ueberhaupt leiden wir nicht an Langeweile, gestern war der Freiherr Gisbert Vincke, der Bruder von dem Kammer-Vincke, hier bei uns und blieb die Nacht hier, und zugleich auch der Hauptmann von Köppen, ein Dichter, der schleswig-holsteinische Kriegslieder verfaßt hat, und der Regierungsrath von Forstner. Auch der erste Kommandant von Koblenz und Ehrenbreitstein, General von Hartmann, und der Kabinettssekretär der Königin, Dr. Brandis, sind hier bei uns gewesen und ich bei ihnen. – Es ist mir höchst komisch vorgekommen, lieber Fritz, wie sich die Zeiten geändert haben: in früherer Zeit empfingen mich die preußischen Festungskommandanten im Vorzimmer oder auch gar nicht, jetzt suchen sie mich auf. Dieser war jedoch ein überaus freundlicher Mann und hat mir mitgetheilt, daß unsere preußische Kronprinzessin sich lebhaft für meine Sachen interessirt.
Meine Geldangelegenheiten stehen imgleichen so trefflich, wie ich nie im Traume geahnt habe. – – Deine Marie wird sich freuen zu vernehmen, daß der erste Band der illustrirten Stromtid in sehr hübscher Ausstattung mit den Bildern von Pietsch mir vorliegt, die andern beiden werden im Laufe dieses Monats fertig und werdet Ihr dieselben zu seiner Zeit ansehen können. –
Zu Weihnachten wird’s nun wohl nichts mit dem Wiedersehen werden; vielleicht aber später. – Viele Grüße an alle von
Der künftige Krieg! Wie ein Gespenst schwebt sein düsteres Bild über den Friedenswerken der Völker, und alle Menschenfreunde wünschen, daß sein Ausbruch in unabsehbare Fernen hinausgeschoben werden möchte! Gottlob, er steht nicht drohend vor unserer Thür; es ist den Völkern noch eine Frist gewährt, im aufbauenden friedlichen Wettstreit ihre Kräfte einzusetzen. Unermüdlich regen sich aber unzählige Hände, um die Rüstung der Nation zu schmieden, damit wir in der Stunde der Gefahr wohl gewappnet auf dem Kampfplatze erscheinen; unermüdlich sinnt der menschliche Geist nach neuen Mitteln, mit welchen er die Schlagfertigkeit der Truppen erhöhen könnte, und wie in den Werken der Kunst, Wissenschaft und des Gewerbes, so feiert auch auf dem Gebiete des Kriegshandwerks der Scharfsinn der Erfinder seine Triumphe.
Neue, bessere Waffen tauchen von Jahr zu Jahr auf; ein Staat überbietet den anderen, und wir sind endlich soweit gelangt, daß der künftige Krieg eine andere Taktik erfordern wird, daß die künftigen Schlachten ein neues, von den alten verschiedenes Bild bieten werden. Man hat vielfach versucht, diese schreckensvollen Zukunftsbilder auszumalen. Ueber den Schlachtfeldern werden die dichten Rauchwolken nicht mehr lagern, der Donner der Geschütze und das laute Knattern des Gewehrfeuers werden nicht mehr die Luft erzittern lassen; denn das neue „rauchfreie“ Pulver erzeugt nur wenig Rauch und macht wenig Lärm; aber in dieser reineren, stilleren Luft wird nach wie vor das Verderben hausen, der Tod seine Ernte halten, und wir fragen ernst, in welchem Maße?
Die Fußtruppen entscheiden in den Schlachten der Neuzeit, und sie werden mit neuen Waffen auf dem nächsten Kampfplatze erscheinen. Die verheerenden Wirkungen der bisherigen Hinterladergewehre werden durch das rasche Feuer der Magazingewehre erhöht werden, doch das ist nur eine der Neuerungen an den Handfeuerwaffen. Durch Verkleinerung des Kalibers und durch Umkeidung des Geschoßbleikerns mit einem widerstandsfähigen Metallmantel sind dieselben an und für sich wirksamer geworden, und vielfache zuverlässige Versuche ergaben erstaunliche Proben dieser Wirksamkeit.
Das Kleinkalibergewehr ist in jeder Beziehung dem alten Gewehre überlegen. Es trägt weiter, trifft sicherer und das von ihm geschleuderte Geschoß hat eine weit größere Durchschlagskraft. Auf dem Schlachtfelde äußert sich seine Wirkung wie folgt: ein und dasselbe Geschoß dringt auf 100 m Entfernung abgefeuert durch 4. bis 5 Glieder einer Kompagnie in Gefechtsformation, selbst wenn hierbei die stärksten Knochen des Körpers durchschossen werden, durchbohrt also 4 bis 5 hinter einander stehende Soldaten. Desgleichen werden auf die Entfernungen von 400 m 3 bis 4 Glieder, auf die Entfernungen von 800 bis 1200 m noch 2 bis 3 Glieder durchschossen. Und selbst bei diesen Widerständen bleibt das Geschoß fast niemals in der Wunde stecken, ja bei den mit dem französischen Lebelgewehr angestellten Versuchen wurden Leichen sogar auf die Entfernung von 2000 m durchschossen; niemals blieb die Kugel im Körper stecken. Hölzerne Brustwehren, die bis jetzt noch gegen das Gewehrfeuer schützten, verlieren an ihrer Bedeutung; denn die Kleinkalibergeschosse haben bei allen Holzarten eine fünf- bis sechsmal größere Durchschlagskraft; sie durchschlagen bei Nahschüssen Tannenholz in der Dicke von 110 cm, und selbst [160] Eisenplatten von 12 mm Stärke! So erfüllt das Kleinkalibergewehr in ungeahnter Weise die höchsten Anforderungen, die man an ein Kriegsgewehr stellt; es macht auf die weitesten Entfernungen Mann und Pferd des Feindes kampfunfähig, ist aus der Nähe selbst imstande, seine Lokomotiven zu zerstören, seine Truppen- und Proviantzüge lahmzulegen, und so darf man nicht zweifeln, daß in kürzerer Zeit alle europäischen Heere mit diesem Gewehr ausgerüstet sein werden.
Der Arzt, der berufen ist, die Wunden, die in den Schlachten geschlagen werden, zu heilen, verfolgt mit ernstem Fleiß die Vervollkommnung der Feuerwaffen. Die Todten, die, wie man sagt, „mitten durchs Herz geschossen“ auf der Wahlstatt liegen bleiben, kann er nicht wieder erwecken, aber er setzt alle seine Kräfte ein, den Verwundeten, deren Zahl ja immer eine weit größere als die der Gefallenen ist, zu helfen. Dank den Fortschritten der Kriegschirurgie sind in dieser Hinsicht die Schrecken des Krieges vielfach gemildert worden. Der Arzt unterscheidet auch zwischen humanen und barbarischen Waffen und er erachtet es für seine Pflicht, gegen letztere Einsprache zu erheben, damit sie auf völkerrechtlichem Wege verboten werden, wie dies z. B. bei Explosionsgeschossen der Handfeuerwaffen seit mehr als zwanzig Jahren der Fall ist. Der Arzt unterscheidet zwischen leichter und schwerer heilenden Wunden, er weiß aus Erfahrung, daß die eine Waffenart diese, die andere jene erzeugt, und so prüft er auch die Wirkung der neuen Gewehre von seinem Standpunkte, ob sie dem Wunsch entsprechen, daß aus dem künftigen Kriege mehr geheilte Verwundete und unter den Geheilten weniger Krüppel sich befinden.
In diesem Sinne wurden die Kleinkalibergewehre von den Aerzten verschiedener Nationen geprüft und alle gelangten dabei zu der Ueberzeugung, daß die neue Infanteriewaffe humaner ist als die alten. Bei diesen Prüfungen wurden so wichtige Aufschlüsse über die Wirkung der Geschosse gewonnen, daß auch ein weiterer Leserkreis die Erörterung dieser Fragen mit Interesse verfolgen dürfte. Und so wollen wir an der Hand der Ausführungen, die Prof. Dr. Paul Bruns in Tübingen in seinem kürzlich erschienenen Werke „Die Geschoßwirkung der neuen Kleinkaliber-Gewehre“ (Tübingen, Verlag der Lauppschen Buchhandlung) gegeben hat, auf einige der wichtigsten Punkte näher eingehen. – Fünf Jahrhunderte lang hatte man sich im Kriege damit begnügt, aus glatten Rohren Rundkugeln zu schleudern. Erst in der Mitte unseres Jahrhunderts führte man gezogene Gewehre und Spitzkugeln ein. Diese Spitzkugeln erhielten ein Kaliber von 17 bis 18 mm und ein Gewicht von 40 bis 50 g (Fig. 1). Dies war ein Fortschritt in der Kriegstechnik, denn die gezogenen Gewehre trugen weiter, die Treffsicherheit bei ihrem Gebrauch war größer und die Durchschlagskraft ihrer Geschosse eine bedeutendere. Als aber diese Gewehre als Minié-Gewehre zum erstenmal im Krimkriege verwendet wurden, da waren die Aerzte erstaunt über die erschreckende Wirkung der neuen Waffen: über die Ausdehnung und Schwere der Verwundungen, namentlich über den früher unerhörten Umfang der Knochenzersplitterung. Mit der Zeit wurde das Kaliber der Infanteriewaffen herabgesetzt. Das Langblei des preußischen Zündnadelgewehres (vergl. die Patrone Fig. 2) besaß ein Kaliber von 13,6 mm und ein Gewicht von 31 g; bei dem französischen Chassepotgewehre (Fig. 3) wurde das Kaliber auf 11 mm, das Gewicht des Geschosses auf 25 g herabgesetzt. In dem großen Kriege 1870 und 1871 erwies sich das Chassepotgewehr besser als das deutsche, und so wurden in wenigen Jahren die Infanteriewaffen aller europäischen Mächte nach diesem System verbessert; alle führten Gewehre mit länglichen cylindrischen, spitzbogenförmigen (cylindro-ogivalen) Geschossen ein, deren Kaliber 11 mm, deren Gewicht 25 g betrug, Gewehre, die eine Tragweite von etwa 2500 m besaßen und mit denen man noch auf eine Entfernung von 2000 m Mann und Pferd außer Gefecht setzen konnte.
Dieser Entwickelungsstufe gehört auch das deutsche Infanterie-Gewehr 71.84 (Patrone Fig. 4) an. Zuletzt wurde das Kaliber anscheinend auf die äußerste für Kriegszwecke zulässige Grenze herabgesetzt. Das französische Lebelgewehr besitzt ein Kaliber von 8 mm; das Geschoß ist 31 mm lang und nur 14 g schwer. Dasselbe Kaliber besitzt das österreichische Mannlicher-Gewehr, [161] das Geschoß hat eine Länge von 31,8 mm und ein Gewicht von 15,8 g. In Belgien wurde neuerdings das kleinkalibrige Mausergewehr angenommen. Das Geschoß desselben (Fig. 5) besteht aus einem Weichbleikern und einem unverlötheten Mantel aus Kupfernickelblech, ist 30 mm lang, 14,2 g schwer und von 8 mm Kaliber.[24] Das neueste deutsche Infanteriegewehr 88 endlich, welches in diesen Tagen zur Ausgabe an die Truppen gelangen soll, weist ein Kaliber von 7,9 mm auf, während das nickelplattierte Stahlmantelgeschoß 32 mm lang ist und 14,5 g wiegt.
So wurde nach und nach der Querdurchmesser der Geschosse von etwa 18 mm auf durchschnittlich 8 mm, das Gewicht von über 50 auf kaum 15 g herabgesetzt. Selbstverständlich mußte dabei die Konstruktion des Gewehres selbst mannigfache Veränderungen erleiden; man mußte, um die Durchschlagskraft der kleineren Geschosse zu sichern, ein anderes, kräftiger und langsamer wirkendes Schießpulver erfinden, man mußte schließlich auch das Material, aus welchem das Geschoß selbst besteht, ändern. Die gewöhnliche Bleikugel war zu weich; sie verursachte ein zu rasches Verbleien der Drallzüge des Rohres, sie verlor zu leicht ihre Form, und man sah sich genöthigt, das Blei mit einer schützenden Hülle zu umgeben; die Kugeln der kleinkalibrigen Gewehre sind Mantelgeschosse, bei denen der innere Bleikern von einem Mantel, sei es aus Kupfer, sei es Nickel oder Stahl, umgeben ist.
An den Arzt tritt nun die Frage heran: wie sind die Wunden beschaffen, welche von den Geschossen der kleinkalibrigen Gewehre erzeugt werden?
Schon die Einführung des 11 mm-Kalibers bei den Chassepotgewehren erwies sich in chirurgischem Sinne als günstig, die Schußverletzungen durch die Chassepotkugeln waren im allgemeinen 1870/71 weniger schwer als in früheren Kriegen. Wenig Quetschung und Zertrümmerung der Gewebe, kleine Eingangs- und Ausgangsöffnungen, das war der Charakter der Wunden, und oft trat Heilung fast ohne Eiterung ein. Diese Eigenschaften zeigten jedoch nur die Schußverletzungen, die auf größere Entfernungen zustande gekommen waren. Anders bei Nahschüssen. In diesen Fällen war das Bild oft höchst ungünstig; die Aerzte fanden Schußwunden vor, wie man sie früher noch niemals gesehen hatte, so großartig war die Zerstörung und Zermalmung der Gewebe. Der Schußkanal bildete einen Trichter, dessen Eingangsöffnung etwa dem Kaliber des Geschosses entsprach, dessen Ausgangsöffnung aber zehn- bis zwanzigmal so weit war. Gegen das Ende des Trichters waren Weichtheile und Knochen zermalmt und zerschmettert. Aehnliche Folgen wurden, wenn auch seltener, auf französischer Seite bei Verwundungen durch das Zündnadelgewehr beobachtet. Man wußte den Grund dieser Verheerungen nur durch die Annahme zu erklären, daß die Gegner allem Völkerrecht zuwider Explosionsgeschosse benutzten, die im Körper der Verwundeten platzten und die gewaltigen Zertrümmerungen verursachten. Studien über Schußwunden, die man später im Frieden anstellte, zeigten, daß diese Anschuldigungen durchaus grundlos waren, daß jedes mit großer Geschwindigkeit auftreffende Geschoß eine Sprengwirkung ausüben kann.
Jedermann weiß, daß der Druck, der auf eine Flüssigkeit ausgeübt wird, sich in derselben nach allen Richtungen hin fortpflanzt, jedermann kennt die auf diesem Gesetz aufgebaute hydraulische Presse. Auch die Kugel, welche in eine Flüssigkeit, z. B. Wasser, einschlägt, erzeugt in diesem einen Druck. Ist nun das Wasser in einem Gefäß eingeschlossen und schießt man in dasselbe hinein, so wird das Wasser in der Regel (bei Benutzung gewöhnlicher Jagdflinten) in einer hohen Säule aufspritzen. Hat aber das Geschoß, welches das Wasser trifft, eine besonders hohe Geschwindigkeit, pflanzt sich infolge dessen der durch dasselbe erzeugte Druck plötzlich und ungemein rasch in allen Wassertheilchen fort, so werden diese keine Zeit finden, durch die obere Oeffnung zu entweichen, sondern mit voller Wucht gegen Wand des Gefäßes drängen und dieses sprengen. Dies ist oft durch Proben festgestellt worden.
Nun sind die mit Blut und Säften durchtränkten Organe des menschlichen Körpers in ihrem Verhalten einem solchen Wasserkasten ähnlich. Trifft das Geschoß mit hoher Geschwindigkeit die Leber, die Milz, das Herz oder den mit weicher Gehirnmasse gefüllten Schädel, dann treten derartige Sprengwirkungen durch den hydraulischen Druck ein, dann entstehen jene gefährlichen trichterförmigen Wunden, dann geschieht es, daß der Schädel durch einen solchen Schuß, durch eine einzige Kugel so jäh zersprengt wird, daß die Stücke weit umherfliegen.
Wie verhalten sich nun das neue 8 mm- und das alte 11 mm-Geschoß in Betreff dieser Sprengwirkung? Bei dem Kleinkaliber kommt diese überhaupt nur so lange zur Geltung, als das Geschoß die Endgeschwindigkeit von etwa 300 m und darüber besitzt, d. h. auf Entfernungen bis zu etwa 800 m, bei dem 11 mm-Geschoß genügt schon die Endgeschwindigkeit von 200 m, welche das Geschoß auf etwa 900 m erreicht. Die Zone, in welcher die Nahschüsse aus dem Kleinkalibergewehre solche Sprengwirkungen erzeugen können, ist somit kürzer, außerdem bringt der kleinere Durchschnitt des Geschosses es mit sich, daß die Druckwirkungen zwei- bis dreimal geringer sind als bei den 11 mm-Kugeln.
Es werden somit diese schlimmen Verwundungen auch in Zukunft vorkommen, aber sie werden nicht so häufig und nicht so umfangreich sein wie bisher. Die Zone der nach dieser Seite hin eigentlich gefährlichen Nahschüsse umfaßt etwa die ersten 400 m der Flugbahn des kleinkalibrigen Geschosses.
Bevor man Klarheit über diese hydraulischen Wirkungen der Geschosse erlangt hatte, suchte man diese Erscheinung durch die Annahme zu erklären, daß die Kugeln beim Auftreffen auf festere Theile sich bis zum Schmelzpunkt erhitzten und die geschmolzene Masse alsdann die Sprengungen verursachte. Dadurch sollte zugleich das Zersplittern, die Formveränderung, Abplattung etc., die „Deformation“ oder „Entformung“ des Geschosses, erklärt werden, welche wieder dazu beiträgt, den Charakter der Wunde zu verschlimmern.
Prof. Bruns hat auch diese Frage durch seine Versuche entschieden. Er benutzte dazu einen viereckigen, hinten und zu beiden Seiten mit starken Eisenplatten versehenen Kasten, in welchen die als Ziel dienenden Eisenscheiben in bestimmten Abständen eingesetzt werden konnten. Nach vorne wurde der Kasten durch ein ganz dünnes Blech, nach oben durch eine aufgelegte Eisenplatte geschlossen, nach unten blieb er offen gegen eine Schieblade, welche in dem den Kasten tragenden Holzgestell angebracht war. Auf diese Weise fiel das abgefeuerte Geschoß mit allen seinen Bruchstücken, nachdem es durch die dünne vordere Blechscheibe gedrungen und dahinter auf die Eisenplatte aufgeschlagen war, unmittelbar in die Schieblade. Diese wurde mit Stoffen von verschieden [162] hohem Schmelzpunkte (wie Paraffin, Schwefel in Pulverform etc.) gefüllt, um zu beobachten, inwieweit dieselben durch die niederfallenden Bleitheile zum Schmelzen gebracht werden.
Prof. Bruns fand nun, daß größere Bleistücke sich höchstens bis auf 150°, die kleinen bis 200° und die kleinsten bis zu höchstens 210° C. erwärmten; der Schmelzpunkt des Bleis liegt aber erst bei 334° C. Bruchstücke von Stahl- und Nickelmänteln erhitzten sich bis zu 230° C., die kleinsten ausnahmsweise bis über 300° C. Ein Schmelzen der Geschosse konnte nicht festgestellt werden. Die Entformung geschieht also nur infolge des Druckes auf rein mechanischem Wege. Die Mantelgeschosse erweisen sich dabei widerstandsfähiger als die einfachen Bleigeschosse. Von welcher Bedeutung dies für die Durchschlagskraft des Geschosses ist, beweisen unsere Abbildungen. Fig. 6 zeigt den cylindrischen Schußkanal, der durch 8 mm-Nickelmantelgeschoß in trockenes Buchenholz gebohrt wurde. Die ganze Länge des Schußkanales, der hier nur in seinen letzten 13 cm abgebildet ist, beträgt 54 cm, und das Geschoß liegt fast unverändert im blinden Ende desselben. Fig. 7. stellt den Schußkanal durch 11 mm-Weichbleigeschoß dar. Der Kanal ist nur 8 cm lang und trichterförmig; die Einschußweite hat einen Durchmesser von 6 mm, das blinde Ende aber, in welchem das kaum noch erkennbare Geschoß liegt, einen solchen von 46 mm. Man erkennt daraus sofort, wie das Bleigeschoß durch seine Entformung sich größere Widerstände schafft.
Bezeichnend für die Durchschlagskraft der Geschosse sind ferner unsere weiteren Abbildungen Fig. 8 und 9, welche Schüsse auf 12 m Entfernung durch eine 4 mm dicke Walzeisenplatte darstellen. In Fig. 8 finden wir ein kreisrundes Loch, welches das 8 mm-Geschoß geschlagen hat, in Fig. 9 die unregelmäßige größere, seitlich eingerissene Oeffnung, welche das 11 mm-Geschoß zustande brachte. Dieses Verhalten des neuen Geschosses ist von größter Wichtigkeit; denn trifft es auf Knochen, so zertrümmert es dieselben bei weitem weniger als das alte Geschoß, ja es erzeugt in denselben reine Lochschüsse ohne weitergehende Risse und Brüche. Selbst dem Laien muß es einleuchten, daß derartige Wunden rascher und sicherer heilen als Wunden, bei denen weite Partien des Knochens beschädigt sind.
Es würde zu weit führen, hier auf die Wirkungen der Geschosse in verschiedenen Entfernungen oder Zonen ausführlicher einzugehen; denn mit der abnehmenden Geschwindigkeit der Kugel ändert sich auch die Beschaffenheit der Wunde. Das eine steht aber fest, daß der Charakter der Schußwunden durch die kleinkalibrigen Geschosse in allen Zonen, sei es bei Nah- oder Fernschüssen, ein viel günstigerer ist.
„Es ist gewiß mit hoher Freude zu begrüßen,“ schließt Prof. Bruns seine Ausführungen, „daß die durch taktische Gründe bedingte Herabsetzung des Kalibers und insbesondere die davon unzertrennliche Einführung der Mantelgeschosse gerade im Sinne der humanitären Bestrebungen liegt. Die künftigen Kriege werden vielleicht in derselben Zeit zahlreichere, aber jedenfalls viel häufiger reine und glatte Schußwunden bringen; . . . der Heilungsverlauf wird sich günstiger gestalten, Verstümmelung und Verkrüppelung häufiger vermieden werden. – Das neue Kaliber ist nicht bloß die beste, sondern zugleich die humanste Waffe, um nach Möglichkeit die Schrecken des Krieges zu mildern.“
Blätter und Blüthen.
In den pontinischen Sümpfen. (Zu dem Bilde S. 145.) Wie Goethe vor hundert Jahren besteigen wir eines Morgens in Velletri die Diligenza – noch immer das einzige Verkehrsmittel auf der 50 Kilometer langen Straße zwischen den beiden Grenzstationen der pontinischen Sümpfe: Cisterna und Terracina – wohlgewarnt von Wirth und Vetturin vor den Gefahren der Malaria. Steil fällt die Poststraße die artemisischen Hügel hinab, einsam, staubig. Aber mit einem Schlage, bei plötzlicher Wendung, liegt sie nun dicht vor uns, die unermeßliche, schweigende, einsame, von weißlichen Dünsten umschleierte Ebene, groß wie ein Meer. In schnurgerader Linie, gesäumt von dem Abzugskanal, den Papst Pius VI. gezogen, der Linea Pia, schneidet durch die Ebene die Via Appia, die „Königin der Straßen“, auf welcher einst die römischen Legionen in den Süden hineinzogen. Vorerst steigt sie und fällt sie noch, windet sich um immer flacher werdende Hügel herum, läuft an einsamen Meiereien, einem zerfallenen Kirchlein vorüber, und dann ist man in Cisterna, der „Region der Büffel, des Fiebers, der Sümpfe und der Räuber“. Hier beginnt der Sumpf, die fiebergelben Gesichter der vermummten, vom Frost geschüttelten Bauern sagen’s uns, und dehnt sich hinab bis zum Meere, ein großer Leichenacker. Wie zum Trost schweift der Blick links hinüber nach den Volskerbergen und findet hoch droben, ins Himmelblau getaucht, zunächst Rocca Massima, dann unterhalb das Felsennest Cori, einst Cora, dessen arme Bewohner sich des Ursprungs von Dardanos rühmen, dem Stammherrn der Trojaner, das in seinen cyklopischen Mauern noch von gewaltigen Urzeiten erzählt, das in den Volskerkriegen durch das Römerschwert unsägliches gelitten. Wild schieben die Felsen sich über- und durcheinander, und auf steiler Klippe richtet sich Norma auf (343 Meter ü. M.), bei den Römern, die in den festen Mauern die karthagischen Geiseln in Sicherheit brachten, Norba genannt. Auch hier cyklopische Mauern und Tempelreste, deren Steine, angeblich von Herkules selbst gefügt, im sullanischen Kriege wild durcheinandergeworfen wurden.
Nach diesem Norma hinauf steigt aus den Sümpfen eine Straße und an ihrem unteren Ende liegt Ninfa, der Kirchhof, die Leiche einer Stadt, die ihren Tod durch Ertrinken in den Sümpfen fand, nachdem ihre Bewohner von dem Würgengel Malaria erstickt worden waren.
Uns packt die geheimnißvolle Gewalt des Märchenzaubers. Die Stadt ist wie zu einem großen Blumenfeste geschmückt. Ueber die Mauern, Hütten, Häuser, über Kirchen und Thürme hat der Epheu sein grünes Netz gebreitet, von Gesims zu Gesims ziehen seine flatternden Gewinde, aus den Thurmfenstern hangen die Ranken. Wie eine stille Braut, die den Bräutigam erwartet, spiegelt Ninfa sich in seinem schilfumsäumten See. Das Thor der Basilika steht offen, helle Sonnenlichter spielen auf dem blumenbewachsenen Mosaikfußboden; von den Wänden schauen die schattenhaften Figuren von Heiligen in verblichenen byzantinischen Gewändern; den Altar überdeckt ein Blumenteppich, um den ein Schmetterlingspaar gaukelt. Das Reich Dornröschens! Die tiefe Stille, sie wird nur unterbrochen durch das schläfrige Gemurmel des Flusses Ninfa, dann und wann auch durch das Krächzen der Reiher, die ungestört zwischen den Binsen des Sees nisten, der Raben, die in den Spalten eines alten Feudalthurmes aus- und einfliegen.
Die Steine des säulenragenden antiken Brunnenhauses, des Nymphaeums, von dem der Ort den Namen erhielt, sind längst in dem Sumpfe versunken. Auf seinen Ruinen errichtete ein späteres Jahrhundert eine dem Erzengel Michael geweihte Kirche; so erzählt die Ueberlieferung. Sicher ist, daß im Jahre 1216 der Kardinal Ugolino, nachheriger Papst Gregor IX., hier am Orte die Kirche S. Maria del Mirteto (zum Myrtenhain) bauen ließ, neben welcher die Ritter des heiligen Lazarusordens ihren Sitz hatten. Weiteres weiß man nicht von der Stadt. Der Sumpf schlich näher und näher an die Mauern heran, das Fieber wanderte durch die Gassen, und eines Tages war niemand mehr da, der die Todten beweinen konnte. Die schöne mittelalterliche Stadt war eine Sage geworden.
Das Land, das ringsum noch im Schmucke seiner Oliven, Reben, Orangen und Citronen lächelt, lächelt wie ein Sterbender; es ist das Lächeln des Todes, das wir sehen. Er eilt auf Flügeln der Malaria vom Gebirge zum Meer hinab und zurück und mäht das Leben, wo er es findet. Wem er begegnet in dieser Ebene, den grüßt er mit dem Gruße der Unterwelt. Die Straße, die wir ziehen, von Cisterna hinab gen Terracina, geht mitten durch sein Reich: eine Gräberstraße, und der Gruß der Schnitter, die mit Weib und Kind todesmuthig im glühenden Erntemond von den Höhen hinabwandern, das Korn der reichen römischen Herren einzuheimsen, klingt uns wie der Gruß der zum Sterben bereiten Fechter des alten Roms: Morituri te salutant! Woldemar Kaden.
Ein hungriger Gast. (Zu dem Bilde S. 137.) Es sind sonst nicht gerade die friedsamsten Gesellen, die fahrenden Kriegsknechte, die ihre Dienste überall anbieten, wo es Händel und einen gut zahlenden Herrn giebt, oder die auch wohl in Ermangelung solcher Gelegenheit zu „ehrlichem“ Verdienste auf eigene Faust das Kriegen anfangen. Diesmal aber haben wir es mit einem verhältnißmäßig ordentlichen Vertreter dieser Menschenklasse zu thun; verhältnißmäßig – denn auch er wird sich kaum die Mühe genommen haben, sich über die Entbehrlichkeit des fetten Huhns, das an seiner Seite hängt, erst genauer bei der Bäuerin zu erkundigen, ehe er es heute früh beim Durchmarsche durch das halbschlafende Dorf mitlaufen ließ.
Aber der schon etwas ältliche Kumpan, den wir auf unserem Bilde im grobgenähten Lederkoller, in Eisenwams und Eisenschuhen vor uns sehen – er ist unter seinem rauhen Kriegshandwerk empfänglich geblieben für die Reize friedlicher bürgerlicher Lebensart – insbesondere soweit solche mit einem ausgiebigen Nahrungsstande verbunden ist. So hat es denn sein gutmüthig schmunzelndes Gesicht rasch dahin gebracht, daß der sechsjährige Bube seiner Quartiergeberin Freundschaft mit dem Fremdling schloß und in kindlichem Anpassungstrieb sofort sich mit des neuen Kameraden Armbrust und – Schnapsflasche bewehrte. Mit ehrlicher Bewunderung schaut das Schwesterchen auf die mit erstaunlicher Schnelle zwischen den Zähnen des hungerigen Gastes verschwindenden Knödel – sie weiß, daß sie für den Nothfall, wenn die Knödel zur Stillung des Appetites nicht ausreichen sollten, noch mit ihrem Brotlaib einspringen kann. Auch die junge Mutter hat Vertrauen zu dem vielleicht nicht eben gerne begrüßten Gast gefaßt und sie schaut mit Befriedigung auf den glänzenden Sieg, den ihre Kochkunst bei dem fahrenden Mann zu verzeichnen hat. =
Das viele Kaffeetrinken. Wir wissen seit lange, daß ein übermäßiger Genuß des Kaffees der Gesundheit nicht zuträglich ist, und jedermann kennt auch die Anzeichen der Vergiftung durch Kaffee. Man wird matt, unlustig zur Arbeit, leidet an Kopfdruck und Schlaflosigkeit; die Hände zittern, das Herz schlägt schnell, unregelmäßig und schwach; der Puls ist dementsprechend klein und weich; der Appetit fehlt und man verspürt Angstgefühle. Das kommt von dem vielen Kaffeetrinken, und es kommt vor bei Männern wie bei Frauen; bei letzteren entschieden häufiger, denn die Frauen „kneipen“ ja in Kaffee, wie man unhöflich zu sagen pflegt.
Wir sind allerdings noch weit davon entfernt, von einer „Kaffeeseuche“ reden zu dürfen, wir befinden uns noch in dem Stadium des Kränzchendusels,
[163] aber der Kaffeemißbrauch gewinnt immer mehr Ausbreitung und macht sich auch in den Kreisen bemerkbar, deren Frauen keine Zeit haben, von 4 bis 7 oder gar 8 Uhr „nachmittags“ vor Tassen und Kannen zu schwelgen – in Genüssen des Gaumens und des Gehörs. So z. B. sind neuerdings in Essen einem Arzte viele Schwächezustände unter den Frauen der Arbeiterbevölkerung aufgefallen, die lediglich auf den Mißbrauch des Kaffees zurückgeführt werden mußten. Dies erklärt sich leicht dadurch, daß gerade viele billigere Sorten, wie z. B. der Ceylonkaffee, sehr viel Coffeïn enthalten. Für Gesunde ist der Kaffee in angemessener Menge ein gutes Anregungsmittel. Schwache Personen aber sollten in diesem Genuß vorsichtig sein, denn das viele Kaffeetrinken schwächt das Herz und zerrüttet die Nerven. *
Friedrich Mitterwurzer. (Zu dem Bilde S. 133.) Wohl der eigenartigste unter den jüngeren Darstellern, die sich eines weitreichenden Rufes erfreuen, lenkt Mitterwurzer seit seinem glänzenden Gastspiel am Berliner Hoftheater jetzt mehr als je die Augen auf sich, nachdem auch seine Erfolge jenseit des Oceans in der deutschen Presse ein lebhaftes Echo wachgerufen haben.
Mitterwurzer ist ein echtes Theaterkind; er wurde am 16. Oktober 1844 in Dresden geboren als Sohn des vielgenannten Baritonisten, Opern- und Kammersängers Anton Mitterwurzer; auch seine Mutter gehörte als Schauspielerin der Hofbühne an. Als ganz junger Mensch hatte er schon zur Fahne Thaliens geschworen und führte ein lustiges Wanderleben bei den kleinen Bühnen der Lausitz und Schlesiens. Namentlich bei der trefflichen Direktion Heller, welche ihre Vorstellungen in Liegnitz, Schweidnitz, Bunzlau gab, spielte er große und keine Rollen und wirkte auch im Chor und im Ballet mit – alles für zwölf Thaler Monatsgage. Nach einem kürzeren Aufenthalt im Vogtlande, bei der Direktion Leichsenring, wo er z. B. Laubes Essex spielte, kam er nach Hamburg ans Thaliatheater und wurde bald ein Liebling des vielgewandten Direktors Maurice und seines schneidigen Oberregisseurs Marr. Er spielte dort komische Rollen und hatte mit einer episodischen Genrefigur, dem Schulmeister in „Deborah“, einen durchschlagenden Erfolg.
In Bremen unter der Direktion Ritter und Behr spielte er dann jugendliche Liebhaber, und zwar mit solchem Feuer, daß er einmal einem Mitspieler fast das rechte Auge ausstach. In der Tragödie konnte er keine Fortschritte machen, da er noch keine Beschäftigung an Hoftheatern fand; so wandte er sich dem Berliner Wallnertheater zu, wo er theils in der Posse als Darsteller urwüchsiger Stiefelputzer glänzte, theils in französischen Stücken sein Glück als Liebhaber versuchte im Zusammenspiel mit Agnes Wallner; er wurde zwar bemerkt, doch öfters ausgelacht wegen seiner abenteuerlichen Masken und seines oft nicht minder abenteuerlichen Spiels. Noch schlimmer erging es ihm am Breslauer Stadttheater, wo er als erster Held in Rollen wie Essex und ähnlichen Fiasko machte und die ganze Kritik gnadenlos über ihn herfiel.
Das waren die Lehrjahre des Künstlers, die ihm keine Befriedigung gewähren konnten und in denen er gewiß oft an seinem Talent verzweifelte. Eine günstige Wendung für ihn trat erst ein, als er in Graz angestellt wurde; dort schlug sein Hamlet zündend ein; er spielte alle Liebhaberrollen und wurde bald ein Liebling des Publikums. Von dort berief ihn Laube an das Burgtheater; er gastirte mit einem allerdings nicht unbestrittenen Erfolge als Hamlet, Tellheim, Petrucchio; während seines Gastspiels ging Laube von der Direktion ab und sein Nachfolger Friedrich Halm wollte von einer dauernden Verwendung Mitterwurzers nichts wissen. Der Künstler spielte wieder in Graz, dann im Theater an der Wien, und als Laube 1869 die Direktion des Leipziger Stadttheaters übernahm, folgte er ihm dorthin und wurde wegen seiner glänzenden Vielseitigkeit eine Hauptstütze des Repertoires.
Ein anderer berühmter Theaterleiter, Franz Dingelstedt, gewann nach Laubes Abgang von Leipzig Mitterwurzer für das Burgtheater. Doch fühlte dieser sich in dieser gebundenen Stellung auf die Länge nicht behaglich; es fehlte ihm die freie Bewegung; eine große Zahl von Rollen, deren Darstellung seinem Ehrgeize als wünschenswerthes Ziel erschien, wurde ihm vorenthalten, weil ältere Darsteller bereits in ihrem Besitze waren. So ließ er sich von seinem alten Gönner Laube, der seit mehreren Jahren das Wiener Stadttheater leitete, bestimmen, seinen Vertrag mit dem Burgtheater zu lösen, indem er sich vom Kaiser selbst seine Entlassung erbat. Aber gerade als er frei geworden, trat Laube von der Direktion des Stadttheaters zurück. Mitterwurzer blieb demselben dennoch eine Zeit lang treu; eine kurze Episode seiner Künstlerlaufbahn war seine Thätigkeit beim Ringtheater, das bald nach seinem Eintritt in den Verband desselben in Flammen aufging. An diesen Theatern spielte er moderne, meist französische Rollen. Dann trieb es ihn hinaus in die Ferne; ein glänzender Gastrollencyklus in Nordamerika führte ihn bis San Francisko.
Nach seiner Rückkehr machte sein Gastspiel in Berlin viel Aufsehen: er spielte dort in dem erfolgreichsten Stücke Ernst von Wildenbruchs, „Die Quitzows“, den alten Raubritter Dietrich von Quitzow, den märkischen Götz von Berlichingen; unser Bild stellt ihn in dieser Rolle dar. Es war eine durchweg vortreffliche Leistung, welche zum Erfolge des Trauerspiels wesentlich beitrug: die Selbstherrlichkeit des Ritters, seinen herausfordernden Uebermuth, sein joviales und dann wieder schneidiges Wesen wußte er mit energischer Ursprünglichkeit darzustellen.
Friedrich Mitterwurzer besitzt ein eigenartiges Darstellungstalent von großer Frische und Schärfe. Den Eingebungen seines künstlerischen Genius folgend, übt er oft eine hinreißende Wirkung aus; aber er ist bisweilen abhängig von seinen Stimmungen und spielt dieselbe Rolle ungleich an verschiedenen Abenden. Es ist bei ihm nichts Eingelerntes, nichts Schablonenhaftes; von seiner glänzenden Vielseitigkeit legen die Rollen Zeugniß ab, die wir bei der Schilderung seiner bisherigen Laufbahn erwähnten; es finden sich darunter Helden- und Liebhaberrollen, Intrigantenrollen, aber auch Rollen aus dem Bereich der Posse. Wir selbst sahen Mitterwurzer während seines Wirkens in Leipzig an einem Tage einen Wiener Schusterjungen und am nächsten den Marquis Posa mit gleichem Erfolge spielen. Vortrefflich ist er auch als Bonvivant: als Bolz in den „Journalisten“ und als Fox in „Pitt und Fox“. †
Singen und Sagen. Unter diesem Titel hat Albert Möser neue Gedichte veröffentlicht [Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei Aktiengesellschaft (vorm. J. F. Richter)], welche alle Vorzüge seiner früheren wiederum bewähren. Möser gehört nicht zu den Dichtern, die es mit der Form leicht nehmen und denen es, was Rhythmus und Reim betrifft, gleichsam auf eine Handvoll Noten nicht ankommt. Er bevorzugt künstlerische Strophenformen, insbesondere das Sonett, und bewegt sich in ihnen zwanglos und geschmackvoll. Sein Vorbild ist offenbar Platen und von den Dichtern der Gegenwart erinnert er am meisten an den Grafen Schack. Wie dieser liebt er auch weltweite Fernblicke, was sich besonders in dem Abschnitt „Aus allen Zonen“ zeigt. Ebenso sucht er Entdeckungen der neueren Naturwissenschaft in dichterisches Gewand zu kleiden. Gleich im ersten Buche finden sich derartige Gedichte: „Der Komet“, „Gesang des Weltmeers“, „An Darwin“, „Das Erdbeben“, „Doppelsterne“. In den erzählenden Gedichten greift der Dichter bis in das Alterthum zurück; aber auch die neueste Zeit bietet ihm willkommene Stoffe. Sehr stimmungsvoll ist das Gedicht „Langensalza“ auf den 27. Juni 1866. Die Erinnerung an den blinden König Johann von Böhmen, der sich bei Crecy 1346 aufs Roß binden ließ und so in die Feinde stürmte, ist von schlagkräftigster Wirkung. Der blinde König von Hannooer glaubt nach dem Kampfe bei Langensalza des Sieges sicher zu sein. Da redet ihn der Dichter an:
„O König, fürchte des Schicksals Hohn!
Ein Wahn hat dich betrogen;
Wohl siegst du heute, doch morgen schon
Irrst du als Flüchtling ohne Thron,
Bist rings von Feinden umzogen.
Von König Johann, dem Kaisersproß,
Dem blinden, wohl hörtest du Kunde;
Er ließ sich binden aufs hohe Roß,
Stob muthig in rasender Feinde Troß
Und suchte die Todeswunde.
Die tausendjährige Herrlichkeit
Der Welfen, wie bricht sie in Scherben!
Verbanne die Hoffnung fern und weit,
Wirf gleich Johann dich in den Streit
Und stirb wie Helden sterben!
Sehr schwunghaft sind auch die drei ersten Strophen des Gedichts „Die Rosse von Mars la Tour“:
„Der Kampf ist geendet, es nahet die Nacht,
Es flammen die Dörfer im Kreise,
Da schmettert das Horn mit gellender Macht
Und ruft aus der wilden, der grausigen Schlacht
Die Streiter mit mahnender Weise.
Erst Stille ringsum, dann dumpf und schwer
Hört man den Boden erdröhnen,
Und wild über Leichen und blutige Wehr
Braust her von Rossen ein wieherndes Heer,
Gelockt von des Hornrufs Tönen.
Es lodert ihr Auge in feurigem Brand,
Noch sprühen die Nüstern vom Kampfe,
Sie stehen gereiht und stampfen den Sand,
Doch, die sie am Morgen noch lenkte, die Hand,
Starr ward sie im Todeskampfe.
Kaiser Neros Tod. (Zu dem Bilde S. 152 u. 153.) An den Namen Neros knüpft sich die Erinnerung an die entsetzlichsten Ausbrüche des Cäsarenwahnsinns. Gemahlin, Mutter, alle die, welche ihm einst näher gestanden hatten, Verwandte, Lehrer und Freunde hat der grausame Tyrann ermorden lassen, und man traute ihm zu, er habe, um sich das Schauspiel des brennenden Trojas zu verschaffen, die Stadt Rom anzünden lassen. Aber Nero machte die Christen für den furchtbaren Brand verantwortlich, um die Wuth des Volkes von sich ab auf diese zu lenken, und die angeblichen Verbrecher verfielen dem schauerlichen Lose, als lebendige Fackeln ein Spiel im Cirkus zu beleuchten. Und was die Grausamkeit ihm noch von Menschenwürde ließ, das zerstörte die läppische Eitelkeit des kaiserlichen Sängers und Schauspielers. Endlich wurde das römische Volk der Gewaltthaten müde, es empörte sich wider den Imperator, die Legionen riefen Galba zum Kaiser aus und der Senat erklärte Nero für einen Feind des Vaterlandes. Von allen, auch von seinen vertrauten Spießgesellen verlassen, mußte Nero fliehen und eilte nach dem Landhaus eines seiner Freigelassenen. Kaum war er in dem schmutzigen Vorflur angekommen, als er Huftritte vernahm – seine Verfolger nahten. Nero erhob den Dolch, um sich den Tod zu geben; doch der Anblick des Mordstahles machte den Feigling erzittern, der Freigelassene mußte ihm die traurige Aufgabe abnehmen, und mit dem Rufe: „Welch ein Künstler stirbt in mir!“ stürzte der einstige Kaiser auf die kalten Steinfliesen. Die Häscher fanden einen Sterbenden.
Dieser Augenblick ist es, den der Maler dargestellt hat. Der Freigelassene ist neben dem Kaiser niedergesunken und forscht in den verzerrten Zügen nach dem entfliehenden Leben. Der Mann, der wie zusammengebrochen unter der Wucht des Schrecknisses abseits kauert, ist der Vater des Freigelassenen. Nur mühsam kann der römische Krieger, der zuerst eingedrungen ist, das nachdrängende Volk zurückhalten, welches das Entsetzliche schauen will, Staunen und grimmige Freude in seinen Mienen verrathend. In der Ferne werden Pferdeköpfe sichtbar: es sind die Reiter des Senats, die den Flüchtling aufjagen sollten aus seinem Schlupfwinkel. Der noch jugendliche Düsseldorfer Maler, E. Kaempffer, hat für das Bild „Kaiser Neros Tod“ den Preis der Wetterstiftung für die beste Handzeichnung, ein Stipendium für eine Reise nach Italien, erhalten.
Allerlei Kurzweil.
| Rösselsprung. | Scherzbilderräthsel. | Räthseldistichon. (Zweisilbig.) | |
Findest die erste Du nicht, so greife beherzt Auflösung der Damespielaufgabe auf S. 132: 1. D f 8 – e 7 D d 4 – g 1 † 2. d 2 – c 3 D g 1 – d 4 † | |||
| Räthsel. Hast du der Werke zwei dir auserwählt | |||
Logogryph. Zählt man mit einem o mich zu den Philosophen, | |||
| Skataufgabe Nr. 2. Von K. Buhle. |
Auflösung des Kapselräthsels auf S. 132: Sander, Salamander. Auflösung des Homonyms auf S. 132: Steuer. |
| Der Spieler in Mittelhand hat auf folgende Karte: | Auflösung des Räthseldistichons auf S. 132: Reblaus – Breslau. |
| Auflösung der räthselhaften Inschift auf S. 132: Glücklicher Säugling! Dir ist ein unendlicher Raum noch die Wiege. | |
| Auflösung der Schachaufgabe Nr. 2 auf S. 132: | |
| den tournirt und noch einen Trumpf gefunden, verliert aber das Spiel, denn die Gegner bekommen 83 Augen herein. Müßten die Gegner zwei Sieben mit einander vertauschen, so würde der Spieler mit Schwarz gewinnen. Welches Blatt hat der Spieler noch gefunden? Wie sitzen die Karten und wie ist der Gang des Spiels? Welche zwei Karten würden zu tauschen sein? |
1. D g 1 – g 2 S h 4 X g 2 A) B) C) D) A) 1. ...... K X S B) 1. ...... c 7 – c 6 C) 1. ...... h 6 – h 5 D) 1. ...... S f 2 beliebig. Gegen 1. S d 6 – b 5 hilft nur K c 5 X d 5; 1. D g 1 – g 7 † scheitert an K c 5 X d 5; 1. T f 7 X e 7 † widerlegt nur K e 5 – f 4! und gegen 1. D g 1 – c 1 geschieht S f 2 – e 4. |
Kleiner Briefkasten.
Pa., Schwabach. Die Einstellung von Vierjährig-Freiwilligen der Landbevölkerung bei den Matrosendivisionen findet in der Regel jährlich zweimal und zwar am 1. Februar und am 1. Oktober statt. Ueber die Beförderung der Vierjährig-Freiwilligen werden Sie am besten bei einem der kaiserlichen Kommandos Auskunft erhalten, an welche die Meldungen zum freiwilligen Eintritt zu richten sind. Sie finden dieselben aufgezählt in einem für alle Berufsfragen vortrefflich ausgerüsteten Büchlein A. Dregers, „Die Berufswahl im Staatsdienste“ (3. Auflage, 1889, Leipzig, C. A. Kochs Verlagsbuchhandlung), S. 36.
J. G., Dortmund. Im Königreich Sachsen wird bereits seit dem Jahre 1882 die Zauckeroder Grubenbahn, 700 m lang, mit einer elektrischen Lokomotive betrieben. Die Neu-Staßfurter Grubenbahn, 1100 m lang, besteht seit 1883 und wird mit zwei elektrischen Lokomotiven befahren. Schlesien hat ebenfalls seit 1883 die 1800 m lange Hohenzollern-Grubenbahn mit 3 elektrischen Lokomotiven. Auch auf der Kohlengrube Thallern an der Donau findet elektrischer Fährbetrieb statt.
K. in Hamburg. Ein Gespräch mittels der Stadtfernsprecher kostet im Deutschen Reiche den Anschlußbesitzer durchschnittlich etwa 4 Pfennige. Nach der Statistik vom 31. März 1889 bestanden in 176 Orten Stadtfernsprecheinrichtungen mit 33460 Fernsprechstellen und es wurden täglich 486636 Gespräche geführt. Jede Stelle führte sonach täglich ungefähr 15 Gespräche. In Hamburg fand verhältnißmäßig die stärkste Benutzung statt, indem dort auf eine Stelle durchschnittlich 22 tägliche Gespräche kamen.
Lehrer B, Pr. Eylau. Ein Steigen der Flugbahn eines abgefeuerten Geschosses über die „Seelenachse“ giebt es nicht. Das Geschoß fliegt zunächst in der Richtung der Seelenachse vorwärts; sofort aber macht sich die Anziehungskraft der Erde geltend und zieht das Geschoß von der Richtung der Seelenachse weg nach abwärts. Dagegen findet ein Steigen der Flugbahn über die Visirlinie statt, worüber Sie näheres in jedem militärischen Instruktionsbuche finden können.
A. M. in L. Der Titel des Buches läßt sich ohne Verfasserangabe nicht feststellen.
J. M. in Neu-Ulm. Der § 89 Ziff. 6b der Deutschen Wehrordnung bestimmt: „Von dem Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung zum einjährig–freiwilligen Dienst dürfen durch die Ersatzbehörden dritter Instanz (in Bayern eines der beiden Generalkommandos mit einem Civilkommissar) entbunden werden: … kunstverständige oder mechanische Arbeiter, welche in der Art ihrer Thätigkeit Hervorragendes leisten. Personen, welche auf eine derartige Berücksichtigung Anspruch machen, haben ihrer Meldung (bei der Prüfungskommission ihres Bezirks) die erforderlichen, amtlich beglaubigten Zeugnisse beizufügen. Dieselben sind nur einer Prüfung in den Elementarkenntnissen zu unterwerfen, nach deren Ausfall die Ersatzbehörde dritter Instanz entscheidet, ob der Berechtigungsschein zu ertheilen ist oder nicht.“
Fr. G. in Graz. Ihrem Patriotismus alle Anerkennung! Doch ist Ihre Einsendung aus Gründen der Form zur Veröffentlichung nicht geeignet.
In unserem Verlage ist erschienen und durch beinahe alle Buchhandlungen zu beziehen:
Inhalt: I. Glückliche Kinderzeit (1797–1806). II. Frühe Leidensjahre (1806–1810). III. Die Tage der Vorbereitung u. Erhebung (1810–1813). IV. Während der Befreiungskriege (1813–1815). V. Wanderjahre des Prinzen Wilhelm, (1815–1840). VI. Prinz von Preußen (1840–1858). VII. Prinzregent (1858–1860). VIII. König von Preußen (1861–1871). IX. Oberhaupt des Norddeutschen Bundes (1867–1870). X. Deutscher Bundesfeldherr (1870–1871). XI. Deutscher Kaiser (1871–1888). XII. Kaiser Wilhels Tod (9. März 1888).
Ernst Scherenberg bietet in seinem Gedenkbuche dem deutschen Volk ein mit warmer Begeisterung geschriebenes Lebensbild des großen Monarchen, welches sich aber bei aller Herzenswärme von schwülstigen Auswüchsen durchaus freihält. Schlichte Wahrheitsliebe und verständnißvolle Darstellungsweise machen das Buch zu einem wahren Volksbuche.
Vorräthig in den meisten Buchhandlungen. Wo der Bezug auf Hindernisse stößt, wende man sich unter Beifügung des Betrags in Briefmarken direkt an die
- ↑ Dort hielt seine Braut sich auf.
- ↑ Reuter ist mit seiner Frau verreist gewesen und ist zunächst allein zurückgekehrt.
- ↑ Es war in der That ein Korb mit Eßwaren und anderen Dingen von Thalborg für die Wirthschaft angekommen.
- ↑ Geschirr, das den Pferden zum Ziehen aufgelegt wird; „in den Sielen“ bildlich für „in Arbeit“.
- ↑ Vorname von Frau Peters.
- ↑ Peters hatte ein Buch über landwirthschaftlichen Betrieb herausgegeben, das sehr starken Absatz fand.
- ↑ Klaus Groth, der Fritz Reuter bekanntlich angegriffen hatte.
- ↑ H., ein Gutsnachbar Peters’.
- ↑ Burschikoser Ausdruck für geistige Fähigkeiten.
- ↑ Siedenbollentin – kurz Bollentin genannt – ein Gut bei Treptow, das Peters gekauft hatte und wohin er 1859 von Thalberg übergesiedelt war.
- ↑ Folgt eine lange Auszählung von zum Theil weit bekannten Personen.
- ↑ Pfarrer in dem mecklenburgischen Dorfe Schwanbeck, nicht weit von Treptow. Es giebt noch eine Anzahl von Reuter ausgeführter Porträts aus den vierziger Jahren. Reuter zeichnete gern und hatte vielleicht Anlage zu einem guten Maler, hat es aber aus Mangel an Schulung nicht sehr weit gebracht.
- ↑ Wo Reuter den ersten Theil seiner Festungshaft verbüßte.
- ↑ Reuter wünschte solche Mittheilungen. Er empfand es, seit er nicht mehr im Gebiet der plattdeutschen Sprache lebte, als einen Uebelstand, daß ihm so manche kleine drollige Schnurren und Redensarten entgingen, die er in seiner „Stromtid“ hätte verwerthen können.
- ↑ Der schon mehrfach erwähnte Gutsnachbar von Peters.
- ↑ Die „Stromtid“.
- ↑ Kränken.
- ↑ Pathenkind. Reuter hatte bei Peters’ jüngstem Kinde zu Gevatter gestanden.
- ↑ Die Romanfigur in der Stromtid.
- ↑ Verdrehung des Wortes „Influenza“.
- ↑ Wasserheilanstalt bei Koblenz, in der Reuter sich längere Zeit aufhielt.
- ↑ Reuters Geburtstag war um 7. November.
- ↑ Docent in Bonn, Sohn von Reuters Freund Justizrath Schröder in Treptow.
- ↑ Mit diesem Gewehre wurden die Versuche von Prof. Bruns angestellt; zur Vergleichung der Wirkung wurden Parallelversuche mit dem deutschen Infanteriegewehr 71.84 von 11 mm Kaliber ausgeführt.