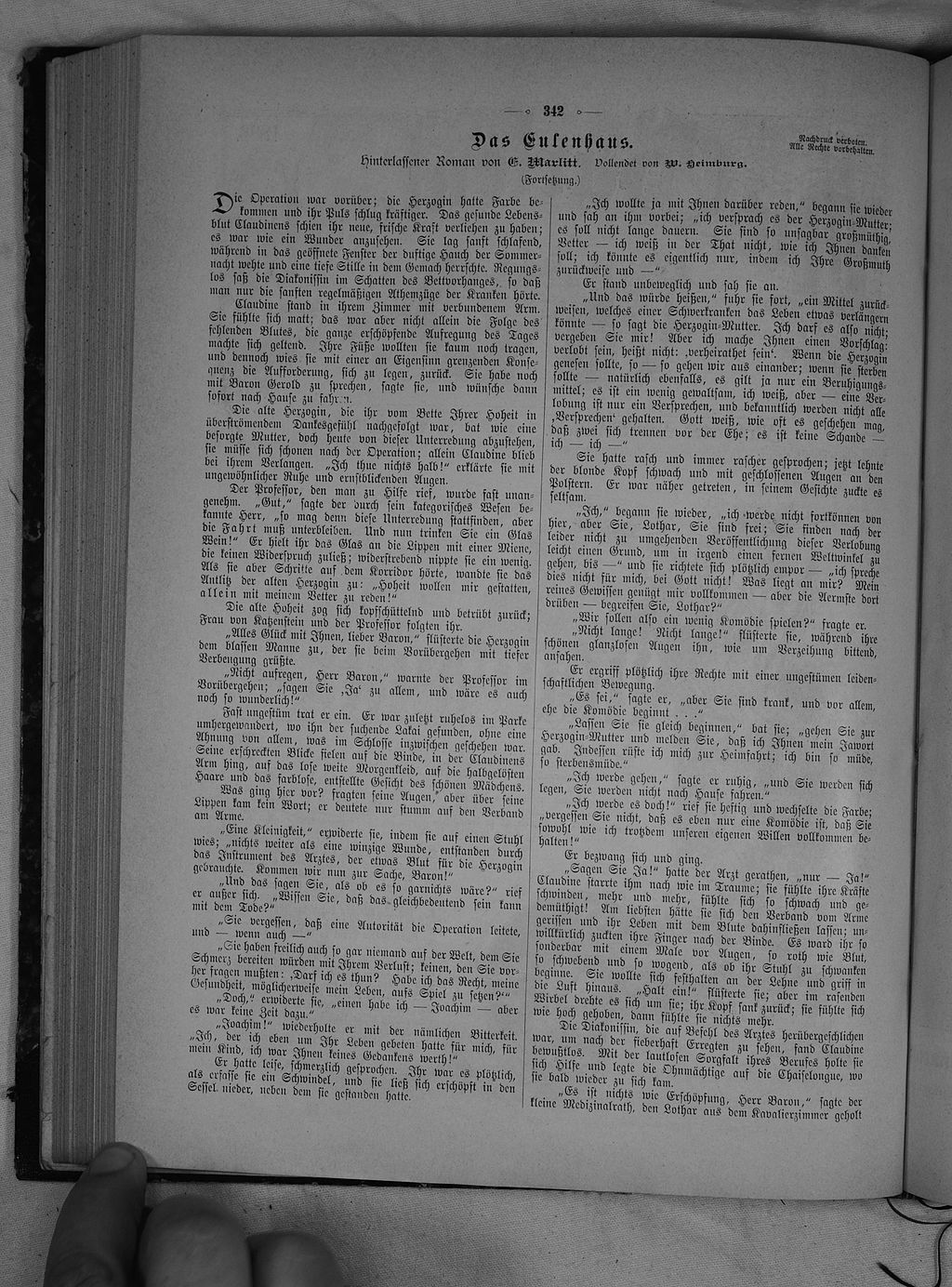| Verschiedene: Die Gartenlaube (1888) | |
|
|
Alle Rechte vorbehalten.
Die Operation war vorüber; die Herzogin hatte Farbe bekommen und ihr Puls schlug kräftiger. Das gesunde Lebensblut Claudinens schien ihr neue, frische Kraft verliehen zu haben; es war wie ein Wunder anzusehen. Sie lag sanft schlafend, während in das geöffnete Fenster der duftige Hauch der Sommernacht wehte und eine tiefe Stille in dem Gemach herrschte. Regungslos saß die Diakonissin im Schatten des Bettvorhanges, so daß man nur die sanften regelmäßigen Athemzüge der Kranken hörte.
Claudine stand in ihrem Zimmer mit verbundenem Arm. Sie fühlte sich matt; das war aber nicht allein die Folge des fehlenden Blutes, die ganze erschöpfende Aufregung des Tages machte sich geltend. Ihre Füße wollten sie kaum noch tragen, und dennoch wies sie mit einer an Eigensinn grenzenden Konsequenz die Aufforderung, sich zu legen, zurück. Sie habe noch mit Baron Gerold zu sprechen, sagte sie, und wünsche dann sofort nach Hause zu fahren.
Die alte Herzogin, die ihr vom Bette Ihrer Hoheit in überströmendem Dankesgefühl nachgefolgt war, bat wie eine besorgte Mutter, doch heute von dieser Unterredung abzustehen, sie müsse sich schonen nach der Operation; allein Claudine blieb bei ihrem Verlangen. „Ich thue nichts halb!“ erklärte sie mit ungewöhnlicher Ruhe und ernstblickenden Augen.
Der Professor, den man zu Hilfe rief, wurde fast unangenehm. „Gut,“ sagte der durch sein kategorisches Wesen bekannte Herr, „so mag denn diese Unterredung stattfinden, aber die Fahrt muß unterbleiben. Und nun trinken Sie ein Glas Wein!“ Er hielt ihr das Glas an die Lippen mit einer Miene, die keinen Widerspruch zuließ; widerstrebend nippte sie ein wenig. Als sie aber Schritte auf dem Korridor hörte, wandte sie das Antlitz der alten Herzogin zu. „Hoheit wollen mir gestatten, allein mit meinem Vetter zu reden!“
Die alte Hoheit zog sich kopfschüttelnd und betrübt zurück; Frau von Katzenstein und der Professor folgten ihr.
„Alles Glück mit Ihnen, lieber Baron“ flüsterte die Herzogin dem blassen Manne zu, der sie beim Vorübergehen mit tiefer Verbeugung grüßte.
„Nicht aufregen, Herr Baron,“ warnte der Professor im Vorübergehen; „sagen Sie ‚Ja‘ zu allem, und wäre es auch noch so wunderlich!“
Fast ungestüm trat er ein. Er war zuletzt ruhelos im Parke umhergewandert, wo ihn der suchende Lakai gefunden, ohne eine Ahnung von allem, was im Schlosse inzwischen geschehen war. Seine erschreckten Blicke fielen auf die Binde, in der Claudinens Arm hing, auf das lose weite Morgenkleid, auf die halbgelösten Haare und das farblose, entstellte Gesicht des schönen Mädchens.
Was ging hier vor? fragten seine Augen, aber über seine Lippen kam kein Wort; er deutete nur stumm auf den Verband am Arme.
„Eine Kleinigkeit,“ erwiderte sie, indem sie auf einen Stuhl wies; „nichts weiter als eine winzige Wunde, entstanden durch das Instrument des Arztes, der etwas Blut für die Herzogin gebrauchte. Kommen wir nun zur Sache, Baron!“
„Und das sagen Sie, als ob es so garnichts wäre?“ rief er außer sich. „Wissen Sie, daß das gleichbedeutend sein kann mit dem Tode?“
„Sie vergessen, daß eine Autorität die Operation leitete, und – wenn auch –“
„Sie haben freilich auch so gar niemand auf der Welt, dem Sie Schmerz bereiten würden mit Ihrem Verlust; keinen, den Sie vorher fragen mußten: ‚Darf ich es thun? Habe ich das Recht, meine Gesundheit, möglicherweise mein Leben, aufs Spiel zu setzen?‘“
„Doch,“ erwiderte sie, „einen habe ich – Joachim – aber es war keine Zeit dazu.“
„Joachim!“ wiederholte er mit der nämlichen Bitterkeit. „Ich, der ich eben um Ihr Leben gebeten hatte für mich, für mein Kind, ich war Ihnen keines Gedankens werth!“
Er hatte leise, schmerzlich gesprochen. Ihr war es plötzlich, als erfasse sie ein Schwindel, und sie ließ sich erschöpft in den Sessel nieder, neben dem sie gestanden hatte.
„Ich wollte ja mit Ihnen darüber reden,“ begann sie wieder und sah an ihm vorbei; „ich versprach es der Herzogin-Mutter; es soll nicht lange dauern. Sie sind so unsagbar großmüthig, Vetter – ich weiß in der That nicht, wie ich Ihnen danken soll; ich könnte es eigentlich nur, indem ich Ihre Großmuth zurückweise und –“
Er stand unbeweglich und sah sie an.
„Und das würde heißen,“ fuhr sie sort, „ein Mittel zurückweisen, welches einer Schwerkranken das Leben etwas verlängern könnte – so sagt die Herzogin-Mutter. Ich darf es also nicht; vergeben Sie mir! Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag: verlobt sein, heißt nicht: ‚verheirathet sein‘. Wenn die Herzogin genesen sollte, so – so gehen wir aus einander; wenn sie sterben sollte – natürlich ebenfalls, es gilt ja nur ein Beruhigungsmittel; es ist ein wenig gewaltsam, ich weiß, aber – eine Verlobung ist nur ein Versprechen, und bekanntlich werden nicht alle ‚Versprechen‘ gehalten. Gott weiß, wie oft es geschehen mag, daß zwei sich trennen vor der Ehe; es ist keine Schande – ich – ich –“
Sie hatte rasch und immer rascher gesprochen; jetzt lehnte der blonde Kopf schwach und mit geschlossenen Augen an den Polstern. Er war näher getreten, in seinem Gesichte zuckte es seltsam.
„Ich,“ begann sie wieder, „ich werde nicht fortkönnen von hier, aber Sie, Lothar, Sie sind frei; Sie finden nach der leider nicht zu umgehenden Veröffentlichung dieser Verlobung leicht einen Grund, um in irgend einen fernen Weltwinkel zu gehen, bis –“ und sie richtete sich plötzlich empor – „ich spreche dies nicht für mich, bei Gott nicht! Was liegt an mir? Mein reines Gewissen genügt mir vollkommen – aber die Aermste dort drüben – begreifen Sie, Lothar?“
„Wir sollen also ein wenig Komödie spielen?“ fragte er.
„Nicht lange! Nicht lange!“ flüsterte sie, während ihre schönen glanzlosen Augen ihn, wie um Verzeihung bittend, ansahen.
Er ergriff plötzlich ihre Rechte mit einer ungestümen leidenschaftlichen Bewegung.
„Es sei,“ sagte er, „aber Sie sind krank, und vor allem, ehe die Komödie beginnt ...“
„Lassen Sie sie gleich beginnen,“ bat sie; „gehen Sie zur Herzogin-Mutter und melden Sie, daß ich Ihnen mein Jawort gab. Indessen rüste ich mich zur Heimfahrt; ich bin so müde, so sterbensmüde.“
„Ich werde gehen“ sagte er ruhig, „und Sie werden sich legen, Sie werden nicht nach Hause fahren.“
„Ich werde es doch!“ rief sie heftig und wechselte die Farbe; „vergessen Sie nicht, daß es eben nur eine Komödie ist, daß sie sowohl wie ich trotzdem unseren eigenen Willen vollkommen behalten!“
Er bezwang sich und ging.
„Sagen Sie Ja!“ hatte der Arzt gerathen, „nur – Ja!“ Claudine starrte ihm nach wie im Traume; sie fühlte ihre Kräfte schwinden, mehr und mehr, fühlte sich so schwach und gedemüthigt! Am liebsten hätte sie sich den Verband vom Arme gerissen und ihr Leben mit dem Blute dahinfließen lassen; unwillkürlich zuckten ihre Finger nach der Binde. Es ward ihr so sonderbar mit einem Male vor Augen, so roth wie Blut, so schwebend und so wogend, als ob ihr Stuhl zu schwanken beginne. Sie wollte sich festhalten an der Lehne und griff in die Luft hinaus. „Halt ein!“ flüsterte sie; aber im rasenden Wirbel drehte es sich um sie; ihr Kopf sank zurück; sie fühlte sich wie hoch gehoben, dann fühlte sie nichts mehr.
Die Diakonissin, die auf Befehl des Arztes herübergeschlichen war, um nach der fieberhaft Erregten zu sehen, fand Claudine bewußtlos. Mit der lautlosen Sorgfalt ihres Berufes holte sie sich Hilfe und legte die Ohnmächtige auf die Chaiselongue, wo sie bald wieder zu sich kam.
„Es ist nichts wie Erschöpfung, Herr Baron,“ sagte der kleine Medizinalrath, den Lothar aus dem Kavalierzimmer geholt
Verschiedene: Die Gartenlaube (1888). Leipzig: Ernst Keil, 1888, Seite 342. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1888)_342.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2016)