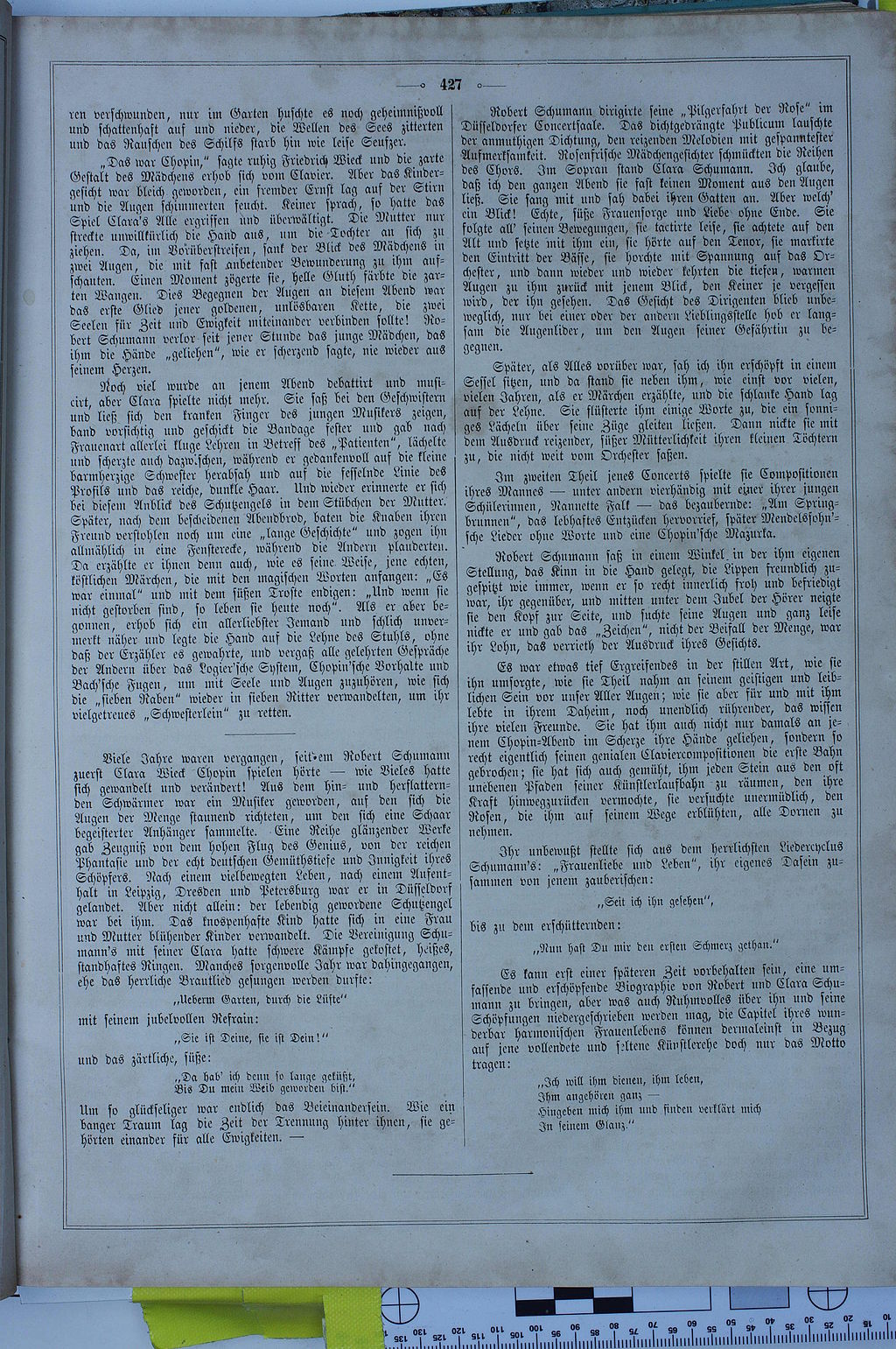| verschiedene: Die Gartenlaube (1866) | |
|
|
verschwunden, nur im Garten huschte es noch geheimnißvoll und schattenhaft auf und nieder, die Wellen des Sees zitterten und das Rauschen des Schilfs starb hin wie leise Seufzer.
„Das war Chopin,“ sagte ruhig Friedrich Wieck und die zarte Gestalt des Mädchens erhob sich vom Clavier. Aber das Kindergesicht war bleich geworden, ein fremder Ernst lag auf der Stirn und die Augen schimmerten feucht. Keiner sprach, so hatte das Spiel Clara’s Alle ergriffen und überwältigt. Die Mutter nur streckte unwillkürlich die Hand aus, um die Tochter an sich zu ziehen. Da, im Vorüberstreifen, sank der Blick des Mädchens in zwei Augen, die mit fast anbetender Bewunderung zu ihm aufschauten. Einen Moment zögerte sie, helle Gluth färbte die zarten Wangen. Dies Begegnen der Augen an diesem Abend war das erste Glied jener goldenen, unlösbaren Kette, die zwei Seelen für Zeit und Ewigkeit miteinander verbinden sollte! Robert Schumann verlor seit jener Stunde das junge Mädchen, das ihm die Hände „geliehen“, wie er scherzend sagte, nie wieder aus seinem Herzen.
Noch viel wurde an jenem Abend debattirt und musicirt, aber Clara spielte nicht mehr. Sie saß bei den Geschwistern und ließ sich den kranken Finger des jungen Musikers zeigen, band vorsichtig und geschickt die Bandage fester und gab nach Frauenart allerlei kluge Lehren in Betreff des „Patienten“, lächelte und scherzte auch dazwischen, während er gedankenvoll auf die kleine barmherzige Schwester herabsah und auf die fesselnde Linie des Profils und das reiche, dunkle Haar. Und wieder erinnerte er sich bei diesem Anblick des Schutzengels in dem Stübchen der Mutter. Später, nach dem bescheidenen Abendbrod, baten die Knaben ihren Freund verstohlen noch um eine „lange Geschichte“ und zogen ihn allmählich in eine Fensterecke, während die Andern plauderten. Da erzählte er ihnen denn auch, wie es seine Weise, jene echten, köstlichen Märchen, die mit den magischen Worten anfangen: „Es war einmal“ und mit dem süßen Troste endigen: „Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch“. Als er aber begonnen, erhob sich ein allerliebster Jemand und schlich unvermerkt näher und legte die Hand auf die Lehne des Stuhls, ohne daß der Erzähler es gewahrte, und vergaß alle gelehrten Gespräche der Andern über das Logier’sche System, Chopin’sche Vorhalte und Bach’sche Fugen, um mit Seele und Augen zuzuhören, wie sich die „sieben Raben“ wieder in sieben Ritter verwandelten, um ihr vielgetreues „Schwesterlein“ zu retten.
Viele Jahre waren vergangen, seitdem Robert Schumann zuerst Clara Wieck Chopin spielen hörte – wie Vieles hatte sich gewandelt und verändert! Aus dem hin- und herflatternden Schwärmer war ein Musiker geworden, auf den sich die Augen der Menge staunend richteten, um den sich eine Schaar begeisterter Anhänger sammelte. Eine Reihe glänzender Werke gab Zeugniß von dem hohen Flug des Genius, von der reichen Phantasie und der echt deutschen Gemüthstiefe und Innigkeit ihres Schöpfers. Nach einem vielbewegten Leben, nach einem Aufenthalt in Leipzig, Dresden und Petersburg war er in Düsseldorf gelandet. Aber nicht allein: der lebendig gewordene Schutzengel war bei ihm. Das knospenhafte Kind hatte sich in eine Frau und Mutter blühender Kinder verwandelt. Die Vereinigung Schumann’s mit seiner Clara hatte schwere Kämpfe gekostet, heißes, standhaftes Ringen. Manches sorgenvolle Jahr war dahingegangen, ehe das herrliche Brautlied gesungen werden durfte:
mit seinem jubelvollen Refrain:
„Sie ist Deine, sie ist Dein!“
und das zärtliche, süße:
„Da hab’ ich denn so lange geküßt,
Bis Du mein Weib geworden bist.“
Um so glückseliger war endlich das Beieinandersein. Wie ein banger Traum lag die Zeit der Trennung hinter ihnen, sie gehörten einander für alle Ewigkeiten. –
Robert Schumann dirigirte seine „Pilgerfahrt der Rose“ im Düsseldorfer Concertsaale. Das dichtgedrängte Publicum lauschte der anmuthigen Dichtung, den reizenden Melodien mit gespanntester Aufmerksamkeit. Rosenfrische Mädchengesichter schmückten die Reihen des Chors. Im Sopran stand Clara Schumann. Ich glaube, daß ich den ganzen Abend sie fast keinen Moment aus den Augen ließ. Sie sang mit und sah dabei ihren Gatten an. Aber welch’ ein Blick! Echte, süße Frauensorge und Liebe ohne Ende. Sie folgte all’ seinen Bewegungen, sie tactirte leise, sie achtete auf den Alt und setzte mit ihm ein, sie hörte auf den Tenor, sie markirte den Eintritt der Bässe, sie horchte mit Spannung auf das Orchester, und dann wieder und wieder kehrten die tiefen, warmen Augen zu ihm zurück mit jenem Blick, den Keiner je vergessen wird, der ihn gesehen. Das Gesicht des Dirigenten blieb unbeweglich, nur bei einer oder der andern Lieblingsstelle hob er langsam die Augenlider, um den Augen seiner Gefährtin zu begegnen.
Später, als Alles vorüber war, sah ich ihn erschöpft in einem Sessel sitzen, und da stand sie neben ihm, wie einst vor vielen, vielen Jahren, als er Märchen erzählte, und die schlanke Hand lag auf der Lehne. Sie flüsterte ihm einige Worte zu, die ein sonniges Lächeln über seine Züge gleiten ließen. Dann nickte sie mit dem Ausdruck reizender, süßer Mütterlichkeit ihren kleinen Töchtern zu, die nicht weit vom Orchester saßen.
Im zweiten Theil jenes Concerts spielte sie Compositionen ihres Mannes – unter andern vierhändig mit einer ihrer jungen Schülerinnen, Nannette Falk – das bezaubernde: „Am Springbrunnen“, das lebhaftes Entzücken hervorrief, später Mendelssohn’sche Lieder ohne Worte und eine Chopin’sche Mazurka.
Robert Schumann saß in einem Winkel in der ihm eigenen Stellung, das Kinn in die Hand gelegt, die Lippen freundlich zugespitzt wie immer, wenn er so recht innerlich froh und befriedigt war, ihr gegenüber, und mitten unter dem Jubel der Hörer neigte sie den Kopf zur Seite, und suchte seine Augen und ganz leise nickte er und gab das „Zeichen“, nicht der Beifall der Menge, war ihr Lohn, das verrieth der Ausdruck ihres Gesichts.
Es war etwas tief Ergreifendes in der stillen Art, wie sie ihn umsorgte, wie sie Theil nahm an seinem geistigen und leiblichen Sein vor unser Aller Augen; wie sie aber für und mit ihm lebte in ihrem Daheim, noch unendlich rührender, das wissen ihre vielen Freunde. Sie hat ihm auch nicht nur damals an jenem Chopin-Abend im Scherze ihre Hände geliehen, sondern so recht eigentlich seinen genialen Claviercompositionen die erste Bahn gebrochen; sie hat sich auch gemüht, ihm jeden Stein aus den oft unebenen Pfaden seiner Künstlerlaufbahn zu räumen, den ihre Kraft hinwegzurücken vermochte, sie versuchte unermüdlich, den Rosen, die ihm auf seinem Wege erblühten, alle Dornen zu nehmen.
Ihr unbewußt stellte sich aus dem herrlichsten Liedercyclus Schumann’s: „Frauenliebe und Leben“, ihr eigenes Dasein zusammen von jenem zauberischen:
„Seit ich ihn gesehen“,
bis zu dem erschütternden:
„Nun hast Du mir den ersten Schmerz gethan.“
Es kann erst einer späteren Zeit vorbehalten sein, eine umfassende und erschöpfende Biographie von Robert und Clara Schumann zu bringen, aber was auch Ruhmvolles über ihn und seine Schöpfungen niedergeschrieben werden mag, die Capitel ihres wunderbar harmonischen Frauenlebens können dermaleinst in Bezug auf jene vollendete und seltene Künstlerehe doch nur das Motto tragen:
„Ich will ihm dienen, ihm leben,
Ihm angehören ganz –
Hingeben mich ihm und finden verklärt mich
In seinem Glanz.“
verschiedene: Die Gartenlaube (1866). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1866, Seite 427. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1866)_427.jpg&oldid=- (Version vom 4.8.2020)