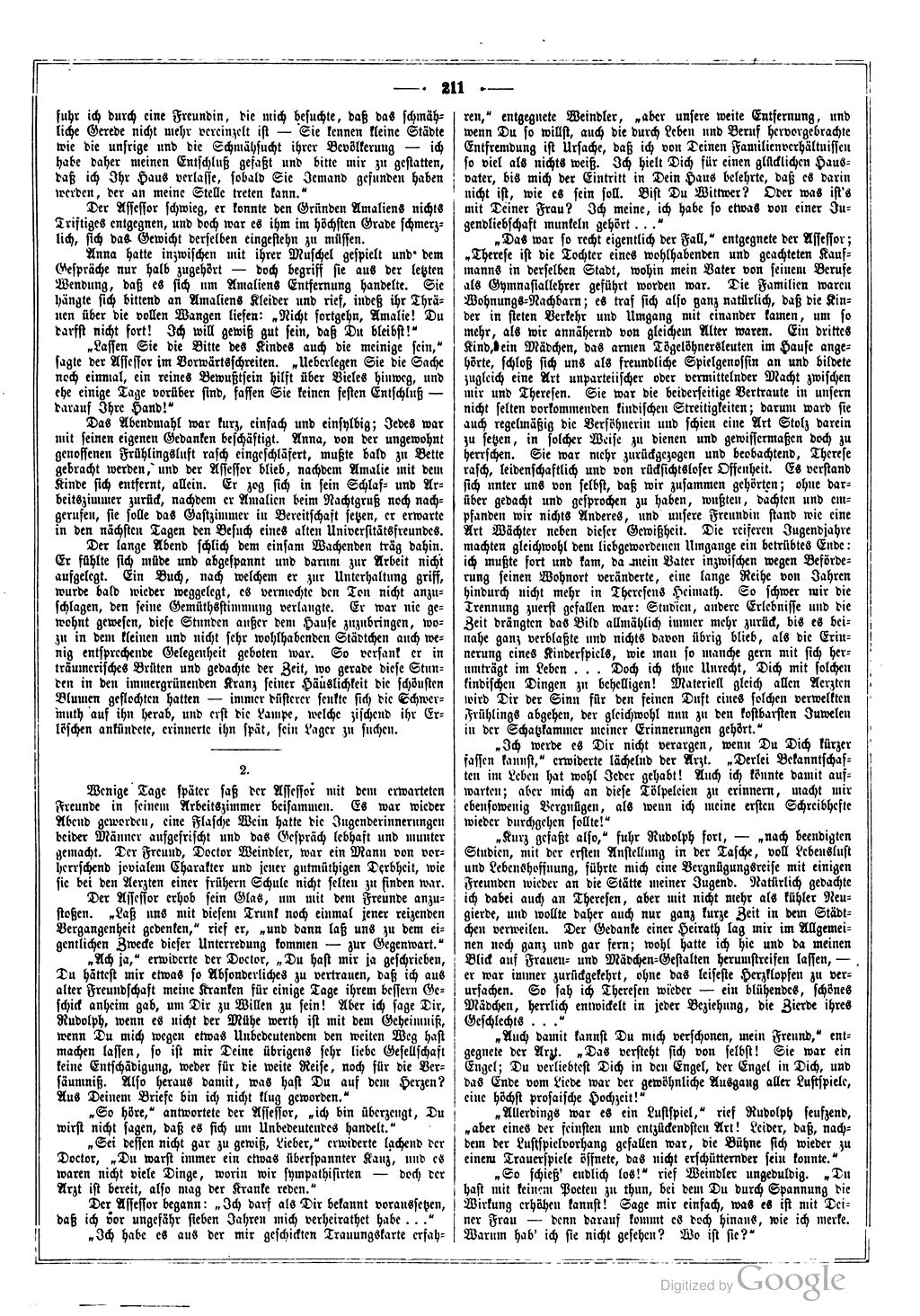| verschiedene: Die Gartenlaube (1860) | |
|
|
ich durch eine Freundin, die mich besuchte, daß das schmähliche Gerede nicht mehr vereinzelt ist – Sie kennen kleine Städte wie die unsrige und die Schmähsucht ihrer Bevölkerung – ich habe daher meinen Entschluß gefaßt und bitte mir zu gestatten, daß ich Ihr Haus verlasse, sobald Sie Jemand gefunden haben werden, der an meine Stelle treten kann.“
Der Assessor schwieg, er konnte den Gründen Amaliens nichts Triftiges entgegnen, und doch war es ihm im höchsten Grade schmerzlich, sich das Gewicht derselben eingestehn zu müssen.
Anna hatte inzwischen mit ihrer Muschel gespielt und dem Gespräche nur halb zugehört – doch begriff sie aus der letzten Wendung, daß es sich um Amaliens Entfernung handelte. Sie hängte sich bittend an Amaliens Kleider und rief, indeß ihr Thränen über die vollen Wangen liefen: „Nicht fortgehn, Amalie! Du darfst nicht fort! Ich will gewiß gut sein, daß Du bleibst!“
„Lassen Sie die Bitte des Kindes auch die meinige sein,“ sagte der Assessor im Vorwärtsschreiten. „Ueberlegen Sie die Sache noch einmal, ein reines Bewußtsein hilft über Vieles hinweg, und ehe einige Tage vorüber sind, fassen Sie keinen festen Entschluß – darauf Ihre Hand!“
Das Abendmahl war kurz, einfach und einsylbig; Jedes war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Anna, von der ungewohnt genossenen Frühlingsluft rasch eingeschläfert, mußte bald zu Bette gebracht werden, und der Assessor blieb, nachdem Amalie mit dem Kinde sich entfernt, allein. Er zog sich in sein Schlaf- und Arbeitszimmer zurück, nachdem er Amalien beim Nachtgruß noch nachgerufen, sie solle das Gastzimmer in Bereitschaft setzen, er erwarte in den nächsten Tagen den Besuch eines alten Universitätsfreundes.
Der lange Abend schlich dem einsam Wachenden träg dahin. Er fühlte sich müde und abgespannt und darum zur Arbeit nicht aufgelegt. Ein Buch, nach welchem er zur Unterhaltung griff, wurde bald wieder weggelegt, es vermochte den Ton nicht anzuschlagen, den seine Gemüthsstimmung verlangte. Er war nie gewohnt gewesen, diese Stunden außer dem Hause zuzubringen, wozu in dem kleinen und nicht sehr wohlhabenden Städtchen auch wenig entsprechende Gelegenheit geboten war. So versank er in träumerisches Brüten und gedachte der Zeit, wo gerade diese Stunden in den immergrünenden Kranz seiner Häuslichkeit die schönsten Blumen geflochten hatten – immer düsterer senkte sich die Schwermuth auf ihn herab, und erst die Lampe, welche zischend ihr Erlöschen ankündete, erinnerte ihn spät, sein Lager zu suchen.
Wenige Tage später saß der Assessor mit dem erwarteten Freunde in seinem Arbeitszimmer beisammen. Es war wieder Abend geworden, eine Flasche Wein hatte die Jugenderinnerungen beider Männer aufgefrischt und das Gespräch lebhaft und munter gemacht. Der Freund, Doctor Weindler, war ein Mann von vorherrschend jovialem Charakter und jener gutmüthigen Derbheit, wie sie bei den Aerzten einer frühern Schule nicht selten zu finden war.
Der Assessor erhob sein Glas, um mit dem Freunde anzustoßen. „Laß uns mit diesem Trunk noch einmal jener reizenden Vergangenheit gedenken,“ rief er, „und dann laß uns zu dem eigentlichen Zwecke dieser Unterredung kommen – zur Gegenwart.“
„Ach ja,“ erwiderte der Doctor, „Du hast mir ja geschrieben, Du hättest mir etwas so Absonderliches zu vertrauen, daß ich aus alter Freundschaft meine Kranken für einige Tage ihrem bessern Geschick anheim gab, um Dir zu Willen zu sein! Aber ich sage Dir, Rudolph, wenn es nicht der Mühe werth ist mit dem Geheimniß, wenn Du mich wegen etwas Unbedeutendem den weiten Weg hast machen lassen, so ist mir Deine übrigens sehr liebe Gesellschaft keine Entschädigung, weder für die weite Reise, noch für die Versäumniß. Also heraus damit, was hast Du auf dem Herzen? Aus Deinem Briefe bin ich nicht klug geworden.“
„So höre,“ antwortete der Assessor, „ich bin überzeugt, Du wirst nicht sagen, daß es sich um Unbedeutendes handelt.“
„Sei dessen nicht gar zu gewiß, Lieber,“ erwiderte lachend der Doctor, „Du warst immer ein etwas überspannter Kauz, und es waren nicht viele Dinge, worin wir sympathisirten – doch der Arzt ist bereit, also mag der Kranke reden.“
Der Assessor begann: „Ich darf als Dir bekannt voraussetzen, daß ich vor ungefähr sieben Jahren mich verheirathet habe …“
„Ich habe es aus der mir geschickten Trauungskarte erfahren,“ entgegnete Weindler, „aber unsere weite Entfernung, und wenn Du so willst, auch die durch Leben und Beruf hervorgebrachte Entfremdung ist Ursache, daß ich von Deinen Familienverhältnissen so viel als nichts weiß. Ich hielt Dich für einen glücklichen Hausvater, bis mich der Eintritt in Dein Haus belehrte, daß es darin nicht ist, wie es sein soll. Bist Du Wittwer? Oder was ist’s mit Deiner Frau? Ich meine, ich habe so etwas von einer Jugendliebschaft munkeln gehört …“
„Das war so recht eigentlich der Fall,“ entgegnete der Assessor; „Therese ist die Tochter eines wohlhabenden und geachteten Kaufmanns in derselben Stadt, wohin mein Vater von seinem Berufe als Gymnasiallehrer geführt worden war. Die Familien waren Wohnungs-Nachbarn; es traf sich also ganz natürlich, daß die Kinder in steten Verkehr und Umgang mit einander kamen, um so mehr, als wir annähernd von gleichem Alter waren. Ein drittes Kind, ein Mädchen, das armen Tagelöhnersleuten im Hause angehörte, schloß sich uns als freundliche Spielgenossin an und bildete zugleich eine Art unparteiischer oder vermittelnder Macht zwischen mir und Theresen. Sie war die beiderseitige Vertraute in unsern nicht selten vorkommenden kindischen Streitigkeiten; darum ward sie auch regelmäßig die Versöhnerin und schien eine Art Stolz darein zu setzen, in solcher Weise zu dienen und gewissermaßen doch zu herrschen. Sie war mehr zurückgezogen und beobachtend, Therese rasch, leidenschaftlich und von rücksichtsloser Offenheit. Es verstand sich unter uns von selbst, daß wir zusammen gehörten; ohne darüber gedacht und gesprochen zu haben, wußten, dachten und empfanden wir nichts Anderes, und unsere Freundin stand wie eine Art Wächter neben dieser Gewißheit. Die reiferen Jugendjahre machten gleichwohl dem liebgewordenen Umgange ein betrübtes Ende: ich mußte fort und kam, da mein Vater inzwischen wegen Beförderung seinen Wohnort veränderte, eine lange Reihe von Jahren hindurch nicht mehr in Theresens Heimath. So schwer mir die Trennung zuerst gefallen war: Studien, andere Erlebnisse und die Zeit drängten das Bild allmählich immer mehr zurück, bis es beinahe ganz verblaßte und nichts davon übrig blieb, als die Erinnerung eines Kinderspiels, wie man so manche gern mit sich herumträgt im Leben … Doch ich thue Unrecht, Dich mit solchen kindischen Dingen zu behelligen! Materiell gleich allen Aerzten wird Dir der Sinn für den feinen Duft eines solchen verwelkten Frühlings abgehen, der gleichwohl nun zu den kostbarsten Juwelen in der Schatzkammer meiner Erinnerungen gehört.“
„Ich werde es Dir nicht verargen, wenn Du Dich kürzer fassen kannst,“ erwiderte lächelnd der Arzt. „Derlei Bekanntschaften im Leben hat wohl Jeder gehabt! Auch ich könnte damit aufwarten; aber mich an diese Tölpeleien zu erinnern, macht mir ebensowenig Vergnügen, als wenn ich meine ersten Schreibhefte wieder durchgehen sollte!“
„Kurz gefaßt also,“ fuhr Rudolph fort, – „nach beendigten Studien, mit der ersten Anstellung in der Tasche, voll Lebenslust und Lebenshoffnung, führte mich eine Vergnügungsreise mit einigen Freunden wieder an die Stätte meiner Jugend. Natürlich gedachte ich dabei auch an Theresen, aber mit nicht mehr als kühler Neugierde, und wollte daher auch nur ganz kurze Zeit in dem Städtchen verweilen. Der Gedanke einer Heirath lag mir im Allgemeinen noch ganz und gar fern; wohl hatte ich hie und da meinen Blick auf Frauen- und Mädchen-Gestalten herumstreifen lassen, – er war immer zurückgekehrt, ohne das leiseste Herzklopfen zu verursachen. So sah ich Theresen wieder – ein blühendes, schönes Mädchen, herrlich entwickelt in jeder Beziehung, die Zierde ihres Geschlechts …“
„Auch damit kannst Du mich verschonen, mein Freund,“ entgegnete der Arzt. „Das versteht sich von selbst! Sie war ein Engel; Du verliebtest Dich in den Engel, der Engel in Dich, und das Ende vom Liede war der gewöhnliche Ausgang aller Lustspiele, eine höchst prosaische Hochzeit!“
„Allerdings war es ein Lustspiel,“ rief Rudolph seufzend, „aber eines der feinsten und entzückendsten Art! Leider, daß, nachdem der Lustspielvorhang gefallen war, die Bühne sich wieder zu einem Trauerspiele öffnete, das nicht erschütternder sein konnte.“
„So schieß’ endlich los!“ rief Weindler ungeduldig. „Du hast mit keinem Poeten zu thun, bei dem Du durch Spannung die Wirkung erhöhen kannst! Sage mir einfach, was es ist mit Deiner Frau – denn darauf kommt es doch hinaus, wie ich merke. Warum hab’ ich sie nicht gesehen? Wo ist sie?“
verschiedene: Die Gartenlaube (1860). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1860, Seite 211. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1860)_211.jpg&oldid=- (Version vom 20.8.2021)