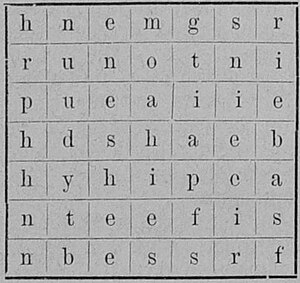Die Gartenlaube (1892)/Heft 23
[709]
| Halbheft 23. | 1892. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Jahrgang 1892. Erscheint in Halbheften à 25 Pf. alle 12–14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3–4 Wochen vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Julia ging nicht getröstet von Therese Krautner heim; sie
wäre am liebsten zornig auf die Freundin geworden und
schalt sich selbst darüber aus. Aber ihre Stimmung ward nicht
besser. Leise wie ein Dieb schlüpfte sie hinauf in den einzigen
Winkel, der ihr eigen gehörte, das kleine Stübchen unter dem
Dache. Es war ganz finster hier, allein sie fand doch den
alten Lehnstuhl und kauerte sich fröstelnd hinein. Unverdrossen
troff der Regen hernieder; sie hörte deutlich das Rieseln und
Glucksen des Wassers auf den Ziegeln über sich, aber das Dach
war gut und fest, es ließ kein Tröpfchen durch. Hier war sie
geborgen, hier konnte sie sich ungestört den finsteren trotzigen
Gedanken überlassen, die ihre Seele mit scharfen Krallen packten,
so daß sie selbst erschrak vor der Menschenverachtung und der
ätzenden Bitterkeit, die sie erfüllte und die durch keine süße Erinnerung,
durch keine Hoffnung auf späteres Glück zu bannen
war. Monatelang hatte diese Hoffnung geholfen, ihr die öde
Gegenwart zu erhellen, heute vermochte ihr Herz auch nicht an
ein bißchen Glück mehr zu glauben. Sie saß da, mit geballten
[710] Händen, ganz versunken in ihr Elend, und plötzlich entrang sich ein Schluchzen ihrer Brust.
Da sprach eine Stimme: „Um Gotteswilten, Unnütz, was soll’s denn, daß Du hier sitzt? Du mußt Dich ja auf den Tod erkälten.“
„Mich friert nie!“ sagte sie trotzig.
„Unnütz, ich glaube Dir vieles, aber das nicht,“ antwortete der Doktor gutmüthig. „Weißt Du, daß ich eine Viertelstunde bei Tante Riekchen auf Dich gewartet habe? Ich wollte Dich gern sprechen, ehe ich fortgehe – aber wer nicht kam, warst Du. Endlich fällt mir dieses sogenannte Atelier ein. Himmel, wo bist Du denn eigentlich? Gieb mir die Hand und führe mich hinunter, es ist ja eine tolle Temperatur hier oben.“
Er hatte tastend ihre Hand erfaßt, und nun zog er ihren Arm unter den seinigen. „Komm,“ sagte er, „führe mich, ich weiß hier nicht Bescheid im Finstern.“
„Was willst Du von mir?“ fragte sie, und ihre Stimme hatte einen spröden eisigen Klang.
„Mein Gott, so komm’ doch erst – ich will Dir’s auf dem Weg erzählen; viel Zeit habe ich nicht, Kind, ich will – ich muß auf – –“
„Ach ja, auf den Ball! Verzeih’ ich vergaß,“ und sie zog ihre Hand zurück.
„Ich soll wohl den Hals brechen, weil Du mich losläßt?“
„O nein!“ Und unter ihren Fingern sprühte ein Streichholz auf und entzündete ein Lichtstümpfchen in einer winzigen Laterne. „So, jetzt kannst Du sehen.“
Sie schritt, ihm leuchtend, aus dem Dachkämmerchen der Treppe zu. „Du wolltest mir in aller Eile noch etwas sagen?“ sprach sie, ohne sich umzuwenden.
„Hm – ja – um es kurz zu machen, ich wollte Dich fragen, ob Du wohl – ob es Dir nicht angenehm wäre, wenn ich Dich bitte, mir ein paar Stunden Deines Tages zu opfern, mir ein wenig zu helfen bei meiner Arbeit – kurz und bündig: ob Du während meiner Sprechstunden die Honneurs in meinem Wartezimmer machen möchtest. Es kommt vor, daß ich einmal nicht gleich da bin, daß Kranke ungeduldig werden, daß sich die Damen untereinander mit der Erzählung thörichter Krankheitsfälle aufregen, und so weiter. Da brauche ich ein freundliches Gesicht, ein taktvolles Wesen, ein mitleidiges Herz – und das alles hast Du, Unnütz, und deshalb wollte ich Dich fragen.“
Sie standen just auf dem Absatz der alten schmalen Bodentreppe, das Laternchen erhellte nur schwach den nächsten Umkreis, aber es genügte doch, dem Manne das glückselige Leuchten zweier dunkler Augen zu zeigen.
„O, wie gern!“ sagte sie, und auf dem lächelnden Antlitz war keine Spur von Traurigkeit mehr vorhanden.
„Guter kleiner Unnütz,“ murmelte er, gerührt von ihrer Bereitwilligkeit, „denk’ es Dir nicht zu schön!“
„Du glaubst nicht, wie ich mich darauf freue, Fritz, aber – die Tante! Ich muß ja kochen.“
„Ist schon alles in Ordnung, Julia; Tante wird sich wieder ein Mädchen nehmen.“
„Das geht nicht,“ rief das junge Mädchen ängstlich, „wirklich nicht, Fritz! Ach, Du weißt ja gar nicht wie – –“
„Ich weiß alles; bitte, frage nicht weiter, Kind! Also, Du willst mir helfen?“
„O Gott, freilich!“
„Dann komm’ morgen früh zu mir, aber etwas vor der Sprechstunde, damit ich Dir dieses und jenes noch sage. Und nun auf Wiedersehen, Unnütz! Schlaf’ süß!“
„Auf Wiedersehen!“ wiederholte sie kaum hörbar und sah ihm nach, während er eilig die Treppe hinunterschritt. Er hatte ihr nicht einmal die Hand gegeben, sie merkte es nicht; sie war zu glücklich, daß sie ihm helfen durfte. Was kümmerte sie noch der Ball, was Therese? Sie konnte arbeiten mit ihm, für ihn, das war doch etwas anderes als mit ihm zu tanzen!
Wie ein Vogel flog sie die Stufen hinab und in die Stube zu Tante Riekchen. „O wie gut Du bist, Tante,“ sagte sie innig und trat zu der alten Dame, die mit einem Strickstrumpf am Tische bei der Lampe saß, verdrießlicher noch als heute früh.
Fräulein Riekchen zuckte die Schultern. „Man muß ja wohl Unterstützungen annehmen,“ sagte sie bitter.
„Ach nein, Tante; ich meine, daß Du mir erlaubt hast, Fritz drunten zu helfen.“
„Na ja, das meine ich auch; oder glaubst Du, er will’s umsonst von Dir haben? Er hat mir genau gesagt, was Du monatlich von ihm bekommst.“
Das Mädchen war plötzlich bleich geworden bis in die Lippen. „Er will mir das bezahlen?“ fragte sie unsicher.
„Allerdings, und zwar recht anständig.“
„Das will ich aber nicht!“ stieß Julia empört hervor.
„Warum denn nicht, wenn ich fragen darf? Hast Du etwas zu verschenken? Ob der Herr Doktor, der just in die Mode gekommen ist und Dich als Empfangsdame engagiert, der Fritz ist oder ein anderer, das kann Dir doch wohl gleich sein!“
Auf Julias Gesicht wechselten jäh Röthe und Blässe. „Dann nimm Du das hin, was ich verdiene,“ sagte sie endlich hart, „und erzähl’ es mir nie, wann er es Dir giebt, und wieviel – ich mag’s nicht hören!“ Und sie wandte sich ab und ging aus der Stube. Sie – sie seine bezahlte Dienerin! Das hätt’ er ihr nicht zu bieten gewagt, wenn er sie wirklich liebte!
In stummer Qual rang sie die Hände; und so saß sie die halbe Nacht neben ihrem Bette in der kalt gewordenen Stube und versuchte ihr junges stolzes Herz zur Ruhe zu zwingen. Und dazwischen meinte sie Geigenklänge zu hören und silberdurchwirkte Gewänder zu sehen und ein leuchtendes Blondhaar, in dem ein Sternchen sprühte und funkelte. „Sie muß alles haben, was Mode ist,“ hatte Herr Alois Krautner gerufen. Nun, der Doktor Fritz Roettger war ja auch eben Mode – sagte nicht die Tante so?
„Guter kleiner Unnütz!“ klang es ihr im Walzertakt immer wieder vor den Ohren; seine hellen klaren Augen blickten aus dem Gewimmel der tanzenden Paare, das sie vor sich sah, zu ihr herüber – „Weißt Du es denn nicht, Unnütz, daß ich es gut mit Dir meine?“
„Ja,“ sprach sie halblaut, „ich weiß es, ich weiß es! Du warst bis jetzt der einzige Mensch, der gütig zu mir gewesen ist, und deshalb hängt meine Seele, mein Leben an Dir. Kränke mich nicht, um Gotteswillen, kränke mich nicht, es wär’ mein Tod! Ich kann es mir nicht vorstellen, daß es anders sein soll, daß Du mich nicht liebst! Großer Gott, laß es nicht zu, gieb ihm Liebe für mich ins Herz – er muß mich lieben, ich will nicht leben sonst!“
Das letzte klang wie ein erstickter Schrei. Aber hier war niemand, der ihn vernahm, und die Angst und Leidenschaft verhallten ungehört und unbeschwichtigt. –
Im strahlend hellen Tanzsaal der „Traube“ sammelte sich in dieser Stunde eine unglaubliche Menge von Cotillonorden auf dem schwarzen Frack des Herrn Doktors. Ja, er war mächtig in die Mode gekommen! Und ganz zuletzt schwebte eine lichte blaue blonde Fee zu ihm heran und brachte ihm lächelnden Gesichts den letzten Orden, er schlang den Arm um sie und flog mit ihr über das Parkett. Und neben der Frau Räthin, die mit stolzer Befriedigung dem Paare nachsah, schlug sich Herr Alois Krautner mit der Hand auf die Knie und lachte. „Schönes Paar, Frau Nachbarin, schönes Paar!“ rief er, „gewachsen sind sie wie die Thüringer Tannen!“ Und dann musterte er seine eigene verschrobene dicke Gestalt und seiner Nachbarin eckige Figur und stieß sacht mit dem Ellbogen an ihren Arm. „Wo sie’s nur her haben? Von uns beiden nicht, Frau Räthin, sicher nicht! Bums, da ist die Musik alle; haken Sie ein, Frau Räthin möcht’ die Ehre haben, Ihr Nachbar beim Kaffeetrinken zu sein.“
Und ihrem Fritz zulieb lächelte die Räthin über die wenig schmeichelhafte Offenherzigkeit des alten „Grobians“ und legte ihm würdevoll die Hand auf den Arm. –
Mitternacht war längst vorüber, als der Doktor mit seiner Mutter schweigend nach Hause ging. Daheim angelangt, steckte er die ganze Cotillonherrlichkeit in den Papierkorb; nur ein einziges Sternchen lag am andern Morgen auf seinem Schreibtisch just neben dem Briefpapier.
Und auf diesem Sterne hafteten die Augell von Mamsell Unnütz, die mit stolz erhobenem Kopf neben dem Doktor stand und ihre Instruktion als „Empfangsdame“ anhörte.
„Und nun vorwärts,“ schloß er fröhlich und nahm einen Augenblick ihre Rechte zwischen seine beiden Hände, „jetzt kommt unsere Arbeit, kleiner Kamerad!“
„Wahrhaftig, Unnütz, Du bist wie eigens geschaffen zu Deinem Amte,“ sagte einige Wochen später der junge Arzt zu Julia, als sie es fertig gebracht hatte, ein schreiendes Bübchen so [711] zu beruhigen, daß es sich widerstandslos und höchst muthig einen langen Splitter aus dem Fingerchen nehmen ließ, den es beim Hinfallen auf rauher Diele sich eingeschoben hatte. „Ich höre Dein Lob in allen Tonarten von Alten und Jungen und wenn ich etwas auszusetzen habe, so ist es nur das, daß Du, die andere so herzensfroh machen kann, dies bei Dir selbst nicht zustande bringst.“
„Soll ich mit mir selbst reden?“ antwortete sie leise lächelnd.
„Nein, das ist eine üble Angewohnheit, die nur ganz einsame und verbitterte Menschen an sich haben,“ erwiderte er.
„Nun, ich ertappe mich gegenwärtig zuweilen dabei,“ sagte sie wie zu sich selbst, und das eigenartige Lächeln huschte wieder um ihren Mund.
„Da haben wir’s, Unnütz! Du schließt Dich zu sehr ab; Du müßtest hinaus, unter frische Jugend!“
Sie hob die langen Wimpern und sah ihn an mit einem so wehen Ausdruck, daß ihm ganz weich zu Muthe wurde.
„Unnütz,“ sagte er eindringlicher als bisher, „weshalb gehst Du nicht mehr zu Therese? Ihr wart doch früher oft zusammen.“
„Was soll ich mit ihr reden? Wir haben gar nichts Gemeinsames, und das, was wir hatten – –“ sie verschluckte den Nachsatz.
„Aber dann komm’ doch abends zuweilen hier herunter, Mutter und ich sind oft allein.“
„Ich weiß nicht, ob ich darf.“
„Ich bitte Dich, Kind, sei nicht einfältig!“ antwortete er ärgerlich.
„Es ist vielleicht einfältig, Fritz; aber seitdem ich weiß, Du bezahlst mich für meine Hilfe, da würgt es mir an der Kehle, da ist es mir, als ob eine Schranke zwischen uns steht, so hoch!“ Sie reckte den Arm in die Höhe und stellte sich auf die Zehen.
Er sah sie groß an; sie stand vor ihm, blaß und mit zuckender Lippe. „Julia!“ sagte er bewegt und faßte ihre beiden Hände. „Ja, wie soll ich’s Dir denn nun klar machen? Komm’, sieh mich einmal an – glaubst Du, daß ich Dir habe wehthun wollen? Kennst Du mich denn noch nicht besser? Das einzige, was ich wollte, war, der Tante eine Hilfe zukommen zu lassen. Du weißt doch, wie sie ist! Sie hat einen unbeugsamen Hochmuth, trotz ihrer jämmerlichen Lage, und ich ehre diesen Hochmuth; ich glaube, ich wäre selbst nicht anders. Auf Dich aber hat das keinen Einfluß, Julia, und – daß ich Deine Hilfe gar nicht zu bezahlen vermöchte, selbst wenn ich wollte, das weißt Du. Wer in aller Welt könnte mir denn so zur Seite stehen, wie Du es jetzt thust? Etwa meine Mutter oder Tante Riekchen? Wahrhaftig, kleiner Unnütz, Du machst Dir da ganz thörichte Gedanken! Wenn es Dich beruhigt, so nimm getrost an, daß Dein sogenanntes Honorar eine fromme Lüge ist, daß Du mir einfach beistehst, die arme gequälte Frau da oben ein wenig zu betrügen, zu ihrem Besten. Auf irgend eine Weise würde ich sie doch unterstützen, ob Du mir hilfst oder nicht.“
„Ist’s wahr? Sage mir – ist’s wahr?“ fragte sie langsam.
„Was denn Kind?“
„Das, was Du eben sprachst, daß ich Dir wirklich helfe, daß es kein anderer kann?“
„Ja, Unnütz! Habe ich Dich jemals belogen?“
Er schüttelte die Hände, die sich ihm entzogen, um sich einen Augenblick vor ein erglühendes Antlitz zu legen.
„Dann ist’s gut, dann –“ Das andere verstand er nicht.
„O Du thörichtes, wunderliches Kind,“ sagte er. „Aber spricht da nicht die Mutter? Nun bist Du vernünftig, gelt? Leb’ wohl, Unnütz, grüble nicht mehr!“
„Nein,“ antwortete sie, „ich will nicht mehr darüber nachdenken, ich will alles glauben.“ Sie ging bis zur Thür, dort wandte sie noch einmal den schönen Kopf zurück und die dunklen Augen blitzten zu ihm hinüber. „Jetzt möcht’ ich mich selbst auslachen,“ sagte sie, „hätte ich Dich nur gleich gefragt, Fritz!“
Er öffnete die Augen weit. Es lag etwas in dem Blicke des seltsamen Geschöpfes, das ihn wie ein Vorwurf berührte, das ihn gemahnte an einen Frühlingsnachmittag droben im Dachstübchen, wo er diesen schön geschwungenen Mund geküßt hatte, heiß und lange. Er starrte noch die Thür an, als sie längst gegangen war. „Nein, das ist lächerlich! Wie eine Schwester liebt sie mich – Dummheiten! Ich habe doch heute rein gar nichts gesagt, was . . .“
Und nach einigen Augenblicken brannte er sich eine Cigarre an, begann an einem wissenschaftlichen Bericht über nervöse Herzgeräusche zu arbeiten und hatte vorläufig alle Mädchenaugen der Welt vergessen. –
Als Julia in den Flur trat, rief ihr die Räthin entgegen: „Mein Gott, was habt Ihr denn zu schwatzen? Der letzte Kranke ist ja schon eine Ewigkeit weg, und Du solltest mir doch helfen, die Pelze auszupacken, draußen schneit’s. Schon längst hätt’s geschehett müssen!“ Und sie öffnete, ohne das glühende Gesicht Julias zu bemerken, eine nach dem Gärten gelegene schmale Kammer, in der Kleiderschränke und Truhen an weiß getünchten Wänden standen. Dort erschloß sie einen alten Eichenkasten, aus dem sich alsbald ein durchdringender Geruch von Kampher und Naphthalin, vermischt mit dem von Pfeffer, entwickelte.
„Hör’ ’mal,“ begann sie, indem sie neben Julia vor der Truhe kniete, „merkst Du eigentlich gar nichts?“
„Was?“ fragte das Mädchen und hielt den ungeheuren Iltismuff der Räthin einen Augenblick unbeweglich empor.
„Na!“ Die alte Dame zwinkerte vertraulich mit den Augen. „Ich meine, wer denn nun endlich der Auserwählte von Thereschen sein wird? Erzählt sie Dir gar nichts?“
„Gar nichts, Tante,“ antwortete Julia.
„Das liegt an Dir,“ meinte die Räthin verdrießlich und schlug ihren Pelzkragen so heftig gegen die Truhe, daß eine wahre Wolke von Pfeffer herausstäubte . . . „Hazi! – Was können Dich auch Liebesgeschichtett – hazi! – interessieren?“
„Gott helf’ Dir, Tantchen!“ sagte Julia, und ihr ernstes Antlitz überflog ein schelmisches Lächeln.
„Zu meiner Zeil war’s anders – hazi! – Großer Gott, es ist ja schrecklich, dieses Niesen! Wenn wir Mädchen allemal zusammenkamen, redeten wir von nichts anderem. Du könntest aber wohl ’mal das Gespräch drauf bringen, zum Beispiel wenn ich nächstens den großen Kaffee geb’ – verstehst Du? Denn geben muß ich ihn und zwar bald. Da legt Ihr Mädchett Karten und dreht Euch die Buben, und wenn sie roth wird bei einem, dann ist er’s – hazi!“
„Gott helf’ Dir, Tante!“
„Den Kaffee geb’ ich, ehe die Krautners abreisen. Du weißt wohl gar nicht, daß der alte Dickkopf hustet – vorgestern haben sie ja den Fritz holen lassen. Das Thereschen behauptet, ihr Vater müsse durchaus nach dem Süden, je eher, je lieber – na, das Geld haben sie ja. Sollt’ mir nur leid thun, wenn das Mädchen so einen Reisebräutigam mitbringen würd’; da unten in Monte Carlo, da läuft Gott weiß was für Mannsvolk umher, das Jagd macht auf reiche Erbinnen – ich weiß das noch von damals, als in Wiesbaden Roulette war – und hernach giebt’s ein Elend.“
„Nein, Tante, die bringt sich keinen Bräutigam mit,“ sagte Julia im Tone felsenfester Ueberzeugung.
„Gelt?“ stimmte die Räthin beruhigt zu. „Sie ist zu klug, weißt Du!“ Und die alte Dame rutschte ein bißchen näher zu Mamsell Unnütz hin und flüsterte ihr mit nie vorher dagewesener Vertrauensseligkeit in das kleine rosige Ohr: „Weißt Du, ich glaub’, der Fritz und das Thereschen sehen sich ganz gern und – Himmel, was ist denn da zu lachen, Du dummes Ding?“
Mamsell Unnütz hatte wirklich gelacht, so herzlich, hell und jauchzend, daß der Schall davon noch an der kahlen Decke hinlief. Und nun wurde sie roth. „O Gott, Tante, verzeih’ mir,“ bat sie.
Die ärgerliche Frau beruhigte sich brummend.
„Tantchen, ich will auch die Buben drehen!“ gelobte Mamsell Unnütz jetzt mit ernsthaftem Gesichtsausdruck, obgleich ihr innerlich noch das helle glückselige Lachen durch die Seele scholl. O mein Gott, wenn die alte Dame wüßte, was sie wußte, daß das Thereschen längst gewählt, und daß der Doktor – der Doktor –
„Recht so – und Du mußt mir auch sonst helfen bei der Kaffeevisit’!“
„Gern, Tante.“
„Und das Riekchen muß mir ihre Kaffeelöffelchen borgen, sonst, bei der Menge Damen – ich lad’ all’ die Mädchen mit ein – hat man zur Creme wieder großes Aufwaschen.“
Unnütz ward blaß. „Ach, die Löffel – ja weißt Du denn nicht?“
„Was soll ich denn wissen? Die sind doch nicht etwa gar nimmer da?“
„Ich weiß nicht – ich glaube –“
Die Frau Räthin bekam einen zornrothen Kopf. „Verkauft oder versetzt?“ schrie sie.
„Ich glaube, verkauft,“ stotterte das junge Mädchen.
„Na, da hört doch alles auf!“ rief die Räthin erbost und erhob sich. „Großer Gott, wenn das die Eltern selig wüßten,
[712][713] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [714] im Grabe fänden sie keine Ruh’ – und alles für Euch beide, die Ihr hier hereingeschneit seid ohne einen Funken von Zugehörigkeit, nur weil das verliebte Frauenzimmer da droben einmal Euren Herrn Vater hat heirathen wollen! Das ganze schöne Vermögen, das von Gottes und Rechts wegen dem Fritz gehört, es ist zum Kuckuck, verjubelt und verlumpt durch den Herrn Lieutenant Adami! Daß ich doch durchgesetzt hätt’, was ich gewollt, und hätt’ diese schwache Person da oben in eine Anstalt bringen lassen!“
Das junge Mädchen lehnte bleich an dem Thürpfosten. Sie fand diesem Ausbruch des Hasses gegenüber kein Wort; aber instinktmäßig wandte sie sich zur Flucht, als die erboste Frau den Truhendeckel zuwarf, daß es wie ein Kanonenschlag durch das Haus dröhnte, und aufs neue ihre Stimme erhob. „Und Du – Du unnützes Ding, Du –“
Julia war im Flur, sie wußte selbst nicht wie, sie wußte nicht, wie sie in den dunklen Winkel kam auf das Bänkchen jenseit der Treppe, wo sie schon als Kind in ohnmächtigem Zorne die kleinen Hände geballt hatte. Auch heute bebte sie am ganzen Körper, und dann wollte ihr das Herz stille stehen, als die Thür des Doktors aufgerissen wurde und seine eiligen Schritte über die Steinfliesen hallten.
„Liebster Himmel, was ist denn geschehen?“
Sonst pflegte Frau Minna zu verstummen, wenn er erschien, aber der Verlust des Familiensilbers hatte sie zur rasenden Löwin gemacht. Sie berichtete in den höchsten, fast kreischenden Tönen die entsetzliche Thatsache, daß die schweren silbernen Kaffeelöffel mit dem Wappell der Mutter, einer geborenen „Von“, der ganze Stolz der Trautmanns, verloren seien, und das nur wegen dieser – dieser hergelaufenen –
„Bitte, beruhige Dich, Mutter, das ist noch kein Grund, sich derartig aufzuregen.“ Die Stimme des Sohnes hatte einen so eisigen Klang, daß die hohe Temperatur der alten Dame genau so rasch sank, als wäre sie in eins der kühlen Bäder getaucht worden, durch die er die Fieberhitze seiner Kranken herabzumindern verstand.
Die Räthin setzte sich auf die Truhe und begann zu schluchzen. „Du nimmst alles so leicht,“ jammerte sie. „denkst nie an die Zukunft; es ist doch wahrlich nicht gleichgültig, wenn man eines Tages eine solche Last ganz und gar aufgepackt bekommt.“
„Welche Last?“
„Nun – Riekchen und die Julia. Mit dem Riekchen ging’s ja noch, sie ist auch meine Schwester – aber, die Julia, die –“
„Beunruhige Dich nicht, sie wird Dir nie zur Last sein.“
„So?“ Frau Rath hatte aufgehört zu weinen, und dieses „So?“ war schon wieder auf kriegerischen Ton gestimmt. „Wie denkst Du Dir denn ihre Zukunft?“ forschte sie.
„Nun, mein Gott, warum soll sie nicht ebensogut dereinst eine glückliche Frau werden wie tausend andere Mädchen auch?“
Ein spöttisches Lachen der alten Dame begleitete seine Antwort. „Da wär’ ich neugierig, den kennenzulernen, der so dumm ist und die nimmt! Ebensowenig, wie Du sie nimmst, nimmt sie ein anderer, meinst nicht? oder hast Du vielleicht Absichten?“
Die Schelle der Hausthür erklang jetzt und schnitt die Antwort des Doktors jäh ab.
Julia saß ungesehen in ihrem Winkel; mit pochendem Herzen lehnte sie ihren schwindelnden Kopf gegen die braune Holzwand der Treppe. Sie hörte, ohne es recht zu fassen, daß der Arzt zu einem Kranken gerufen wurde, eilig, sehr eilig, gleich darauf rasche Schritte, seine Schritte, die das Haus verließen; dann war alles still. Da erhob auch sie sich, stolz lächelnd und doch den Kopf gesenkt, und so ging sie die Treppe hinauf in das Wohnzimmer zu Tante Riekchen.
Die alte Dame stand mitten in der Stube, zitternd und blaß. „Was war denn unten wieder für ein unangenehmer Auftritt? Ich hörte Minnas Stimme bis hier herauf.“
„Unangenehm?“ fragte Julia und schüttelte wie verwundert den Kopf.
Tante Riekchen seufzte erleichtert. Des Mädchens bleiches Antlitz sah ja so zufrieden aus, daß in der That nichts von Belang geschehen sein konnte. Julia aber ging ab und zu und besorgte ihre kleinen Obliegenheiten wie im Traume. – –
Der feierliche Tag, an dem die Räthin ihre Kaffeegesellschaft geben wollte, war angebrochen. Ein ganz unglaublicher Aufruhr hatte im Hause geherrscht, bis gegen vier Uhr endlich Ruhe eintrat. Der Doktor hatte gleich nach der Sprechstunde Reißaus genommen; in seinen beiden Stuben befand sich ohnehin kaum noch ein Stuhl. Im Flur vermischte sich der Duft des feinen Kaffees mit dem des Räucherpapiers, das Frau Rath zu festlichen Gelegenheiten wahrhaft verschwendete. Die alte große Laterne unter der Decke, die eine moderne Petroleumlampe beherbergte, war angezündet; Luischen und das kleine Dienstmädchen von Fräulein Riekchen prangten in frisch gebügelten steif gestärkten weißen Schürzen, und in den beiden Stuben der Räthin brannten Lampen und Lichter.
Frau Minna selbst ging noch einmal musternd aus einem in das andere Gemach, strich über die weißen Damasttücher, betrachtete mit Stolz die silberne Zuckerdose und Rahmkanne auf dem Tische vor dem Sofa der guten Stube und freute sich über ihre Gummibäume, Pflanzen, die sie zärtlich liebte und deren Blätter sie heute mit ein wenig Gänsefett abgerieben hatte. Sie glänzten auch wie frisch lackiert; dieser Kunstgriff war ein Geheimniß, das sie sorgsam hütete, so oft sie auch gefragt wurde, wie sie es nur mache, daß die Blätter gar so frisch und üppig aussähen.
Mamsell Unnütz, die von der Tante wieder in Gnaden angenommen war, erschien eben in zierlicher weißer Schürze, um als Haustochter die Honneurs in der Vorderstube zu machen, wo die jungen Mädchen ihren Kaffee trinken sollten.
„Und daß Du die Tassen nicht so voll schenkst!“ hielt die Räthin für nöthig zu erinnern, „und daß Luischen einmal bei der Bürgermeisterin und das andere Mal bei der Frau Direktorin zu präsentieren anfängt. Riekchen ist natürlich, eigensinnig wie immer, oben sitzen geblieben?“
„Ja; sie meint, sie kenne doch all’ die Leute nicht, und sie fühlt sich auch nicht wohl; sie ist in so trüber Stimmung.“
„An Gründen hat’s ihr noch nie gefehlt,“ erklärte die Tante. „Ihr Goldsohn wird ja wohl noch am Leben sein, wenn er auch nicht schreibt,“ murmelte sie ärgerlich. „Da klingelt’s übrigens – sind die Mädchen auf dem Posten?“
Mamsell Unnütz beeilte sich, den ersten Ankömmling zu empfangen, aber als sie auf den Flur trat, war es nicht ein Gast, der eingetreten war, sondern der Briefbote, der Julia für die Tante droben ein Schreiben übergab. Sie betrachtete es seufzend; es war wieder nicht vom Frieder, und die alte Dame wartete gar so schmerzlich auf Nachricht von ihm, der schon seit Wochen schwieg. Sie barg den Brief in der Tasche, er kam noch früh genug vor die Augen der vergrämten Tante. Es war die schon zum siebenten Mal gesandte Rechnung eines großen Wäschegeschäftes in Berlin, bei dem der Herr Lieutenant sich die wunderbarste Ausstattung an Weißzeug bestellt hatte, die jemals ein junger eleganter Offizier besessen.
Ach, war das eine schwüle Atmosphäre da droben, in der das junge Mädchen jetzt athmen mußte! Was nur die Phantasie eines einsamen, verbitterten Menschen ersinnen konnte, das ersann die alte Frau in ihrer Sorge um den einzigen Menschen, an dem in dieser Welt ihr Herz noch hing. Bald sah sie den vergötterten Pflegesohn krank im Lazareth; bald, und das war ihr die schrecklichste Vorstellung, sah sie ihn aus Verzweiflung leichtsinnig werden, ein ausschweifendes Leben führen, und dann schlug sie die Hände vor das Gesicht und flehte Gott an, sie das nicht mehr erleben zu lassen. Zweimal hatte sie eingeschriebene Briefe an ihn geschickt, gestern früh mit bezahlter Rückantwort telegraphiert, ob er krank oder gesund sei – aber Frieder schwieg.
Und Julia schiffte, so gut es ging, über dieses trübe Wasser, ihr Lebensschifflein, das kleine armselige Ding, mit bescheidenen Rosen umkränzend und das Steuer einem goldenen herrlichen Landungsplatz zulenkend, und sie verlor den Muth nicht, obgleich das Ziel noch immer nicht näherrücken wollte. Sie redete immer und immer wieder der alten Dame Trost zu und ertrug Vorwürfe und Schelte mit Gelassenheit. Am liebsten hätte sie gesagt: „Um Frieders Zukunft laß Dir nicht bangen, er ist ja Therese Krautners heimlicher Bräutigam!“ Aber es war ihr streng verboten, zu reden – wer weiß, welches Unheil sie damit angestiftet hätte. Und so konnte sie nichts weiter thun, als auch ihrerseits an ihn schreiben und ihn inständig bitten, er möge doch endlich Nachricht geben.
Sie wollte sich eben in das Zimmer zurückwenden, da klingelte es abermals, und im hellen pelzverbrämten Abendmantel, das rosige Antlitz von einer weißen Kapuze umschlossen, trat mit dem Schlag vier Uhr – der für die Kaffeegesellschaft festgesetzten Stunde – Thereschen ein.
[715] Julia begrüßte sie und führte sie in das Schlafzimmer der Räthin, wo die Damen ablegen sollten und dort entpuppte sich der reizende Gast so elegant wie stets; heute in einem dunkelgrünen, mit schmalen Goldlitzen verzierten Tuchkleid.
Auf einmal kam es Julia in den Sinn, sie wolle Therese nach dem Bruder fragen, und sie flüsterte zaghaft. „Ach, sag’ Therese, wie geht es Frieder? Hast Du Nachricht von ihm?“
„Warum?“ war die kurze Gegenfrage. Und nach einer Weile setzte Therese hinzu, indem sie die Löckchen zurecht zupfte: „Ich weiß es übrigens thatsächlich nicht.“ Dann nahm sie den kleinen goldgestickten „Pompadour“ und schickte sich an, den Raum zu verlassen.
Julia konnte ihr nicht folgen, es kamen andere Damen, immer mehr Damen, und als sie endlich die Zimmer betrat, in denen das Gesumme eines Bienenschwarms herrschte, sah sie Therese im Kreise der jungen Mädchen wohlverschanzt auf dem Sofa und fand keine Möglichkeit, ohne Zeugen mit ihr zu reden.
Die jungen Andersheimerinnen waren ungeheuer guter Dinge, während sie eifrig, als gelte es, das tägliche Brot zu verdienen, an ihren Weihnachtsarbeiten stichelten. Bloß Therese hielt ihre Häkelnadel wie zum Spiele in der Hand, während sie aufmerksam den Neuigkeiten lauschte, die von Mund zu Mund flogen. Den Augen, den bittenden fragenden Augen der Mamsell Unnütz, wichen ihre Blicke aus; nur wenn Julia durch das Zimmer schritt, musterte sie nachdenklich die tannenschlanke biegsame Gestalt in dem schmuckloden Kaschmirkleid, das noch von der Konfirmation her das kostbarste Stück in Julias Garderobe ausmachte.
„Hübsch ist sie aber doch,“ sagte Theresens Nachbarin, eine frische Brünette mit hellbraunen Augen, „ich hab’ irgendwo so ein Gesicht gemalt gesehen, wenn ich nur wüßt’, ob in Frankfurt oder Berlin. Ein Mädchen, einen Henkelkrug auf dem Kopfe tragend, und genau so stolze und doch weiche Züge wie die ihrigen. Die Augen sind doch herrlich!“
„Ich weiß nicht,“ erwiderte Therese, „mich läßt diese Art Schönheit kalt, wenn das überhaupt Schönheit ist. Sie ist nicht mein Genre.“
Die andere lächelte gutmüthig. „Möcht’ wissen,“ neckte sie, „ob der Doktor Roettger auch so über sie denkt wie Du, Thereschen; wenn ich er wäre, ich hätt’ mich bis über die Ohren in sie verliebt.“
Therese Krautner zuckte die Achseln. „Leicht möglich!“
Die junge Dame machte ein schelmisches Gesicht. Sie war die einzige Braut in diesem Kreise und erfuhr von ihrem Verlobten allerhand Neuigkeiten, konnte sich auch erlauben, so recht mit vollen Backen die Lobposaune zu blasen für den Doktor Roettger. „Uebrigens habt Ihr sammt und sonders dem armen Menschen auf dem Kasinoball schrecklich die Cour gemacht,“ schloß sie eine längere Rede; „und wer von Euch da ’mal die Auserwählte wird, die ist nicht zu beneiden, insofern meine ich, als sie aus der Eifersucht nicht viel herauskommen wird.“
Thereschen sah die Sprecherin höchst geringschätzig an. „Ich wüßte nicht –“ begann sie.
„O, Du warst auch so, Du hast ihm auch mit der größten Lust einen Orden zugeschleppt!“
Therese wurde einer Antwort überhoben, draußen war die Glocke erklungen, und nun tönte die Stimme des Doktors bis hier herein. „Ich bitte um die Lampe.“ Er war doch früher heimgekehrt. – Und dann wieder hörte man ganz deutlich die Worte: „Bitten Sie Fräulein Julia einen Augenblick zu mir herüber.“
Mamsell Unnütz, die gerade bescheiden ihren Stuhl in den Kreis der jungen Mädchen geschoben hatte, erhob sich sofort und schritt zur Thür; da war es ihr, als zwinge sie etwas, nach Therese hinüberzuschauen, und als sie, schon die Klinke in der Hand, den Kopf wandte, sah sie ein blasses Gesicht mit fest zusammengepreßten Lippen und mit Augen, aus denen ein geradezu feindseliges Leuchten zu ihr herüberflammte. Sie erwiderte mit einem verwunderten Blicke und ging dann. Was, ums Himmelswillen, hatte diese Therese in letzter Zeit so verwandelt?
Als sie drüben eingetreten war, kam der Doktor hastig auf sie zu. „Sag’, Julia, habt Ihr Nachrichten von Frieder?“
„Nein!“ antwortete sie.
„Dann ist er selbst gekommen; ich kann mich täuschen, aber ich möchte wetten, daß er in der Bahnhofstraße an mir vorüberging.“
„O bewahre, Fritz, er kommt ja erst zu Weihnacht, und bis da sind es noch drei Wochen.“
„Ich kann mich ja auch irren, Kind, wollte es Dir aber doch auf alle Fälle mittheilen. Und wenn es nun doch so wäre, Unnütz – hast Du eine Ahnung, was ihn hertreibt?“
Sie wurde purpurroth und schwieg.
„Besitzt Du sein Vertrauen?“ fragte er weiter.
„Ja, Fritz.“
„Nun, Kind, wenn Du einigen Einfluß auf ihn hast, dann sorge, daß die arme Frau dort oben nicht neuen Aufregungen ausgesetzt wird; es wäre nicht nur vergeblich, da sie nicht mehr helfen kann – ihr körperlicher Zustand erträgt auch nicht mehr viel.“
Sie hatte den Kopf gesenkt. „Steht es so schlimm?“ fragte sie gepreßt.
Aber noch ehe er antworten konnte, erscholl vom Vorzimmer her die Stimme der Frau Räthin in jammernden Tönen, Rufe der Theilnahme flogen dazwischen, die Thür wurde aufgerissen, und auf der Schwelle stand die Räthin, den einen Arm um die Gestalt Therese Krautners geschlungen. Das junge Mädchen sah blaß und schmerzverzerrt aus; sie hatte sich aus unbegreiflicher Ungeschicklichkeit den Häkelhaken in die Hand gestoßen.
Der Doktor war erschreckt hinzugetreten und führte die Verletzte zu einem Sessel. Die Räthin wimmerte, als ob sie die Schmerzen ausstehen müsse, eine andere alte Dame rief etwas von Starrkrampf, und eine dritte schlug vor, den Vater zu holen, bis der Arzt sie alle ersuchte, miteinander das Zimmer zu verlassen; Julia war schon hinausgeeilt, um ein Becken kaltes Wasser zu besorgen.
Als sie damit zurückkehrte, blieb sie einen Augenblick an der Thür stehen, und vor ihren Augen wirbelte es, wie wenn Nebel ineinander quirlen. Der Haken war entfernt, aber Theresens Kopf lehnte wie bewußtlos an der Schulter ihres Helfers und zwei große Thränen rannen über die erblaßten Wangen.
Er legte das blonde Haupt beim Eintritt Julias behutsam gegen die Polster zurück; er trocknete auch nicht die Thränen, wie er es einst gutmüthig bei Mamsell Unnütz gethan; er ging im Zimmer umher mit einem unsäglich peinlichen Gesichtsausdruck, wie ihn Menschen haben, die den Schmerz, den sie anderen verursachen müssen, selbst doppelt fühlen. Julia kannte ihn gar nicht so, so empfindsam und wehleidig, so außer sich wegen einer „Bagatelle“, tvie er anderen gegenüber derartiges genannt hätte.
„Es that wohl sehr weh?“ fragte sie theilnehmend.
„Nun natürlich!“ erwiderte er, ihr das Becken abnehmend und das Wasser darin auf einem Tischchen mit Karbol mischend. „Bitte, besorge etwas weiche Leinwand – Du weißt, draußen in dem Schranke rechts!“
Sie ging gehorsam, und als sie wiederkam, war die rosige Farbe in die Wangen Theresens zurückgekehrt, und die kleine Hand, die Fritz selbst in das Wasser hielt, so zart, als sei sie aus Sevresporzellan, zitterte nicht mehr. Nachher beim Verbinden hielt Julia diese Hand; zum ersten Male bekam sie einen Verweis: „Aber Unnütz, ich bitte Dich – nicht so grob!“
„Was that ich denn?“ fragte sie und sah zu ihm auf.
„Du hältst den Arm so fest, sieh doch die beiden hochrothen Flecken!“
„Ach, sei nicht böse!“ stammelte sie erschreckt.
„Julchen,“ bat Therese, „hole mir meine Sachen, ich möchte nach Hause!“
„Ich werde Sie hinüber geleiten,“ sagte der Doktor eifrig. Und er nahm nicht einmal den Ueberzieher, nur die Pelzmütze setzte er auf. Trotzdem standen die beiden noch eine Weile plaudernd vor der Thür von Theresens Vaterhaus. Einmal lachte dabei das junge Mädchen hell auf; so recht herzlich und silbern scholl es in den finsteren Garten hinein. Sie mußte sich wieder völlig wohl fühlen.
„Gute Nacht,“ sagte Therese beim Abschied, „ich hoffe, Sie sehen morgen als pflichtgetreuer Arzt nach Ihrer schwersten Patientin.“
„Ganz gewiß – gute Nacht, Fräulein Therese!“
Sie hielt ihm die Rechte hin. „Gute Nacht, Herr Doktor!“
In dem schwachen Schimmer der Laterne, die auf elegantem gußeisernen Kandelaber an der Freitreppe stand, sah ihr süßes Kindergesicht so freundlich zu ihm empor, und ein so gewinnendes unschuldiges Lächeln umspielte ihren Mund, daß er, dem jede übertriebene Galanterie fernlag, sich hinunter bog und ihre Hand ehrerbietig und andächtig küßte. Dann wandte er sich rasch um und stieg die Treppe hinunter.
Therese öffnete haftig die Hausthür und huschte mit leisen Schritten über den Flur in ihr Zimmer. Dort riß sie mit der [716] unverletzten Rechten Kapuze und Mantel ab, schraubte die Gasflamme höher und trat vor den Spiegel, der sich in kristallener Klarheit über dem Kamin erhob – so stand sie und lächelte noch immer, als Schritte über den Gang kamen und zugleich mit dem hastigen Pochen die Thür aufgerissen ward.
Das junge Mädchen glaubte, ihr Vater sei es, und wandte sich freundlich um – im gleichen Augenblick zitterte ein leiser Schrei des Erschreckens durch den wohligen kleinen Raum.
„Friedrich!“
Der Mann, der da eingetreten war, sah auch zum Erschrecken aus – bleich, das blonde Haar feucht an der Stirn klebend, und in den Augen, die tief in dem abgemagerten Gesicht lagen, ein unheimliches Feuer.
„Ich sah Dich eben heimkehrend begann er, auf sie zutretend, „und beeile mich, Dich zu begrüßen. Es geht Dir gut, wie ich sehe, und ich hätte mir die Angst, die ich mir Deines gänzlichen Verstummens wegen machte, füglich ersparen können. Da ich aber einmal hergekommen bin, so möchte ich jetzt wenigstens nur als Dein erklärter Bräutigam wieder abreisen; Du wirst mir das nicht verdenken können, und es muß auch Dir angenehmer sein als diese Heimlichthuerei. Ich bitte Dich also, gehe jetzt mit mir zu Deinem Vater oder lasse ihn meinetwegen holen, damit die Sache einen Abschluß findet!“
Sie war erblaßt zurückgetreten, bis in die tiefe Fensternische, die ihr Nähtischchen barg. Der Schreck, sein unvermitteltes bestimmtes Verlangen, das unangenehme Bewußtsein, mit ihm gespielt zu haben, machten sie fast besinnungslos vor Angst. „Papa ist nicht zu Hause,“ stammelte sie.
„So werde ich warten.“
Er zog einen Stuhl zum Kamin. „Wollen wir nicht plaudern?“ fragte er mit der nämlichen unheimlichen Ruhe.
„O, ich bitte, gehen Sie!“ flehte sie jetzt. „Kommen Sie morgen wieder, ich bin jetzt nicht in der Stimmung, zu sprechen.“ Sie deutete auf ihre verwundete Hand.
„Man merkte vor ein paar Minuten davon allerdings nichts,“ erwiderte er, ihre förmliche Anrede nicht beachtend, „ich hörte Dein Lachen über den ganzen Garten schallen und zum Plaudern schien Dir selbst der zugige Platz vor der Hausthür recht. Hier innen ist’s aber doch behaglicher – also bitte! Was Du einem Fremden zugestehst, wirst Du wohl Deinem Bräutigam nicht versagen?“
Sie war während seines Sprechens näher getreten. „Ich bin allein zu Haus und muß Sie nochmals dringend ersuchen, dieses Zimmer zu verlassen!“ sprach sie mit vor Aufregung bebender Stimme.
„Warum denn?“ fragte er. „Wir waren ja in dem Gartenhäuschen auch allein, als wir uns verlobten!“
„Sie wollen mich ängstigen und beleidigen!“ rief sie heftig, und die bisher mühsam zurückgehaltenen Thränen stürzten ihr aus den Augen.
Da war er auch schon herübergekommen und hatte ihre Hand ergriffen. „Du glaubst ja selbst nicht, was Du sagst, Kind,“ sprach er. „Du hast mich noch ebenso lieb wie vor ein paar Monaten, als Du mir zugeschworen, falls Dein Vater die Verlobung nicht zugeben würde, mit mir heimlich davonzugehen.“
„Nein! Nein!“ rief Therese und entriß ihm die Hand, „das habe ich nie gesagt, das bilden Sie sich ein!“
„Ich habe es zum Glück schriftlich! Gleich im ersten Briefe stand es, und diese Stelle hat mich immer wieder getröstet in den letzten Wochen des Zweifels. Also, sprich, Therese, ist Dein Vater noch immer gegen unsere Verbindung?“
„Er ist’s noch ebenso. Und – ich –“
„Du?“
„Ich habe eingesehen, daß er recht hat!“ Sie setzte sich nach diesen Worten auf die Chaiselongue und blickte an ihm vorüber mit dem ungeduldigen Gesichtsausdruck einer Frau, die um jeden Preis eine peinliche Unterredung abgekürzt sehen möchte.
„Therese, das ist nicht wahr! Das kann, das darf nicht Dein Ernst sein! Du mußt Deine Liebe mir bewahrt haben, Deine Briefe könnennicht lügen! Du bist doch kein gewöhnliches Mädchen, Du stehst über diesen spießbürgerlichen Vorurtheilen, Du bist imstande, der Welt Trotz zu bieten und auch ohne Deines Vaters Einwilligung mein zu werden. Versuche es noch einmal mit Güte bei ihm, und schlägt es fehl, dann – dann laß uns die Schiffe hinter uns verbrennen; es giebt noch irgend einen Fleck auf der Welt, wo wir – –“
„Sie meinen,“ fragte Therese Krautner mit eisiger Ruhe, „ich soll heimlich den Vater verlassen, mich in eine ungewisse abenteuerliche Zukunft stürzen?“
„Dein Vater wird sich, muß sich später versöhnen lassen –“
„Ich habe gar keinen Sinn für romantische Unternehmungen,“ schnitt sie ihm das Wort ab, „ich finde es hier schöner als irgendwo in der ganzen Welt! In meinen Augen ist Andersheim die reizendste Stadt, die ich kenne. Und nun, bitte, gehen Sie; es wäre mir nach dem Gesagten doppelt peinlich, wenn das Mädchen käme und Sie hier fände.“
„Nein!“ sagte er leidenschaftlich, „ich gehe nicht! Du bist mir Rechenschaft schuldig; Du hast mich alle Qualen der getäuschten Erwartung, der Verzweiflung durchkosten lassen – nun sprich: woher auf einmal diese Wandlung?“
Er war näher getreten und hatte drohend die Hand auf ihre Schulter gelegt.
Da sprang sie, außer sich, empor. „Papa! Papa!“ rief sie zur Thür hinausstürzend. Und schwere Schritte schallten im Flur, sie kamen herüber, und ehe noch der betroffene Mann sich besinnen konnte, stand Herr Alois Krautner vor ihm, dessen lächelndes Gesicht sich, als er den Offizier erblickte, mit einem Schlage so veränderte, wie wenn über eine im Sonnenglanz liegende Landschaft plötzlich schwarze Wolken fliegen.
„Was wünschen Sie, mein Herr?“ fragte der Vater, an den die Tochter angstvoll sich schmiegte. „Was verschafft uns die Ehre?“
„Ich habe Ihrem Fräulein Tochter bereits mitgetheilt, daß ich Sie zu sprechen wünsche,“ erwiderte Adami, rasch gefaßt.
[717]
[718] „Er wollte, ich sollte heimlich mit ihm fortgehen, und das kann ich doch nicht!“ unterbrach ihn weinend das Mädchen.
„Nein, nein, allerdings, das kannst Du nicht,“ sagte Herr Krautner kalt. „Aber nun laß mich los; Schwerenoth, das kommt von solchem Getreibe hinter meinem Rücken! Trink’ ein Glas Wasser und flenne allein weiter! Sie, mein Herr Lieutenant, gehen vielleicht, in Ermanglung der Tochter, mit dem Vater davon, vorläufig zwar nur bis in mein Zimmer, wenn’s gefällig ist! Hier ist die Thür – bitte, bitte, nach Ihnen.“
Und die kugelrunde kleine Gestalt ließ den blassen jungen Mann vorangehen, mit einer regelrechten Verbeugung, die zu jeder anderen Zeit unendlich heiter gewirkt haben würde; heute hatte keiner von den beiden Zuschauern Sinn für die grimmige Komik des Herrn Alois Krautner. Im Flure schritt der beleibte Hausherr so rasch und gewandt voran, als habe er unsichtbare Sprungfedern unter den Sohlen; er öffnete die Thür seines Zimmers. „Ich bitte, gedulden Sie sich einen Augenblick, ich habe nur mit meiner Tochter ein paar Worte unter vier Augen zu reden.“ Damit schraubte er eine altmodische Oellampe etwas höher und verließ dann den Raum, um sofort wieder in Theresens Boudoir zurückzukehren. Das Mädchen wollte sich ihm an die Brust werfen, aber er löste ihre Arme so wenig freundlich wie noch nie.
„Bitte, bitte, jetzt ist keine Zeit zu Zärtlichkeiten; ich will nur ein paar klare Antworten auf die Fragen, die ich stellen werde – setze Dich dorthin! So! Also, Nummer eins – hast Du Dich, trotz meines Verbots, im Frühjahr mit Lieutenant Adami verlobt?“
Eine lange Pause, dann Schluchzen.
„Ja oder Nein?“
„Ja, aber ich – –“
„Bitte, keine Entschuldigung! Hast Du Briefe mit ihm gewechselt?“
„Ja – ja – aber ich – – schon –“
„Hast Du gelobt, ihm treu bleiben zu wollen?“
„Ja – aber –“
„Ruhig! Und nun bist Du anderen Sinnes geworden?“
„Ja!“
„Weshalb?“
„Ach, lieber Papa,“ schluchzte Therese, die jetzt eine Gelegenheit sah, des erzürnten Vaters Herz zu rühren, „lieber Papa, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, Dich zu hintergehen, weil ich verstehen lernte, daß Du nur mein Bestes willst.“
„Schon gut, schon gut, darüber sprechen wir später.“ Er schob sich zur Thür hinaus unb kehrte zum Lieutenant Adami zurück.
In der eleganten Villa gab es ein Zimmer, das wundersam abstach gegen die übrigen Prunkräume. Es lag abgeschlossen von allen anderen, nach der Straße zu, hatte zwei mittelgroße Fenster ohne modische Gardinen, nur oben hing an einem Querbrett ein einfach mit Bällchenfransen verzierter Stoff. Die Dielen waren blenbend weiß gescheuerte Tannenbretter, der Ofen ein gelblicher Kachelofen von ungemein häßlicher Form. Hier stand ein altmodisches, mit schwarzem Wachstuch bezogenes Kanapee, davor ein alter plumper wachstuchbenagelter Tisch; hier hing an der Wand in schwarzem ovalen Rahmen der Schattenriß einer Frau, die ein Kind auf dem Schoße hielt; hier prangte ein Pfeifenbrett in der einen Ecke, in der anderen ein Schreibsekretär aus Birkenholz, und hier stand der Ohrenstuhl, in dem Herr Alois Krautner sein Mittagsschläfchen gehalten, seit er mit seinem Hannchen als junger Meister den kleinen Haushalt gegründet hatte. Mit einem Worte, es war das Privatzimmer des Hausherrn, das einzige, in dem er sich wohl fühlte, in dem er sommers in Hemdsärweln und winters in Schlafrock und Zipfelmütze sich wie „zu Hause“ vorkam; wo er alle Tage daran erinnert wurde, wie er doch aus einem einfachen Maurergesellen ein hochangesehener Bürger geworden sei. Diese Stube war seine Kirche, in der er ganz absonderlichen Dankgottesdienst hielt; sein Tempel der Erinnerung, denn jedes Stückchen der Einrichtung hatte seine gute Selige mit ihm vereint benutzt. An dem Tische hatten sie als junge Eheleute ihr erstes Mittagsmahl verzehrt und auf dem Sofa am Feierabend gesessen, wenn er müde und abgearbeitet nach Hause gekehrt war. Und in den Schrank waren von ihm die ersten ersparten Thaler mit einer Glückseligkeit gelegt worden, gegen die das Bewußtsein des späteren Reichthums wie ein Schatten verblich.
Und in dieser Stube saß Lieutenant Adami auf dem Sofa. Ganz klar war ihm die Sachlage nicht. In seinem Herzen wollte sich noch eine Hoffnung regen – wenn sich der Vater doch noch erweichen ließe? Daß ihm Therese wirklich untreu geworden, das konnte sein selbstbewußter Kopf nicht fassen. Ihre Weigerung war sicher nur Schrecken über sein unvermuthetes Erscheinen und seine leidenschaftliche Hast gewesen. Sie mußte ihn ja noch lieben, es war ja nicht anders möglich! War dem nicht so, dann – – ja dann war er zu Ende mit allem überhaupt, dann sah er in ein bodenloses Nichts hinein, und deshalb durfte diese Sache nicht schlecht verlaufen, sie durfte nicht!
Er fuhr empor, als Herr Krautner wieder eintrat, und sank dann wie gebrochen zusammen – in dem runden Gesicht des alten Herrn war nichts Gutes zu lesen. Herr Krautner nahm einen Stuhl, setzte sich seinem Gaste gegenüber, trommelte mit den runden kurzen Fingern auf dem grüngemusterten Wachstuch und begann endlich, sich räuspernd:
„Mein Mädel hat unrecht gegen Sie gehandelt; Therese hat Sie, wie man so sagt, an der Nase herumgeführt. Es thut mir weh, sie auf solchen Schlichen zu finden, hab’ immer gemeint, sie sei wie ihre Mutter so schlicht und recht und treu gesinnt. Nun, die Heutigen sind anders, und irren kann jeder Mensch einmal. Hätte sie Ihnen, als sie zur Einsicht kam, geschrieben: ‚Mein Herr, ich sehe ein, der Vater hat recht, wir taugen nicht zusammen,‘ so hätt’s eine Art gehabt; so aber, muß ich sagen, ist sie im Unrecht. Ich weiß es in diesem Augenblick gewiß, daß es ein Unglück gegeben hätte, wäret Ihr zusammengekommen. Sie müssen ihr verzeihen, Herr Lieutenant. Nun – bitte, bitte, bleiben Sie nur sitzen,“ setzte er beschwichtigend hinzu, als Friedrich Adami sich erheben wollte mit erdfahlem Gesicht, „wir sind noch nicht fertig, ich muß Ihnen da noch etwas sagen.“
Der Offizier war wieder zurückgesunken; der alte Mann schwieg, ein wunderliches Zucken ging durch sein Gesicht.
„Ich kenne Sie besser, als Sie glauben, Herr Lieutenant,“ fuhr er fort. „Erstlich verstehe ich ein wenig in den Gesichtern der Menschen zu lesen und zweitens habe ich in Berlin seiner Zeit jemand – nun sagen wir, einen guten Freund von mir – gebeten, mir dann und wann einmal etwas mitzutheilen über Ihr Thun und Lassen – verstehen Sie? Ich habe, obgleich ich Sie schroff abwies, immer mit der Möglichkeit gerechnet, daß das Mädel dennoch auf Ihnen besteht. Ich kann nach all dem nur sagen, es ist mir lieb, daß Therese von einer Heirath mit Ihnen durchaus nichts mehr wissen will, denn – die Nachrichten über Sie lauteten für den künftigen Gatten meiner Tochter nicht gerade einnehmend – was Ihr Privatleben anlangt! Mit vollster Hochachtung aber sprach man von den Leistungen in Ihrem Beruf, und es ist schade um jeden schneidigen Offizier, der Schulden halber den Dienst quittieren muß. Sie stehen vor diesem Schritte, Herr Lieutenant.“
Adami sprang empor. „Mein Herr, was geht Sie das an!“ rief er mit bebender Stimme und griff nach seinem Hute, der vor ihm auf dem Tisch lag.
„Wollen Sie mich nicht ausreden lassen? Also, ich wollte sagen: wir, das heißt das Thereschen, hat Ihnen ein schweres Unrecht angethan. Nun ist mir aber nichts schrecklicher und lästiger, als mit dem Bewußtsein einer Schuld gegen jemand in der Welt umherzugehen – das wird mir meinen Schoppen nicht schmecken lassen, es wird mir meinen Mittagsschlaf stören und die Freude an meinem Kinde erst recht. Da möchte ich Sie nun bitten, Vertrauen zu mir zu haben und mir klaren Wein einzuschenken, kurz gesagt, mir einmal ganz ehrlich zu gestehen, wie hoch sich die Summe Ihrer Schulden beläuft.“
Abermals sprang Lieutenant Adami auf, mit denselben Worten wie vorhin: „Mein Herr, was geht Sie das an?“
Und abermals drückte Herr Krautner den jungen Mann, der sich mit zitternder Hand den Schweiß von der blassen Stirn wischte, in die Sofaecke zurück.
„Sie werden die Summe nicht auswendig wissen, natürlich nicht; ich bitte Sie also, schreiben Sie mir den Betrag und nennen Sie mir die Gläubiger! Ich werde selbst nach Berlin kommen und die Sache ordnen – so, das wäre abgemacht. Jetzt aber habe ich eine Gegenbedingung: das Mädel da drüben ist für Sie nicht mehr vorhanden in der Welt – verstanden? Dafür muß ich um Ihr Ehrenwort bitten. Ferner muß ich darauf bestehen, daß Sie nach Ordnung Ihrer Angelegenheiten ein anderes [719] Leben beginnen – keine täglichen Sektkneipereien mehr, keine kostspieligen – ich meine die Damen vom Ballett – verstanden? Und die Karten, die Karten! Es ist die Warnung eines Mannes, der’s gut meint. Im Grunde könnte mir’s ja gleich sein, was aus Ihnen wird; aber – sehen Sie –“ Er stockte, pfiff ein paar Takte, räusperte sich dann und sprach weiter:
„Da drüben das alte Fräulein, das Sie Ihre Pflegemutter nennen, das will mir nicht mehr aus dem Kopfe. Geh’ ich da vor ein paar Tagen über die Promenade am Rhein und treffe sie. Ich hatte sie lange nicht, wie man so sagt, bei Tageslicht beschaut, und ich erschrak über die tausend Sorgenfalten, die sie sich angegrämt hat um – Ihretwillen, Herr Lieutenant, denn das pfeifen hier die Spatzen von den Dächern, daß sie für Sie nach und nach ihr bißchen Geld hingegeben hat. Die Julia macht ihr keine Last, die lebt ja so nebenher von ein paar Brocken wie ein kleines Vögelchen. Und da mußt’ ich daran denken, wie ich sie einstmals zuerst gesehen habe, als ich da drüben in dem Hause zu thun hatte – ein kleiner dummer Lehrbub’. Sie war damals noch ein junges schönes Mädchen, und ich habe gemeint, so wie sie müßte die Jungfrau Maria ausgeschaut haben, als sie noch auf Erden ging. Aber nicht bloß wegen ihrer Schönheit ist sie mir so unvergeßlich geblieben, sondern weil an dem Tage mein Vater verunglückt ist. Eine Mutter hatte ich schon nicht mehr, und wie nun die Leute gekommen sind und haben in den Keller herunter geschrien – denn dort mauerten wir – ‚Alois, Dein Vater ist verunglückt, sie bringen ihn eben tot heim!‘ und alles hat nun lamentiert und ist davongelaufen, um den Verunglückten zu sehen, so daß ich armes Wurm plötzlich ganz allein im Keller blieb und nicht wußte, wie mir geschehen war – sehen Sie, Herr Lieutenant, da ist auf einmal das schöne junge Mädchen dagestanden und hat den armen kleinen schmutzigen Lehrbuben in die Arme genommen, hat ihm das struppige Blondhaar gestreichelt, in dem Kalk und Spinnweben hingen, und hat gesagt: ‚Du armer Bub’, ach, Du armer Bub’!‘ Und sehen Sie, das – das –“ Er brach ab, schneuzte sich und sprach barsch weiter. „Also, Sie wissen nun – nicht Ihretwegen, sondern – na, die Sache ist abgethan – auf Wiedersehen in Berlin! Sehen Sie, daß Sie so heimlich abreisen, wie Sie gekommen sind, es kann uns allen nur daran gelegen sein, daß die Geschichte totgeschwiegen wird. Guten Abend!“
Dann schlug die Thür, und er war aus dem Zimmer gegangen, es dem Offizier überlassend, sich mit sich selbst zurechtzufinden.
Der nahm seinen Hut und verließ mit zusammengepreßten Lippen das Haus, wüthend, beschämt, und doch im hintersten Grunde seiner Seele mit einem Gefühl unendlicher Erleichterung.
Er wanderte in der Finsterniß am heimischen Grundstück vorüber, unten, längs des Stromes. Im Stübchen der Tante brannte Licht; es wollte etwas wie Mitleid mit der alten Frau über ihn kommen, da rief er sich selbst zur Ordnung. Nur keine Sentimentalität, nur kein Leben auf der sogenannten Mittelstraße! Ein Lieutenantsleben mit achtzehn Thalern Zulage monatlich – nimmermehr! Und als er dort stand und hinaufstarrte, reifte ein Entschluß in ihm – Afrika! Hinaus in eine andere Welt!
Vom Fenster des Eisenbahnwagens blickte er dann noch einmal zu dem Städtchen hinüber und suchte den spitzen Thurm der Krautnerschen Villa. „O, dieses Mädchen!“ Er ballte die Faust, er hatte sich doch recht redlich in diese blonde Nixe vergafft gehabt, und nun so! – Und dazu mußte er noch Wohlthaten von dem alten sentimentalen Narren annehmen, denn einen anderen Ausweg gab es nicht! Er zündete sich eine Cigarre an und bei ihrem aromatischen Dufte beruhigte sich allmählich sein Grimm. Seiner Schulden ledig zu werden, das war am Ende nicht zu unterschätzen, wozu über das andere sich grämen!
Am nächsten Mittag kam er sehr gefaßt ins Kasino zu Tische und zwei Tage später reichte er, gleichzeitig mit seinem Abschied, das Gesuch um eine Stelle als Offizier in der deutschen Schutztruppe für Ostafrika ein.
„Nanu?“ fragten die Kameraden, „wir meinten, Sie wollten heirathen?“
Er strich den Schnurrbart und antwortete nachlässig: „Ich passe absolut nicht zu einem Philister, das Glück kommt noch früh genug.“ Und dann trank er seinen Porter mit Ale aus und sagte, er müsse auf den Bahnhof, um einen alten Onkel zu empfangen, der es sich durchaus in den Kopf gesetzt habe, die Sehenswürdigkeiten des Nestes zu bewundern; deshalb werde er auch heute abend nicht zu Tische kommen. Und der alte Onkel war Herr Alois Krautner, der dem Herrn Lieutenant helfen wollte, sich zu arrangieren.
| * | * | |||
| * |
So um halb neun Uhr an jenem selben Abend, da Therese ihre Verlobung gelöst – der junge Offizier hatte kaum das Krautnersche Grundstück verlassen – kam vorsichtig aus dem Nachbarhaus die schlanke Gestalt Julias; sie trug ein Präsentierbrett mit einem Tellerchen Kuchen und Creme und sollte beides mit den herzlichsten Wünschen für baldige Heilung der kranken Hand dem Thereschen von der Frau Räthin überbringen. Julia kam den Gartensteig daher, wo sich im Schnee noch die Fußspuren des Bruders zeigten, und hatte keine Ahnung, daß er hier geschritten war, daß sich eine bedeutungsvolle Stunde seines Lebens vor kurzem hier abgespielt hatte.
Sie trat in den Hausflur, und als niemand erschien, ging sie hinüber zu Theresens Thür und pochte. Aber kein gastliches „Herein!“ erscholl. Da drückte sie auf die Klinke und steckte ihr dunkles Köpfchen durch den Thürspalt. „Darf ich eintreten?“ klang es freundlich in die Ohren Theresens, die in einem der kleinen Sessel am Kamin saß und der Thür den Rücken zuwandte.
Nun spraug sie auf, und Julia sah in ein blasses Gesicht mit unheimlich sprühenden Augen.
„Was willst Du?“ fragte Therese barsch und unfähig, ihre Erregung zu verbergen; „ich bin totmüde und will zu Bett gehen.“
„Wie stehst Du nur aus!“ sagte Julia nicht im mindesten verletzt, weil sie die Leidende in ihr sah. „Hast Du große Schmerzen?“
„Ja!“
Mamsell Unnütz stellte den Teller aus der Hand und wandte sich zum Gehen. „Wart’ nur, Therese, ich hole den Doktor!“
„Ich will ihn nicht – um Gotteswillen, bleib!“ schrie es hinter ihr, und Therese zerrte die Freundin so hastig am Kleide zurück, daß die Falten rissen. „Entschuldige!“ stotterte sie.
„Ja, was hast Du denn nur, Thereschen, Du bist ja schrecklich aufgeregt!“
„Geh’ zum Vater,“ murmelte das blonde Mädchen, „sag’, er soll zu mir kommen!“
Julia ging. Sie fand Herrn Krautner in seinem Zimmer; er saß im Lehnstuhl am Fenster und schaute in den dunklen verschneiten Garten hinaus.
„Was willst Du, Töchterchen?“ fragte er weich, mit einer Stimme, die ganz anders klang als sonst. Julia richtete Theresens Bitte aus.
Der alte Mann blieb eine Weile still. „Sage ihr, wenn sie Verlangen hat nach mir, so könne sie auch den Weg zu mir finden,“ sprach er dann. „Das Kind soll zum Vater kommen, nicht umgekehrt! Leider habe ich’s versäumt, ihr das bei Zeiten klar zu machen; von heute ab wird’s anders.“
Und als ihn Julia fragend und verwundert anblickte, strich er über ihre Wange. „Es hat ihr die Mutter gefehlt, die Mutter, Kind, und der alte Mann hat in das Einzige, was ihm geblieben, hineingeschaut wie in einen goldenen Becher und hat die Tochter angebetet wie ein Christkindel. Es hat nicht gut gethan, nicht gut gethan!“ Und er schüttelte den Kopf.
„Sie kommen nicht, Herr Stadtrath?“ fragte Mamsell Unnütz noch einmal leise.
Er hob sich ein wenig vom Stuhle, dann sagte er wieder: „Nein, ich komme nicht.“
„Thereschen,“ sprach Julia drüben zu der Harrenden, „ich weiß ja nicht, was Ihr miteinander habt, aber Du bist das Kind, geh’ hinüber zu ihm, gieb ihm die Hand!“
Statt aller Antwort begann Therese bitterlich zu schluchzen. „Niemand will mich verstehen, niemand kann ich es recht machen! Selbst wenn ich elend und krank bin, nimmt man keine Rücksicht auf mich. Ich gehe nicht, ich gehe nicht zu ihm; behandelt hat er mich, als sei ich eine Verbrecherin und lieber laufe ich fort und komme niemals wieder, nie!“ Und sie fing abermals an zu weinen, bis sie in einen Zustand von Aufregung gerieth, daß Mamsell Unnütz noch einmal hinüberflog, um den alten Herrn zu bitten, doch ja zu kommen, die Therese scheine ernstlich krank zu sein.
Da kam er und trat zu dem blassen zitternden Geschöpf, das auf dem Sofa lag; sorgsam breitete er die Decke über den schlanken Körper, und sein unschönes, sonst so joviales Gesicht hatte einen wunderbaren Ausdruck von Kummer und Zärtlichkeit.
[720] „Na, nun weine nur nicht mehr, als sei Dir das größte Unrecht geschehen – hörst wohl?“ polterte er. „Nimm Dir eine Lehre daraus! Deine Mutter hätte so etwas nicht gethan, die war so schlicht und so rechtlich – – Werde ernst, Kind, werde ernst, und . . . sapperlot, höre auf zu zittern, wirst sonst krank; am Ende wär’s gut, wir holten den Doktor, daß er Dir –“
Da fuhr sie abermals empor. „Nicht den Doktor!“
„Nun – nein, nein!“ beruhigte er. „Da, trink’ Zuckerwasser und geh’ zur Ruh’; ich will mich nachher an Dein Bett setzen, bis Du eingeschlafen bist, das Julchen hilft, Dich auskleiden; möchte nicht, daß Deine Jungfer sieht, wie aufgeregt Du bist.“
Julia brachte das noch immer bebende Mädchen zu Bett, dann kam der alte Mann wieder, setzte sich neben seinen Liebling und schickte sich an, Wacht zu halten wie eine Mutter.
Mamsell Unnnütz ging. Sie hatte feuchte Augen, als sie noch einmal zurückschaute auf die Halbschlummernde, die so liebevoll behütet war. Sie wußte nicht, was geschehen war, aber wäre es auch das Herbste, Schwerste gewesen – wer solche Liebe besaß, der war beneidenswerth.
„Glückliche Therese, die einen Vater hat und einen Liebsten!“
Und da unterdrückte sie mühsam einen Freudenschrei. Ach, sie hatte ja auch ein Glück! Dort an der Pforte vor Krautners Garten stand er und wartete auf ihr Kommen! Gewiß hatte ihm seine Mutter gesagt, daß sie noch einmal ausgegangen sei.
„Nun?“ fragte er, neben ihr herschreitend, „wie geht’s denn da drüben, Unnütz?“
„Gut!“ antwortete sie leise. „Sie schläft.“
Er nickte befriedigt. Dann gingen sie stumm nach Hause. Es war unsagbar schön, dieses Stückchen Weg.
„Schlaf wohl, Kleine,“ sagte er im Hausflur, müde, mit unterdrücktem Gähnen. Dann nickte er ihr zu und verschwand in seiner Thür.
„Gute Nacht!“ murmelte sie und stieg die Treppe empor.
Die Cholera-Waisen.
„Cholera-Waisen" – ein Wort von schrecklichem Klange! Noch vor wenigen Wochen kannte man es nirgends; ungeahnt rasch hat sich die Neubildung vollzogen. Blitzschnell flog sie hinaus aus Hamburgs Mauern, die Kunde von dem Unglück so vieler, und mit ihr jenes düstere Wort, das sich erst in der schwer betroffenen Hansestadt selbst und nach wenigen Tagen überall im Vaterland ein leidiges Bürgerrecht erwarb. Schon wurden mit der Bezeichnung „Für die Cholera-Waisen“ Gaben eingesandt von nah und fern; ein oder zwei Cholera-Waisen an Kindesstatt anzunehmen, dazu erboten sich kinderlose Ehepaare in verschiedenen deutschen Städten. Auch die „Gartenlaube“ will unter denen sein, die für die Cholera-Waisen Hamburgs eintreten und sammeln.
Als der Brief anlangte, in dem mir von der Redaktion die Aufgabe gestellt wurde, diese Sammlung einzuleiten durch eine Schilderung der Noth, die Hilfe fordere, da brauchte ich nur noch eine einzige Erkundigung einzuziehen, in allen anderen Punkten hatte ich in den entsetzlichen jüngsten vier Wochen selbst erlebt und selbst erfahren, was zu sagen war. Nur die Ziffer der schon vorhandenen Cholera-Waisen fehlte mir. Ich wandte mich an einen sicheren Gewährsmann.
[721]
„Die Zahl kann natürlich nur ungefähr angegeben werden,“ meinte dieser, „schon deshalb, weil sich noch nicht von allen eingelieferten Kindern mit Gewißheit sagen läßt, ob sie wirklich Waisen sind. Täglich stellen sich Väter oder Mütter ein, die, aus dem Krankenhaus eben als genesen entlassen, nun mit Angst und Zittern ihre Kleinen suchen. Manche freilich suchen vergebens, sie finden nur die Gräber der Kinder auf dem Friedhof in Ohlsdorf draußen. Also erst im Laufe der Zeit läßt sich von der armen kleinen Gesellschaft feststellen, wer Ganzwaise und wer Halbwaise ist.“
„Aber eine annähernde Schätzung ist doch wohl möglich?“
„Nun ja – 623 Kinder sind uns von der Polizeibehörde abgenommen und einstweilen bei Privatleuten in Pflege gegeben, 250 sind im Waisenhaus und in der Schule in Uhlenhorst untergebracht worden; rechnet man dazu die Kinder im Barmbecker Asyl und die Neueingebrachten in der Uebergangsstation am Brookthorquai, so möchte alles in allem die Zahl der Cholera-Waisen auf rund tausend zu veranschlagen sein, ohne jede Uebertreibung. Und wohlgemerkt, das ist die jetzige Zahl; wer will wissen, wieviel noch hinzukommen!“
Tausend Cholera-Waisen – und diese Zahl wächst in der That noch von Tag zu Tag! Wahrlich, es hat einen furchtbaren Klang, das neue Wort, vor allem für die Hamburger selbst! Seit manchen Wochen mußten die Eltern dort jeden Morgen seiner eingedenk werden, wenn sie beim Frühstück einen Blick in die Zeitung warfen und die Familienanzeigen durchflogen … die nahmen dreimal, viermal soviel Raum ein wie zu gewöhnlichen Zeiten, obgleich die Verlobungen und die Hochzeiten so äußerst wenig Platz beanspruchten. Da theilten Verwandte im Namen von drei unmündigen Kindern mit, daß deren Eltern an einem und demselben Tage weggerafft worden seien, da kündigte eine Tochter an, daß ihrer verwitweten Mutter jetzt auch Bruder und Schwester ins Grab gefolgt seien und sie nun ganz allein stehe. Und seltsam – fast nie wurde die schreckliche Seuche als Todesursache angegeben, man scheute das Wort, nur von „kurzem schweren Leiden“ war die Rede; aber Zusätze wie „Bestattung von der Leichenhalle am Holstenthor aus“ oder „die Beerdigung hat bereits stattgefunden“ sprachen deutlich genug. Und gerade in diesen unscheinbaren Zusätzen lag oft noch eine besondere Verschärfung des Schmerzes der Hinterbliebenen. Im sorgfältigen Erweisen der letzten Liebespflicht, in der liebevollen Zurüstung der Bestattung liegt immerhin eine Art von Trost, von Beruhigung [722] Aber auch dieser blieb hier vielen versagt. Ich war Augenzeuge, wie hart es eine mir sehr nahestehende Familie empfand, daß der Leichnam des Vaters, kaum daß der Entschlafene den letzten Hauch gethan, sofort im zugelötheten Zinksarg hinausgeführt werden mußte nach der Friedhofskapelle.
Wenn man da nach dem Frühstück Abschied nimmt von den Lieben bis zum Nachmittag oder Abend, dann drängt sich immer wieder der herzbeklemmende Gedanke auf: werde ich euch auch wiedersehen? Gehören nicht auch meine Kinder morgen schon zu den Cholera-Waisen?
Freilich, gleich auf dem Wege zum gewohnten Tagewerk, tritt der Gedanke an das eigene Wohl und Wehe zurück vor dem allgemeinen Elend, das sich einem aufdrängt und die Betrachtungen in Anspruch nimmt. An allen Straßenecken, an den Häusern, Bäumen, Zäunen – überall mahnen die zu Tausenden angeklebten rothen und grünen Zettel, kein ungekochtes Wasser aus der Leitung zu trinken oder sonst irgendwie zu benutzen, kein rohes Obst zu essen. Alle Gossen, alle Haustreppen und Schwellen sind reichlich mit Karbolsäure besprengt, den scharfen Geruch spürt man auf Schritt und Tritt. Wagen mit gekochtem Wasser, das unentgeltlich abgegeben wird, fahren durch die Straßen, Volksküchen sind errichtet. Wer seinen Schritt zur Elbe lenkt, der kann dort die Staatsbarkasse beobachten, welcher die hygieinische Ueberwachung des Schiffsverkehrs obliegt. Mein täglicher Weg führt durch die Steinstraße, in gewöhnlicher Zeit eine der belebtesten Verkehrsadern der Altstadt und selbst in den schlimmsten Tagen, als täglich über tausend Erkrankungen und nahe an fünfhundert Todesfälle vorkamen, auf den ersten Blick immer noch von regem Treiben erfüllt. Aber bei näherer Beobachtung zeigte sich der Unterschied. Die Schulkinder mit dem Ränzel auf dem Rücken und der Frühstückskapsel an der Seite fehlten, alle Lehranstalten mußten ja geschlossen werden. Die lange Reihe der Fischfrauen am südlichen Bürgersteig war verschwunden; niemand hatte mehr ihre Ware begehrt. Der Obstverkauf auf der Straße war verboten worden, so hatten die Fruchthändler, die sonst hier umherzogen, anderen Erwerb suchen müssen – viele dieser armen Leute sind noch heute auf dieser Suche. Und müßig stehen die kleinen Lebensmittelhändler, die in Hamburg den Namen „Käsehöker“ führen, in der Ladenthür; vor ihren Hauptartikeln, Butter und Käse, warnt täglich aufs eindringlichste die „Cholera-Kommission“. Ich grüße einen mir bekannten Ladeninhaber: „Wie geht’s denn?“ Er antwortet, die Frage auf sein Geschäft beziehend, mit traurigem Kopfschütteln: „Verdient wird nichts. Von dem wenigen, das ich verkaufe, muß ich das meiste auch noch anschreiben. Noch eine Woche halte ich’s zur Noth aus. Dann – ja, was dann!“
Vor einem Hofe hält ein zweispänniger Wagen, mit Schmutz bespritzt. Ein Krankenwärter schließt eben dessen Thüre, schwingt sich auf den Bock, und in raschem Trabe rollt das Fuhrwerk dahin. Herzzerreißend tönt von oben her, aus dem Fenster einer niederen Dachwohnung, das Jammern und Schluchzen von Kinderstimmen – die unbarmherzige Seuche hat den armen Kleinen vor wenigen Stunden den Vater und nun die Mutter entrissen. Einige mitleidige Nachbarinnen gehen hinauf in die verödete Wohnung, um nach den Verwaisten zu sehen; die umherstehende Menge mit den ernsten blassen Gesichtern löst sich auf. „Heute schon der dritte Transport aus diesem Hofe!“ murmelt einer im Weggehen und schüttelt den Kopf.
Und so viele von den mir Begegnenden tragen schwarze Kleidung!
Da kommt ein Bekannter vom Hilfskomitee, ich begleite ihn ein Stück Weges. „Schon beinahe zwei Millionen Mark für die Nothleidenden gesammelt, wie das heutige Verzeichniß ausweist,“ bemerke ich, nachdem ich ihn begrüßt habe. „Das übersteigt alle Erwartungen.“
„Ein Tropfen auf einen heißen Stein,“ antwortet er sehr ernst. „Wenn die Seuche noch monatelang anhält, ist Hamburg ruiniert. Zu thun haben nur die Aerzte, die Apotheker und Droguisten, die Weinhändler und Spirituosenverkäufer, die Tischler, soweit sie Särge anfertigen, und die Leichenträger, auch die Zimmerleute beim Barackenbau. Fast das gesammte Kleinhandwerk feiert. Wer will sich neue Kleider oder Mobilien anschaffen, wenn er darauf gefaßt sein muß, morgen in einen jener Wagen zu wandern? Das Schlimmste aber ist und bleibt: unser Lebensnerv ist gelähmt! Ich fragte heute einen Schiffsmakler: ,Wie sieht es im Hafen aus?‘ Er erwiderte nur ein einziges Wort: ‚Tot!‘“
„Freilich – das ist das Hauptunglück, daß man an so vielen Orten in Deutschland und auswärts alles, was von Hamburg kommt, in Acht und Bann gethan hat, seien es auch die harmlosesten Gegenstände, die unschädlichsten Waren, die nach bestimmter amtlicher Versicherung der Reichsregierung nie und nimmermehr die Krankheit übertragen können. Ehe der furchtbare Bannkreis, [723] den die Choleraangst um uns gezogen hat, nicht gebrochen wird kann es nicht besser werden.“
„Noch brauchen wir nicht zu verzagen,“ fuhr mein Freund fort, „man wird sich in Deutschland erinnern, daß die Hamburger gute Deutsche sind. Begnügt man sich mit den wirklich gebotenen Vorsichtsmaßregeln, so wird nach und nach wieder neues Leben hier zu pulsieren beginnen. Und das ist eine Hilfe, so nothwendig wie irgend eine, die man uns bieten kann – möge sie bald kommen, sonst weiß ich nicht, wie wir die jetzigen Einbußen überwinden sollen; sonst ist die Franzosenzeit, ist der große Brand Hamburgs noch nichts gegenüber der Katastrophe der Cholera-Tage von 1892!“
Ich konnte nicht widersprechen. –
Am Abend desselben Tages führte mich meine Frau vor den großen Tisch der Wohnstube, der vollgepackt war mit Spielsachen der verschiedensten Art. „Das haben unsere Kleinen von ihren Sachen zusammengesucht und von den Nachbarskindern erbeten. Du kannst es gewiß morgen früh nach dem Brookthorquai schaffen lassen. Ich erzählte ihnen von den unglückliche Cholera- Waisen, und da haben sie in richtigem Mitgefühl gemeint, ein wenig Spielzeug würde die Verlassenen zerstreuen und aufheitern, ‚da brauchten sie doch nicht den ganzen Tag um ihre Eltern zu weinen.‘ Und Freund B.s größere Mädchen haben sich mit einigen Bekannten vereinigt, um Kinderkleider und Hemden für die Waisen zu nähen. Fehlt es doch, wie ich heute erfahren habe, den allermeisten derselben am Nöthigsten, denn ihr bißchen Zeug ist entweder durch unvernünftige Desinfektion verdorben oder, weil aus Lumpen und Fetzen bestehed, gleich kurzer Hand verbrannt worden. Der Staat allein kann da nicht helfen, selbst die Vorräthe des Waisenhauses reichen nicht aus. Also nicht wahr, Du läßt die Sachen hinbringen?“
„Nein, liebes Kind, ich gehe selbst hin. An Mitteln zur nachherigen Desinfektion wird es am Brookthorquai nicht fehlen. Sei unbesorgt, ich werde dabei nicht angesteckt. Man nimmt es jetzt nicht nur da, wo die unmittelbarste Gefahr vorliegt – in den Cholera-Baracken – sondern an allen bedrohteren Punkten mit der Desinfektion peinlich genau.“
Als ich am anderen Morgen, mit großen Paketen beladen, im Vorzimmer der Uebergangsstation stand – meine Kinder hatten sich’s nicht nehmen lassen, einige Bündel bis zur Thür zu schleppen – empfing mich ein freundlicher Herr, ein Lehrer, der auf die Frage, ob Spielzeug angenommen würde, erfreut antwortete: „Sehr willkommen!“ Gleich darauf stand ich zwischen einer gonzen Schar von Kleinen. Aber betrübt waren sie durchaus nicht, diese Elternlosen. Sie waren zu jung, um den erlittenen Verlust zu begreifen; so lachten und spielten sie ganz vergnügt zwischen den Betten des bescheidenen Gasthofes, in dem sie untergebracht waren. Als der Lehrer sagte: „Hier giebt’s Spielzeug!“, da erhob sich ein wahres Jubelgeschrei. Ganz verwundert sah mich ein kleines Mädchen an, als mir beim Austheilen trotz alles Strebens, mich zu beherrschen, die Thränen über die Wangen liefen. Sie flüsterte mir die Versicherung zu, gestern recht artig gewesen zu sein und es heute wieder sein zu wollen, immerzu, so lange, bis Papa und Mama aus dem Krankenhaus zurückkämen . . . Arme Kleine! Beim zweiten Besuch erfuhr ich, daß ihre Eltern längst im Grabe schlummerten, in dem großen Massengrabe in Ohlsdorf, wo allnächtlich bei Fackelschein so viele schlichte Särge beigesetzt werden, ohne Kranz, ohne Schild, nur mit einer blechernen Nummer versehen.
Aber wenn diese Armen auch für den Augenblick wohl aufgehoben und zufrieden sind in ihrem glücklichen Vergessen . . . wie soll es in Zukunft werden? Bald müssen sie ja doch zum Bewußtsein dessen kommen, was sie verloren haben – müssen wir da nicht dafür sorgen, daß sie dann zugleich das Bewußtsein hegen können: edle Menschen haben uns nicht verlassen in unserer Noth; haben wir die treuesten Herzen, die es auf Erden giebt, die Elternherzen, verloren, so durften wir andere dafür gewinnen, die mit hilfreicher Hand die härtesten Härten des Lebens uns erleichtern wollten und erleichtert haben! Wie solche Hilfe zu leisten sei, darüber sei es mir gestattet, eine kleine Notiz anzuführen, die ich eben in einem hiesigen Blatte finde. Sie lautet: „Eine große Zahl von Kindern ist durch die Cholera verwaist worden. Wenn auch für den Anfang für die Verpflegung und Unterhaltung der Kinder gesorgt worden ist, so ruht ihre Zukunft doch noch im Dunkeln. Manche finden eine freundliche Aufnahme bei kinderlosen Eheleuten und Witwen und sind nach Menschendenken wohl versorgt, viele andere aber müssen von den Behörden untergebracht werden, und wenn ihnen auch volle Liebe und Theilnahme entgegengebracht wird, so sind sie doch die ärmsten und beklagenswerthesten Opfer der durch die Cholera entstandenen Noth. Wenn sie konfirmiert worden sind und ein Geschäft erlernen sollen, stehen sie mittellos da. Ihnen durch die jetzt überall thätige Menschenliebe ein kleines Kapital zu verschaffen, damit sie später nicht durch zu große Armuth an ihrem Fortkommen gehindert werden, hat sich ein Komitee, bestehend aus den Herren Pastor Blümer und Pastor Schoost, Dr. O. Meier und Direktor K. Stalmann, gebildet. Dieses Komitee wird freiwillige Gaben von Fern und Nah annehmen, darüber Abrechnung geben und die Verwaltung der [724] Gaben in die Hand nehmen. Bis jetzt sind bei den genannten Herren bereits gegen 3000 Mark eingegangen.“
Dreitausend Mark – das wären drei Mark für jede Cholera-Waise, also noch herzlich wenig, namentlich da die Zahl der Cholera-Waisen leider jeden Tag wächst. Allein sicherlich wächst auch jeden Tag um ein Beträchtliches die Summe der für die Cholera-Waisen eingehenden Spenden.
Ich habe mich damit begnügt, die nackten schlichten Thatsachen vorzuführen – leicht ließen sich von den Stätten des Jammers schreckliche Einzelheiten erzählen. Aber ich denke, es bedarf nicht eines Appells an das Grausige, um die Herzen zu rühren und die Börsen zu öffnen. Tausend Cholera-Waisen – das sagt genug! Gustav Kopal. Hamburg.
| * | * | |||
| * |
Wir haben den warmherzigen Worten des vorstehenden Berichtes und dem packenden dichterischen Aufruf, den wir gleichzeitig in dieser Nummer veröffentlichen, nur wenig hinzuzufügen. Das Unglück jener Cholera-Waisen ist groß, groß aber ist auch das deutsche Vaterland und groß, das hoffen und wissen wir, die Bereitwilligkeit, zu helfen. So richten wir denn an unsere Leser die herzliche dringende Bitte, ihre Gaben zu senden; jedes kleinste Scherflein in Gestalt einer Zwanzig- oder Zehn- oder Fünf-Pfennigmarke soll willkommen sein. Bald steht Weihnachten vor der Thür – schaffet jenen verlassenen Waisen ein fröhliches Weihnachtsfest, eine lichtere Zukunft im neuen Jahr! Das ist die
Ueberschrift, die wir der Sammlung für die Cholera-Waisen geben möchten, welche wir hiermit eröffnen. Sämmtliche Beiträge bitten wir zu richten an die Expedition der „Gartenlaube“ in Leipzig, Königsstraße 33. Die Redaktion.
Nachdruck verboten.
Alle Rechte vorbehalten.
Gretchens Liebhaber.
Ein wenig Sonnenschein, gedämpft durch qualmversengte Buchenblätter; ein wenig frische Luft, wie sie in der Umgebung großer Städte weht, verdickt vom Rauch der Schornsteine und dem Staub der Fahrdämme; die schmetternden Weisen eines unverdrossenen Orchesters vierten Rangs und vor sich auf den primitiven Tischen der Gartenwirthschaft einen dampfenden bräunlichen Aufguß, der sich für Kaffee ausgiebt; dazu das süße Bewußtsein, einen ganzen langen Sommernachmittag, frei von jeder Werktagspflicht, nach eigenstem Ermessen verträumen zu dürfen – was braucht’s mehr, um sonntägliche Feststimmung in den Herzen hart arbeitender Menschen hervorzubringen? Ungetrübt lagerte solche Feststimmung über dem dicht gefüllten Konzertgarten am Ende der Stadt, dessen eine Seite den letzten Häuserreihen zugekehrt war, während an zwei anderen der Stadtforst seine Grenze bildete und hart an der vierten ein Fahrweg vorüberführte, gerade hinein in das Dunkel des hochstämmigen Buchenwaldes. Freude und Frohsinn strahlten aus den Augen der jungen Schönen, klangen im Lachen der Männer wieder, im Geschmetter der Hörner und wirkten ansteckend auf jeden, der in die Umzäunung des Gartens eintrat. Und als wären sie solcher Ansteckung froh, rückten die Menschen an den Tischen enger und enger aneinander. Die Plätze am Fahrweg waren die gesuchtesten, denn dort fuhr in eigenen Wagen oder in hübsch ausgestatteten Miethkutschen die elegante Welt vorüber, und man fühlte sich immerhin in Berührung mit ihr, wenn auch nur der Staub, den ihr Fuhrwerk aufwirbelte, den Kaffeetisch in seine grauen Wolken hüllte.
Vor einem Tische, dicht an der Umzäunung, saß eine ehrbar und gut gekleidete Frau mit glattgescheitelten grauen Haaren über einer breiten Stirn und strickte an einem wollenen Strumpfe. Dann und wann richtete sie ihre Blicke über die Stricknadeln und das Kaffeegeschirr hinweg auf ihre beiden erwachsenen Kinder an ihrer Seite, und jedesmal, so oft sie es that, nahm ihr Gesicht einen Ausdruck von fast hochmüthigem Stolz an. Und sie hatte Ursache, stolz zu sein: ein hübscheres Menschenpaar fand sich vielleicht nicht im ganzen Garten.
Das Mädchen, schlank aufgeschossen, mit dem hochmüthigen Ausdruck der Mutter in den pikanten Zügen, mit dem keck zurückgeworfenen auffallend kleinen Kopfe, den in Lackschuhen steckenden zierlichen Füßen, dem schwarzen Wollkleid von jenem eigenthümlich knappen übermodernen Schnitt und Schick, den manchmal das Kleid der großen Dame und immer das ihrer Schneiderin aufweist, stellte sich jedem kundigen Blicke als Verkäuferin in einem großen Modewarengeschäft dar. Auch der Bruder gehörte dem Kaufmannsstand an, auch er war Verkäufer, offenbar in guter Stellung, nach seiner Kleidung zu schließen. Wie seine Schwester die vornehme Dame, so war er bestrebt, den großen Herrn zu spielen, er trug kurz geschnittenes, straff gescheiteltes Haar, einen hellen Jackettanzug mit dazu passendem runden Hute, blendend weiße Wäsche. Einzig aus den zu großen goldenen Manschettenknöpfen, dem falschen Brillanten in der Kravattennadel und aus der Gepflogenheit, den Hut um eine Linie zu tief in den Nacken zu setzen, guckte unverkennbar die Stutzerhaftigkeit hervor. Diese kleinen Schwächen verdarben aber den guten Eindruck nicht, den seine Erscheittung [ ... ] machte. Nicht seiner Mutter Augen allein, auch die [ ... m]ancher vorüberfahrenden Dame ruhten mit Wohlgefallen [auf d]em hübschen Burschen, um dessen etwas vollen Mund eitel Lebensfreude und Schelmerei lag.
Nachlässig in seinen Stuhl zurückgelehnt, klimperte er mit einigen Münzen in der Tasche und sah dabei mit gutmüthigem Spotte zu seiner Schwester hinüber, welche eben ihrem Stuhl eine unsanfte Wendung gab, dadurch mit offenbarer Absichtlichkeit einer bestimmten Ecke des Gartens den Rücken zukehrend.
„Mensch, ärgere dich nicht!“ rief er lachend.
„’s ist unverschämt!" zischte das Mädchen zwischen den Zähnen hervor.
Die Mutter ließ den Strickstrumpf sinken. „Was ist unverschämt, Grete?“
„Ach, Mutter, drüben der Herr Röver glotzt mich mit seinen bösen Augen schon wieder an, als wollte er mich umbringen.“
„Und das Schwesterchen will’s einmal nicht leiden, daß der arme Bursche sie hübsch findet. Warum eigentlich nicht? Kann er dafür, daß seine Augen schwarz sind und nicht blau? Ist er n[icht] im übrigen ein netter anständiger Kerl, der sein gutes Auskommen hat? Gar kein übler Freier, Gretchen!“
„Sein Vater ist im Zuchthaus gestorben!“
„Um so mehr Verdienst, daß er selbst sich so tapfer emporgearbeitet hat! Bedenke auch, der Kassierer Eures Geschäfts! Den Kassierer, Schwesterchen, muß man sich immer zum Freunde halten – schon der Rechenfehler wegen, wenn man einmal ein bißchen zerstreut ist. Bei jungen Damen soll das gelegentlich vorkommen.“
Die Mutter hatte während dieser Zwiesprache ihre Augen in richtigem Instinkt nach der Gegend gewandt, wohin der Rücken ihrer Tochter wies, und dort an einem runden Tischchen einen alleinsitzenden jungen Mann entdeckt, der seine großen Glieder unter ihrem forschenden Blick auf einen möglichst engen Raum zusammenzuziehen trachtete und sich dem Anschein nach am liebsten hinter seinem winzigen Tische verkrochen hätte. Dabei sah aber sein Gesicht merkwürdigerweise eher drohend aus als schüchtern – ein wohlgebildetes, durchaus nicht häßliches Gesicht, dem jedoch schnurgerade pechschwarze Brauen, die an der Nasenwnrzel zusammenliefen, und ein Paar langgeschlitzter, tiefliegender Augen etwas Wildes, Trotziges verliehen.
„Grete braucht sich keinen Menschen zum Freunde zu halten,“ erwiderte die Mutter jetzt streng auf des Sohnes Rede. „Nicht einmal im Scherze will ich eine solche Ansicht von Dir äußern hören, Julius! Und sie hat auch ganz recht, wenn sie es vermeidet, in irgend jemand, der ihr zuwider ist, trügerische Hoffnungen zu erwecken. ‚Thue recht und scheue niemand!‘ das ist der Grundsatz Eures seligen Vaters gewesen, und ich hoffe, es soll der Grundsatz meiner Kinder bleiben bis an ihr Lebensende. Dann braucht Ihr nach niemandes Gunst zu fragen. Niemals soll man sein Leben abhängig machen von dem guten Willen eines Fremden, und wär’ dieser der Bravste und Beste. Darum hab’ ich es auch nach Eures Vaters frühem Tode meine eifrigste Sorge sein lassen, daß Ihr beizeiten selbständig würdet
[725]Sie kam auf schwarzem Todesflügel,
Die Würgerin, im Schreckenslauf,
Sie kam und häufte Leichenhügel
Erbarmungslos und grausig auf.
Ein Schrei der Noth durchhallt die Lüfte
Dem fürchterlichen Sensenmann,
Und immer neue, neue Grüfte
Reih’n sich den kaum gefüllten an.
Da gilt’s, zu helfen und zu retten,
Die Perle Deutschlands ist bedroht,
Sie seufzt in der Vernichtung Ketten
Und jeder Seufzer ist ein Tod.
Vieltausendfach die Thränen fließen –
Die ganze Stadt im Trauerkleid!
Wer möchte kalt sein Herz verschließen
Vor solchem grenzenlosen Leid?
Ihr alle, die ihr frei von Sorgen,
Die ihr gesegnet und beglückt,
Wenn ihr an jedem frohen Morgen
Ans Herz die theuren Kinder drückt:
Gedenkt der Kleinen, die da darben,
Die elternlos, verlassen sind,
Gebt Korn aus euren vollen Garben,
Bannt das Gespenst: ein hungernd Kind!
Ihr wißt ja, was der große Meister,
Der stets sein Brot den Armen brach,
Als Himmelslohn im Reich der Geister
Den Seinen zur Verheißung sprach:
Wer sich die Krone will verdienen –
Die Nächstenliebe zeigt die Bahn;
Was ihr dem letzten unter ihnen
Gethan, das habt ihr mir gethan!
Auch du, dem nur ein stillbescheiden,
Geringes Maß von Erdenglück,
Du fühlst bei manchem eignen Leiden
Die fremde Noth – bleib’ nicht zurück!
Wer niedrig war, der wird erhoben,
Wo die Vergeltung Palmen flicht,
Der Witwe Heller wird dort oben
Am Thron des Herrn zum Goldgewicht!
Und nur kein Wort aus kaltem Munde,
Was hier versäumt und dort gefehlt –
Wir hören nur die Schreckenskunde,
Daß Hamburg sich zu Tode quält.
Wir sehen nur im deutschen Volke
Das festgeeinte Vaterland
Und reichen durch die Wetterwolke
Den Brüdern unsre Rettungshand!
O könnt’ ich doch vor allen Thüren,
Ein Trauerbarde, florumhüllt,
Mit meinem Lied die Herzen rühren,
Bis sie von Mitleid ganz erfüllt –
Dann brächte jeder seine Gabe,
Dann tönte hell ins Land hinein
Das Wort aus einem theuren Grabe:
„Das ganze Deutschland soll es sein.“
Adolf Ebeling. [726] und selbsterworbenes Brot essen könntet; einzig darum bin ich Deinem Eintritt in den Kaufmannsstand nicht entgegen gewesen, Julius, weil jenes Ziel im Kaufmannsstand früher und vollständiger von Dir erreicht werden konnte, als wenn Du gleich Deinem seligen Vater ein Beamter geworden wärest. Dein Vater hat vier Kassen unter seiner Hand gehabt, er genoß das Vertrauen seiner Vorgesetzten wie kein zweiter, und wäre er nicht in der Blüthe seiner Jahre von uns genommen worden, man würde ihm als Auszeichnung den Titel ‚Kommissar‘ verliehen haben. Und das Rechtthun ist ihm nicht immer leicht geworden, das glaubt nur! Die Versuchung ist auch an ihn herangetreten wie wohl an jeden armen Teufel, dem große Summen fremden Geldes durch die Hände gehen. Da war ein Assessor, ein hübscher lustiger Mensch und seiner Mutter einziger Sohn, nicht schlecht, nur der Spielteufel hatte ihn erfaßt – der kam eines Tags zum Vater und raunte ihm zu, er wolle eine Anleihe bei der Kasse machen, wenn sie dieselbe miteinander verschlössen, wie ihr gemeinsames Amt war. Auf eine einzige Nacht nur wolle er das Geld haben, morgen früh sei es wieder am Platze, und wenn der Vater ein Auge zudrücken wolle, so solle ihm das hundert Thaler einbringen. Wir konnten das Geld brauchen dazumal, das wußte der Versucher auch, denn der Hunger saß bei uns zu Tisch und die Grete lag am Scharlach auf den Tod danieder, wir aber wußten nicht, womit Arzneien und Doktor bezahlen. Dazu waren wir in Schulden gerathen, weil der Vater Euren Onkel hatte freikaufen müssen, den sein Prinzipal vor Gericht stellen wollte, da er Unterschlagungen und andere faule Geschichten gemacht hatte. Dem Vater ging es an die Ehre, daß ein Meermann und vollends sein Bruder sollte im Zuchthaus sitzen, er raffte unser bißchen Erspartes zusammen, entlehnte, was noch fehlte, ersetzte das Entwendete und schickte den heillosen Menschen nach Amerika, wo er dann gestorben und verdorben ist. Die Versuchung war also groß genug, aber Euer Vater schlug dem Herrn sein sauberes Begehren trotzdem rund ab und kam zu mir nach Haus und wagte kaum, die Augen aufzuschlagen. Und wie er die Grete sah, die in der Fieberhitze sich in ihrem Bettchen wälzte, und den leeren Tisch und mein vergrämtes Gesicht, da liefen ihm die hellen Thränen über die Wangen. Dann erzählte er mir die Geschichte und schloß, immer noch mit Thränen in den Augen: ‚Verzeih’ mir, Anna, vielleicht war’s nicht gut gethan gegen Dich und die Kinder, aber – ich konnte nicht anders!‘ Ich jedoch fiel ihm um den Hals und rief: ‚Dafür sei Gott gelobt, daß Du nicht anders konntest, und ich will Dir’s in Ewigkeit danken. Lieber in Ehren zur Grube fahren, als leben in Schande und Sünde!‘ Der junge Mensch aber, der Euren Vater in Versuchung führte, hat ein tranriges vorzeitiges Ende genommen durch eigene Hand, nachdem er einen Freund, der sich ihm willfähriger erwies als Euer Vater, mit sich ins Verderben gestürzt hatte.“
Wäre die Frau nicht so vertieft gewesen in die Ausmalung einer Vergangenheit, die sie nicht müde wurde, ihren Kindern immer neu vor Augen zu halten, sie hätte bemerken müssen, daß des Sohnes Blick nicht mehr so groß und offen auf ihrem Gesicht ruhte wie vorhin, daß eine leise Röthe seine Wangen färbte und daß er unsicher über das Kaffeegeschirr hinweg nach der Straße sah. Dort ging eben ein Trupp junger Leute vorüber mitten zwischen den Wagen hindurch. Einer von ihnen war einen Augenblick an der Einfriedigung des Gartens stehen geblieben. Sein Blick begegnete flüchtig dem des jungen Meermann, er zog seine Börse hervor, öffnete sie, schien darin zu suchen und drehte sie dann nach allen Seiten, so daß, wenn Münzen darin gewesen wären, sie unfehlbar hätten herausfallen müssen. Und da keine herausfielen, zuckte er die Achseln, lachte und lief, ein Liedchen singend, den anderen nach. Mit scheuem Zögern blickte der junge Mann nun wieder auf seine Mutter. Wie sie schwelgte in der Erinnerung an den siegreich durchgefochtenen Kampf mit der Sünde! Welch strenges Antlitz, jeder Zug wie gemeißelt – das feste breite Kinn, die scharfen grauen Augen, der energische Mund! Sie mochte ihres Weges allzeit sicher gewesen sein, und von all den Furchen in ihrem Gesicht hatte der Zweifel keine gegraben und keine die Reue. Zum ersten Male fiel dem Sohne mit Schrecken auf, wie anders er selbst geartet sei, daß weitgreifende Wünsche, unbezähmbare Leidenschaften in seinem Herzen brannten, in seinem Urtheil Recht und Unrecht durcheinander wirrend, die sie auseinander hielt, gemächlich und sicher wie die weiße und schwarze Wolle der Strümpfe, an denen sie strickte.
Aber gewaltsam schüttelte er das unbestimmte Grauen ab, das ihn vor seinem eigenen Wesen beschleichen wollte, und da die Mutter eine Antwort zu erwarten schien, erwiderte er leichthin:
„All dem, was Du sagst, widerspreche ich nicht, Mutter. Allein Röver gilt für einen tüchtigen Kaufmann, einen rechtschaffenen Menschen. Die Grete braucht ihn, bloß weil er sie hundert anderen vorzieht, nicht gerade schlechter zu behandeln als einen Stiefelputzer. Thut der arme Kerl Dir denn gar nicht ein bißchen leid, Schwesterchen?“
„Leid! Nach der Unsumme von Aerger, die ich täglich wegen seiner Zudringlichkeit ausstehen muß! Den ‚Augen-Anton‘ haben sie ihn im Geschäft geheißen – meinst Du, daß es erfreulich ist, als ‚Augen-Antonie‘ nebenher zu laufen und sich mit dem greulichen Teckel, dem Waldmann, den er auch heute wieder mitgeschleppt hat, in seine Gunst zu theilen?“
In diesem Augenblick kamen zwei Mädchen durch den Garten geschlendert, sehr elegant gekleidet, mit ungeheuren Hüten und hohen Sonnenschirmen. Grete stand auf und rief im Gehen der Mutter entschuldigend zu: „Fräulein Meier und Fräulein Rothart aus unserem Geschäft. Man muß ihnen doch guten Tag sagen.“
An der Art, wie das geschah, sah man, daß sie es gern that. Die Vertraulichkeit, die durch die gleiche Beschäftigung in einem und demselben Arbeitsraum erzeugt wird, sprach aus dem Händeschütteln, dem Lachen.
Zwölf Stunden von jedem ihrer Tage verlebten die Mädchen Seite an Seite. Jede wußte von der andern so ziemlich alles – da war man um Rede und Antwort nicht verlegen; die Freundschaften, die Intriguen, die Liebeleien – der Stoff riß nicht ab. Ob Fräulein Meermann den Bräutigam der ersten Direktrice schon gesehen habe? Ein richtiger Bräutigam mit einem Ringe und ehrlichen Absichten. Nun, er war danach! Die beiden hatten das Glück gehabt, dem Paare zu begegnen.
Mitten in der Erörterung dieser interessanten Beobachtung kniff Fräulein Rothart, eine hochgewachsene Blondine, die über der Menschen Häupter hervorragte und daher über das Gedränge rings wegsah, ihre Gefährtin in den Arm. „Sehen Sie doch da drüben – der ‚Augen-Anton!‘“
Aber Frida Meier ließ ihre großen dunklen Augen gleichgültig an dem Kassierer vorüberschweifen zu dem Tische, von dem Grete gekommen war.
„Wohl Ihr Bruder, Fräulein Meermann? Er hat Schick, der junge Mann. Wird wohl bald jemand anders als Mutter und Schwester am Sonntag auszuführen haben.“
Sie kam von auswärts, aus der lustigen Stadt Köln, und ihre niederrheinische Aussprache klang gemüthlich zwischen dem nordischen Hochdeutsch der Freundinnen.
„Ach nein,“ erwiderte Grete, „das hat gute Wege. Unser Julius ist zu gescheit, um sich zu verplempern; auch will er hoch hinaus.“ Und als sei ihr darum zu thun, den Beweis ihrer gänzlichen Sorglosigkeit in diesem Punkte zu liefern, winkte sie den Bruder herbei. „Mein Bruder Julius .... Fräulein Rothart – Fräulein Meier, die Dich gern kennenlernen möchte.“
Der junge Mann sagte etwas Verbindliches. Unterdessen stieß die Rothart Gretchen an. „Fräulein Meermann, da kommt ’was für Sie!“
In der That, durch die Anwesenheit des jungen Meermann kühn gemacht, schlängelte sich Herr Röver heran – das Verlangen seines Herzens hatte den Sieg über seine Schüchternheit davongetragen, und plotzlich stand er mit höflichem Gruße mitten unter seinen Kolleginnen.
„Ich habe die Ehre, Ihnen einen guten Tag zu wünschen, meine Damen – Herr Meermann! Es – es – ja, es ist ein schöner Nachmittag.“
„Sehr schön.“ Frida zupfte verstohlen die Rothart am Kleide und that, als müßte sie ersticken vor unterdrücktem Lachen.
Aber Anton Röver schaute über die Spötterin hinweg Gretchen ins Gesicht, ob dort nicht ein Schimmer von Gnade aufleuchte, Verzeihung für seine Annäherung zu lesen sei. Seine finsteren Augen zeigten dabei ganz denselben wunderlichen Ausdruck von großem Bangen, gemischt mit grenzenloser Ergebenheit, wie die seines vierfüßigen Freundes, wenn dieser beim Zuckernaschen ertappt wurde.
[727] „Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Fräulein Meermann.“
„O gewiß – wie immer.“ In ihren grauen Augen lag keine Spur von Entgegenkommen und ihre Stimme klang eisig.
Der Kassierer fuhr sich über die Augen. „Der Spitzenstoff, den Sie zu kaufen wünschten, Fräulein Meermann – ich habe mit Herrn Franz geredet, er würde ihn seinem Personal zu zwei Dritteln des Ladenpreises ablassen.“
„Danke sehr; darüber können wir ja morgen im Geschäft sprechen. Aber meine Mutter legt ihre Arbeit zusammen, es wird Zeit zum Aufbruch.“
„Ja, es ist wahr, es dunkelt schon. Fräulein Meermann, vielleicht“ – er athmete schwer – „vielleicht erlaubt Ihre verehrte Frau Mutter, daß ich Sie nach Hause begleite?“
Frida tanzte beinahe vor Vergnügen, während Grete innerlich knirschte vor Zorn „Da müssen Sie eben meine Mutter selbst fragen, Herr Röver. Was mich angeht, ich möchte mir gern noch etwas Bewegung machen und mich meinen Freundinnen hier anschließen, wenn sie es erlauben. Entschuldigen Sie einen Augenblick, meine Damen!“
Röver ließ den Kopf hängen wie ein gescholtenes Kind, als jedoch Grete jetzt zu ihrem Tische zurückschritt, um sich von der Mutter zu verabschieden, war er mit zwei Schritten wieder an ihrer Seite. Die Menschenwellen schlugen hinter ihnen zusammen, in dem Gewühl waren sie allein.
„Fräulein Meermann, warum sind Sie so unfreundlich gegen mich?“
Sie antwortete nicht, sondern schritt weiter.
„Warum kränken Sie mich, wo Sie können? Ich habe Ihnen doch nichts zuleide gethan und habe nur den einen Wunsch, Ihnen Freude zu bereiten.“
„Wirklich?“ Sie blieb stehen und sah ihm zornig in die Augen. „Nun, dann bereiten Sie mir die Freude und lassen Sie mich meiner Wege gehen! Kennen Sie mich nicht, kümmern Sie sich nicht um mich!“
Er schüttelte den Kopf. „Ich weiß ja, daß Sie mich nicht liebhaben können, und verlange auch so viel nicht. Aber warum wollen Sie mir das Glück nehmen, in Ihrer Nähe zu sein? Warum stoßen Sie mit solcher Grausamkeit einen Menschen von sich, der es von Herzen gut mit Ihnen meint?“
„Ihre freundlichen Gesinnungen gegen mich sind gewiß sehr dankenswerth,“ erwiderte Grete rauh, „nur bringen sie mir Schaden statt Nutzen.“
„Schaden? Wie sollte meine uneigennützige Verehrung Sie in Schaden bringen, Fräulein Meermann?“
„Nun denn,“ rief Grete, außer sich gebracht durch seine sanfte Hartnäckigkeit, „wenn ich einmal offen reden soll – begreifen Sie denn nicht, daß Sie mich lächerlich machen durch Ihre unaufhörlichen Huldigungen?“
„Lächerlich? O, Fräulein Grete, ich bin ja gewiß nicht von mir selbst eingenommen – aber daß meine ehrliche Neigung lächerlich machen könne, das – das habe ich freilich nicht gewußt . . . und das kann auch Ihr Ernst nicht sein. Nicht wahr, Sie haben das nicht so schlimm gemeint?“
Grete antwortete ihm nicht mehr – sie drehte ihm kurz den Rücken und trat zu ihrer Mutter. Was brauchte er solch jämmerlich weichen Ton anzuschlagen! Er hätte ihr grob antworten sollen auf ihre Grobheit, dann wären sie miteinander fertig gewesen, wie es das Beste war. Diese Widerstandslosigkeit war unausstehlich! Als Kind schon hatte sie ihre Katze nicht schlagen können, wenn die sich demüthig duckte, dem drohenden Strafgericht sich unterwerfend, es falle, wie es wolle. Und nun hatte dieser feige Mensch fast nicht anders vor ihr gestanden! Aber sie war nicht mehr das thörichte Kind, das sich durch sklavische Unterwerfung entwaffnen ließ – mochte er seine verdiente Strafe haben!
Röver stand mit seinem Hunde allein im Gewirr der Kommenden und Gehenden: die Menge drängte und stieß den Regungslosen, der sich jetzt mit dem Menschenstrom zum Ausgang des Gartens treiben ließ. „Lächerlich?“ murmelte er wehmüthig vor sich hin, „lächerlich?“ Und dabei starrten seine Augen mit einem Ausdruck in die Weite, als wollte er jemand erwürgen.
Am Ende des Gartens traf er mit Frau Meermann und deren Sohn zusammen. Der junge Mann war eben noch einen Augenblick aufgehalten worden. Jener Bursche, der vorhin das Manöver mit seiner Börse ausgeführt hatte, war ihm in den Weg getreten.
„Nun, wie wird’s, Meermann? Sieht man Sie diesen Abend bei Dachinger? Oder wird heute noch weiter guter Sohn gespielt?“
„Um Neun, wie gewöhnlich,“ hatte Julius geantwortet, unruhig umherblickend, und war hastig vorüber gegangen. Dieser überlästige Frager! Was brauchte er ihn jetzt und hier zu behelligen! Um Neun fing sein zweites Leben an – vorerst begleitete er als wohlerzogener Sohn die Mutter nach Hause. Die eine Hälfte seines Tages brauchte von der anderen nichts zu wissen.
Es war ihm nicht ganz genehm, daß Röver, den er von einem kaufmännischen Verein her kannte, sich ihnen anschloß. Die Gegenwart eines Fremden erschwerte es ihm, sich zeitig frei zu machen. Frau Meermann dagegen begrüßte den Kassierer äußerst höflich – keine Mutter verargt es im Grunde einem jungen Manne, wenn er ihre Tochter liebenswürdig findet.
„Ich hörte vorhin Ihren Namen, Herr Röver; Sie sind Kassierer in dem Geschäft, in dem auch meine Tochter angestellt ist, nicht wahr?“
Und dann sprach sie zu ihm von dieser Tochter, wie sie ihre Freude und ihr Stolz sei, früh selbständig geworden, sehr selbständig in allen Dingen, so daß sie sich nicht einmal von der Mutter in ihre Angelegenheiten dreinreden lasse. Während dieser Auseinandersetzungen ging Anton Röver mit den gemessenen Bewegungen, die großen schlanken Menschen eigen und kleidsam sind, gesenkten Hauptes neben der geschwätzigen Dame her, Waldmann, die Nase an den Fersen seines Herrn, wackelte geduldig hinterdrein, und einer war so stumm wie der andere.
Nur eiumal hob der Kassierer den Blick, als die Frau von der Geradheit ihres Mannes zu sprechen anfing und daß ihr die Freude geworden sei, ihre beiden Kinder in die Fußstapfen des Vaters treten zu sehen. Da sah er die glückliche Mutter mit seinen finsteren Augen so drohend an, daß sie erschrak und sich im stillen gestand, der junge Mensch, der ihr bisher in seiner Sanftmuth ganz wohl gefallen hatte, besitze freilich einen Blick, vor dem ein junges Mädchen sich fürchten könne.
An der Thür des Meermannschen Hauses verabschiedete sich Röver nicht, wie Julius gehofft hatte.
„Wenn es Ihnen recht ist, gehe ich einen Augenblick mit Ihnen hinauf, Herr Meermann; ich habe Ihnen etwas mitzutheilen, was sich nicht auf offener Straße abmachen läßt.“
„Aber selbstverständlich! Bitte!“
Frau Meermann bewohnte mit ihren Kindern ein kleines verwittertes Haus, das früher die Beamtenwohnung ihres Mannes gewesen war. In Anbetracht der guten Führung des Verstorbenen hatte man seine Witwe in Gnaden zu billigem Preise dort belassen. Das Haus, jedenfalls einige hundert Jahre alt, hatte einen ungeheuren Flur und eine breite Treppe mit schönem Eichengeländer. Im ersten und einzigen Stockwerk war, den Ansprüchen der Neuzeit entsprechend, mit Hilfe eines Lattenverschlags eine Art Vorplatz abgetheilt; die Küche freilich und die Kammer des Sohnes lagen außerhalb.
Die Kammer war ein halbdunkler Raum. Das einzige Fenster öffnete sich auf einen engen schmutzigen Hof, durch dessen breites offenstehendes Thor man einen ganzen Rattenkönig ähnlicher Höfchen erblicken konnte. Die Einrichtung des Junggesellenstübchens verrieth deutlich den grundverschiedemen Charakter der beiden Personen, durch deren Zusammenwirken sie zustande gekommen war. Das mit schneeweißer Decke verhüllte Bett, die helle saubere Tapete, der Waschtisch mit seinem weißen Oelfarbenanstrich statt der Marmorplatte, die duftigen Gardinen am Fenster – das alles verdankte seinen Ursprung sichtlich Frau Meermanns fleißigen Händen und ihrem klaren reinlichen Sinne. Den Schreibtisch am Fenster dagegen, der mit wenig Papieren, aber vielen zum Theile sehr „schneidigen“ Statuetten und mit Parfümfläschchen bedeckt war, hatte ohne Zweifel Julius hinzugefügt.
Als artiger Wirth bot er seinem Gaste einen Stuhl, während er zugleich die Manschetten losknöpfte und Anstalten traf, sich die Hände zu waschen und das Haar zu kämmen für den zweiten Ausgang heute abend. Er hatte nicht viel Zeit übrig, das mochte der andere sich gesagt sein lassen. Röver aber saß dickfellig auf seinem Stuhle, kraute Waldmanns Ohren, sah verteufelt ernst drein und schwieg.
[728] „Sie wollten mir etwas mittheilen,“ nahm Julius endlich das Wort. „Und fast kann ich mir’s denken. Wenn’s wegen meiner Schwester sein sollte, armer Freund, so wäre es besser, Sie sparten sich die Mühe. Das Mädel ist uns längst über den Kopf gewachsen. Es thut mir leid, Röver, ich hätte Ihnen Besseres gewünscht, wirklich! Aber fangen Sie einmal etwas an bei einem widerspenstigen Ding wie die Grete. Nun, zwischen uns, nicht wahr, bleibt es beim alten?“
„Es handelt sich nicht um Ihr Fräulein Schwester; was sollten Sie mir dabei helfen? Ich wollte Sie um etwas anderes bitten.“
„Um so besser, wenn die Grete nichts damit zu schaffen hat. So bleibt doch Hoffnung, daß ich Ihnen dienen kann.“
„Ich wollte Sie bitten, meine Entschuldigung zu übernehmen, weil ich morgen verhindert bin, die ‚Konkordia‘ zu besuchen.“
Die „Konkordia“ war der kaufmännische Verein, dem beide angehörten.
Julius sah seinen Gast verblüfft an. Warum konnte er ihm das nicht im Beisein der Mutter sagen? Was bedurfte es dazu überhaupt seiner Vermittlung? Ein Brief hätte dieselben Dienste gethan. Indessen sagte er artig zu, in der Erwartung, der lästige Gast werde nun gehen. Doch Röver ging nicht. Er nahm eine der hochgeschürzten Statuetten vom Schreibtisch und betrachtete sie angelegentlich. „Ihre Frau Mutter,“ sagte er dabei langsam, „ist eine vortreffliche Frau.“
„Jawohl,“ nickte Julius, der nicht begriff, wo das hinaus wollte.
„Eine Frau von strengen Grundsätzen, die Menschen und Dinge furchtbar ernst nimmt, viel ernster, als man das heutzutage gewohnt ist. Die Ehre ihres Namens ist ihre Religion. Wenn je ein Makel auf diesen Namen fallen sollte – sie ist noch aus einer Zeit, in welcher man an dergleichen starb – ich glaube gewiß und wahrhaftig, das Herz würde ihr brechen –“
Julius trat aufhorchend einen Schritt näher.
„Nun, das ist ja natürlich nur so ein Gedanke,“ fuhr Röver rasch fort. „Sie hat das Glück, mit vollem Vertrauen auf ihre Kinder blicken zu dürfen, auf ihre beiden Kinder.“
„Ja, ja freilich – aber zum Kuckuck, was meinen Sie eigentlich?“
„O, mir fiel nur ein, daß nicht alle Mütter so glücklich sind. Sie kennen den jungen Habermann –“
„Ich?“
„Nun, gewiß. Sprach er nicht vorhin mit Ihnen im Konzertgarten? Ich habe mich doch wohl nicht getäuscht?“
„Ja – es mag wohl sein . . . Was ist’s denn mit ihm?“
„Er ist unter die Spieler gegangen, wie ich höre. Auch soll ihn sein voriger Prinzipal wegen Unterschlagung entlassen haben.“
„Das glaube ich nicht! Davon glaub’ ich kein Wort! Wirklich, ich begreife nicht, wie Sie, Röver, sich zum Sprachrohr für solch ungeheuerliche Beschuldigungen hergeben mögen. Wenn nur die Hälfte von dem richtig wäre, was über Habermann erzählt wird, so würde er ja längst nicht mehr frei herumlaufen. Aber weil er munter ist, sich gern einen guten Tag macht, im Leichtsinn wohl auch einmal über die Schnur haut, dichten die dummen Menschen ihm gleich das Häßlichste an!“
„Ja, das Häßlichste ist eben, daß er einen braven thörichten Jungen mit in seine nichtsnutzigen Streiche verwickelt hat und daß der nun statt seiner die Suppe ausessen muß.“
Julius zerknüllte nervös sein Handtuch zwischen den Händen. „Und ich glaub’s nicht! Nicht eine Silbe von dem ganzen Geschwätz glaub’ ich!“
Röver stand bedächtig auf. „Jedenfalls ist er von allen kaufmännischen Vereinen ausgeschlossen worden, und auf einen bloßen Verdacht hin pflegen die Vorstände dieser Vereine nicht vorzugehen. Doch was ereifern wir uns! In keinem Falle kann es Ihnen schaden, wenn Sie sich vorsehen. Empfehlen Sie mich Ihren Damen!“
In diesem Augenblick näherten sich rasche feste Schritte der Thür, eine Hand klopfte. „Julius, Julius! Bist Du zu Hause?“ Beim Klange der wohlbekannten Stimme verlor Anton Röver all seine Ruhe. „Ich möchte Ihrem Fräulein Schwester ungern begegnen – sie könnte denken, daß ich absichtlich . . . Aber es ist wohl keine Möglichkeit, auszuweichen?“
„Doch, doch!“ erwiderte Julius, froh, seinen unbequemen Besuch endlich loszuwerden. Und den großen Wandschrank in der Tiefe des Zimmers öffnend, drückte er auf eine Feder an dessen Rückwand. Eine schmale Thür sprang auf und einige Treppenstufen wurden sichtbar, die in undurchdringliche Finsterniß hinabzuführen schienen. „Hier über dieses Hintertreppchen können Sie ungesehen entwischen; es mündet auf den Hof. Ja, ja, staunen Sie nur! Unsere Väter sind bei den Füchsen in die Schule gegangen. Kein alter Bau, der nicht seinen Nothausgang hat. Diesen da hab’ ich einmal durch Zufall entdeckt.“
Röver heftete seine schwarzen Augen durchbohrend auf seinen Wirth, dann entfernte er sich mit einer stummen Verbeugung. Erleichtert wandte sich Julius in die Stube zurück, nachdem er den Schrank vorsichtig abgeschlossen hatte.
„Gretchen, ich bin allein – Du kannst hereinkommen!“
„Mit wem sprachst Du denn eben?“ fragte sie eintretend.
„Mit einem armen Sünder, der bei Deinem Nahen in unser Mausloch dort schlüpfte. Grete, Grete, allzuscharf macht schartig! Die hübschen Mädchen sind nicht auf der Welt, damit brave Bursche vor ihnen die Flucht ergreifen.“
„Wenn Du täglich so viel spöttische Blicke auf Dich gerichtet sehen müßtest –“
„Ach was, bei diesen Blicken spielt der Neid die Hauptrolle. Denn Röver ist hübsch, solid, hat eine Zukunft, mit einem Worte – er ist eine Partie.“
„Du wirst nicht müde, mir das zu wiederholen. Nachgerade möchte ich wissen, was denn Dich dieser Herr Röver angeht.“
„Röver – nicht viel; aber mein Schwesterchen geht mich etwas an. Du machst Dich unbeliebt durch Dein schroffes Wesen und entfremdest Dir die Leute, auf die Du doch auch angewiesen bist.“
„So, thue ich das? Nun, es wäre gewiß schön, wenn man immer aufrichtig und höflich zugleich sein könnte. Aber mir ist diese Gabe nun einmal nicht zu theil geworden –“
„Der Mensch kann alles, was er will, Grete,“ entgegnete Julius streng und mit Nachdruck, und zum Beweis für seinen pathetischen Ausspruch raffte er den Rest seines Monatsgehaltes zusammen, steckte ihn in seine Geldtasche und setzte den Hut auf. „Ueberlege Dir, was ich gesagt habe, und entschuldige mich bei der Mutter, ich habe eine Verabredung für den Abend. Und, höre, Du könntest wohl die Thür hier etwas einölen. Es ist nur, damit ich die Mutter nicht aufwecke, falls ich etwas später als gewöhnlich heimkommen sollte.“ Damit ging er.
Sein nächstes Ziel war die Dachingersche Weinstube. Habermann und zwei andere erwarteten ihn dort, um ein kleines Tischchen am Fenster sitzend. Es war ein sehr geschniegelter Bursch, der Fritz Habermann, und wenn auch alles in seinem Gesicht schief stand, Augen, Nase, Mund und Ohren, so sah er deswegen nur um so pfiffiger aus. Auch an „Schneid“ fehlte es ihm nicht; wenigstens führte er, die Ellbogen auf dem Tische, augenblicklich eine so laute Unterhaltung, daß die übrigen Gäste ärgerlich zu ihm herübersahen und Julius, dem jedes Auffallen zuwider war, einen Augenblick zögerte, sich zu ihm zu bekennen. Doch Habermann hatte ihn schon erspäht und winkte ihn heran.
„Gut, daß Sie endlich kommen! ’s ist zu öde zwischen den Kaffern hier! Müssen heute noch ’was Putzlustiges unternehmen. Und nun rücken wir aus, was?“
Meermann war’s zufrieden, schon um aus den Augen der ehrbaren Bürger zu kommen, von denen viele ihn kannten.
So traten sie ihre Wanderung an, und es wäre für einen Unbetheiligten merkwürdig gewesen, zu sehen, wie allgemach, Stufe um Stufe und ohne daß einer von ihnen eine bestimmte Absicht verfolgte, die Kneipen, die sie betraten, ärmlicher, abgelegener, zweifelhafter wurden. Endlich strebte die kleine Gesellschaft lärmend einer schmutzigen Spelunke zu, in welcher diese Vergnügungen für sie mit einem „harmlosen Spielchen“ zu endigen pflegten. Ehe aber das Ziel erreicht war, zog Meermann seinen Freund Habermann beiseite.
„Sie wissen, ich bin Ihr Schuldner. Und heute nachmittag schienen Sie’s eilig zu haben mit der Rückzahlung. Ich habe mitgebracht, was ich noch besitze, hier, nehmen Sie! Den Rest erhalten Sie am Ersten des nächsten Monats. Rechnen wir also ab!“
Aber Habermann schwenkte seinen linken Arm, der kürzer
[729][730] war als der rechte, stolz ablehnend durch die Luft. „Zum Kuckuck mit den Geschäften! Werden doch Spaß verstehen! Seien Sie kein ängstlicher Philister! Ich bin kein solcher Judas, daß ich einen braven Kerl ausziehe just in dem Augenblick, da er sich einen vergnügten Abend machen will. Und im übrigen habe ich Ihre Handschrift, das genügt.“
Julius dachte an Rövers Warnung und blieb standhaft. „Nehmen Sie Ihr Geld, wir sind nachher um so vergnügter!“
Allein zu dem, was ihm nicht paßte, brachte man Habermann nicht so leicht. Er erfand tausend Possen, um die Abrechnung hinauszuschieben. Am Thurmhahn der Martinskirche wolle er seine Schuld einkassieren, versicherte er zuletzt ernsthaft.
Julius wurde ungeduldig. „Unsinn, Habermann! Nehmen Sie Ihr Geld! Ich bin bloß deshalb noch einmal hergekommen, um Sie zu befriedigen. Die Rücksicht auf meine Mutter, auf meinen Prinzipal, der mir sein volles Vertrauen schenkt, erfordert gebieterisch, daß ich wenigstens vorläufig etwas solider werde. Also hier – nehmen Sie und geben Sie mir Quittung!“
„Am Thurmhahn der Martinskirche, sag’ ich Ihnen, oder gar nicht. Was geht mich Ihr Bekehrungsdusel an!"
„Und was mich Ihr verrückter Spaß mit dem Thurmhahn, zu dem ja kein Mensch hinaufkann!“
„Nicht kann? Oho, Freundchen! Was geben Sie mir, wenn ich dem Hahn auf den Schwanz tret?“
„Nun lassen Sie aber die Geschichte!“
„Wetten wir? Zehn Mark, wenn ich’s fertig bringe, gegen zwanzig, wenn’s mißlingt. Einverstanden? Die Herren sind Zeugen.“
„Es wäre die reine Tollheit, und wenn Sie das Genick brechen . . .“
„Was geht mein Genick Sie an! Es gehört mir, ist mir vererbt von Vater und Mutter – leider auch so ziemlich das Einzige, was sie mir vererbt haben. Gilt’s also?“
„Nun denn, meinetwegen.“
Sie schlugen die Richtung nach der Martinskirche ein. Habermann führte sie durch ein Nebengäßchen auf einen Hofraum, wo ein kleiner, der Gemeinde gehöriger Schuppen stand, der zur Aufbewahrung von allerlei Gerümpel diente. In den Lichtstrahlen der gegenüber stehenden Straßenlaterne schimmerte ein goldiger Gegenstand aus der halb offenstehenden Thür hervor. Habermann stieß die Thür vollends auf, kletterte über die hohe Schwelle und löste den goldglänzenden Gegenstand aus dem ihn umgebenden Dunkel.
„Der Thurmhahn der Martinskirche. Bitte, meine Herren, überzeugen Sie sich! Ich habe die Ehre, ihm hiermit auf den Schwanz zu treten. Es war, wie Sie sich erinnern werden, keineswegs ausbedungen, daß er sich dabei oben auf dem Thurmknauf befinden müsse.“
Man hatte den Hahn gestern abend zum Zwecke einer Ausbesserung herabgenommen, und der Schalk wußte zufällig darum. Diejenigen, welche der Handel kein Geld kostete, lachten von Herzen darüber, während Habermann triumphierend den Hahn an seine Stelle zurückbrachte. Nachlässig den Staub von seinen Kleidern klopfend, kehrte er wieder.
„Also, Meermann, Sie schulden mir zehn Mark; ich schreib’s zu dem Uebrigen.“ Und wirklich trug er im Scheine der Laterne die neue Schuld des Freundes neben die alten in sein Buch ein, und Julius war so verblüfft und gereizt durch die Uebertölpelung, daß er ganz vergaß, auf sein Verlangen von vorhin zurückzukommen. In mühsam verhaltenem Grolle folgte er den Kameraden, die es jetzt eilig hatten, das ausgemachte Schanklokal zu erreichen. Dort entwickelte sich bald eine ausgelassene Lustigkeit; Meermann, der seine Empfindlichkeit nicht überwinden konnte und doch auch nicht zeigen wollte, wurde aufgeregt; er sprach mehr als sonst und lauter, trank hastig, lachte ohne Aufhören. Und dann kamen die Karten auf den Tisch, harmlose Skatkarten. Der Wirth, ein fettiges rundes Männchen, duldete kein Glücksspiel in seinem Hause – man kann aber auch im Skat recht nett verlieren, besonders wenn ein verborgener Zorn in einem kocht und zu unmöglichen Spielen reizt. Und wie die Nacht vorrückte, wurde der tugendhafte Wirth müde, grausam müde! Erst nickte er hinter seinem Schenktisch ein und zuletzt schnarchte er ganz laut, was kein Gesetz der Welt einem Wirthe verbietet. Auch war es gewiß nicht die Schuld des Schlafenden, wenn hinterlistige Menschen die kurze Zeit seiner beschaulichen Ruhe dazu benutzten, die ehrsamen Skatkarten, welche er geliefert hatten zu frevelhaftem Tempelspiel zu mißbrauchen. Er sah es ja nicht, seine Augen waren geschlossen, und Julius Meermann, welcher die seinigen weit offen hatte, beachtete es kaum: blieb doch auch hier die Moglichkeit, zu gewinnen. Aber er verlor.
Endlich, als das graue Tageslicht sich mit dem rothbrennenden Gaslicht und dem gelblichen Staub und Qualm der Stube zu einer traurigen Mißfarbe mischte, fuhr er, wie aus schwerem Traume erwachend, mit dem zerknitterten Batisttaschentuch über sein bleiches Gesicht und murmelte: „Sie wissen, ich bin ein ehrlicher Mann, Habermann, ich halte Wort. – Sie werden mich nicht drängen.“
Und Habermann nickte, stieß dazu einen undeutlichen Laut aus, der ebensogut heißen konnte. „Behüte!“ wie: „Das wird sich finden!“ und schrieb mit hübschen runden Ziffern eine vierstellige Zahl auf ein Blatt Papier, das er seinem Taschenbuch entnahm.
„Unterschreiben Sie wenigstens! Das ist der ganze Bettel auf einmal. Ich streiche die einzelnen Posten. Sehen Sie, hier!“ –
Dann wankte Julius seiner Wohnung zu, und ihm war, als könne das alles nicht wirklich sein, was er erlebt hatte. War er nicht weggegangen, um sich von Habermann zu lösen, womöglich für immer? Und nun! O über diese fluchwürdige Verkettung des Schicksals, das ihn gerade jetzt nur noch enger an den Menschen gefesselt hatte. Abscheuliche Einrichtung der Welt – sowie man in seiner harmlosen Lebenslust den Fuß vorsetzt, sich seiner Jugend zu freuen, gleich müssen ringsum Fußeisen liegen, in denen man sich fängt! Und doch – Kopf hoch! Andere waren auch in solchen Nöthen gewesen und mit heiler Haut wieder herausgekommen. Daß nur die Mutter nichts von seinem Unstern erfuhr! Leise schloß er das Haus auf, schlich auf den Zehen die Treppe hinauf und öffnete vorsichtig und langsam die Kammerthür. Gott sei Dank, sie knarrte nicht, Grete hatte vorgesorgt!
| * | * | |||
| * |
In dem Putz- und Modewarengeschäft von Franz und Kompagnie in der Breiten Straße herrschte die beschauliche Ruhe der Nachsaison. Schweigen, nachmittägliche Schwüle erfüllten den schmalen langgestreckten Ladenraum, in dem vor einigen Wochen Scharen ungeduldiger Menschen sich gedrängt hatten, aussuchend, feilschend, bittend, scheltend – dessen Wände widergehallt hatten von den Anpreisungen der Verkäuferinnen, den Bedenken vorsichtiger Kunden, dem Klappern der auf das Zahlbrett geworfenen Münzen. Jetzt lag der Sonnenschein in breitem Streifen auf dem Asphaltpflaster vor der offenen Thür, Fliegen summten herein und hinaus, die Modellhüte auf ihren hohen Gestellen schienen zu schlafen, träumerisch hingen die Spitzengewinde im Schaufenster herab; die ausgelegten Frühlingsblumen sahen müde und gelangweilt aus, wie verdrießlich darüber, daß sie noch immer weiterblühen sollten, da doch ihre Zeit längst um war und kein Käufer sich ihrer Pracht freute. Auf den Stühlen, die für die Kunden aufgestellt waren, dehnten und reckten sich Verkäufer und Verkäuferinnen oder schlossen sich zu gemüthlichem Klatsch zusammen. Herr Franz hatte die tote Zeit benutzt, um auf Reisen zu gehen, das erhöhte nicht wenig das Behagen, mit dem alles nach den Wochen der Ueberarbeitung die Ruhe genoß.
Grete saß still in einer Ecke. Sie war es gewohnt, hohen Werth auf die Meinung des Bruders zu legen; daß er ihr Verhalten dem Kassierer gegenüber so wenig billigte, gab ihr doch zu denken. Dazu kam, daß Röver wie umgewandelt schien. Seit sie ihm gesagt hatte, daß seine Huldigung sie lächerlich mache, hatte er nie wieder das Wort an sie gerichtet. Nur seine Augen ertappte sie hier und da, wie sie mit finsterem Ernste ihren Bewegungen folgten; aber sie wandten sich eilig ab, sobald er sich beobachtet sah. Es war also möglich, diesen hartnäckigen aufdringlichen Menschen in seine Schranken zu bannen! Ja, wenn sie’s genau betrachtete, so war es sogar recht leicht gewesen; fast ärgerte sie sich darüber, wie leicht! Und lhre Gefährtinnen merkten die Wandlung sofort. Sie beglückwünschten die Freundin spöttisch zu ihrem Erfolg, und Frida Meier schien gar nicht abgeneigt, den Verlassenen für den erlittenen Verlust zu trösten. Also war es wirklich so, wie Julius behauptet hatte, daß aus dem Spotte [731] über Rövers Werben nur der Neid gesprochen habe; und hatte der Bruder dann am Ende auch in dem anderen recht?
Alle diese Vorstellungen beunruhigten Grete, am meisten jedoch das höfliche, aber entschiedene Ausweichen des Kassierers. Es machte sie unsicher, es war ihr ein stündlich erneuter Vorwurf, verdroß sie, weil es ihr dadurch unmöglich wurde, den langweiligen Menschen aus ihren Gedanken zu verbannen. Als Röver eines Tages eine geschäftliche Frage durch eine Dritte an sie richten ließ, brach ihre verhaltene Erregung in helle Flammen aus, und sie trat zu der Kasse, an der Anton Röver, über ein Buch gebeugt, saß.
„Ein Wort, Herr Röver! Wenn Sie mir etwas zu sagen haben, dann bitte, sagen Sie es mir selbst!“
„Wie Sie befehlen, Fräulein Meermann.“ Er hob dabei den Blick nicht von seinem Buche.
„Sie haben überhaupt in den letzten Wochen eine Art gegen mich angenommen,“ fuhr das Mädchen gereizt fort, „die allen im Geschäft auffällt. Sie begreifen, daß mir das nicht angenehm sein kann.“
„Ich glaubte im Gegentheil, Ihren Dank zu verdienen. Ich möchte den Vorwurf vermeiden, daß ich Sie – lächerlich mache.“
Grete biß sich auf die Lippen. „Sie haben ein in der Erregung gesprochenes Wort zu ernst genommen, Herr Röver, viel ernster, als es gemeint war. Wenn es Sie gekränkt hat, so verzeihen Sie mir! Ich hatte nicht die Absicht, Ihnen wehe zu thun!“
„Nicht? Wirklich nicht, Fräulein Meermann? Ich danke Ihnen für dieses Wort!“
Jetzt sah er zu ihr auf und Grete dachte: „Was reden nur die dummen Menschen? Seine Augen sind in der Nähe gar nicht finster, sondern sanft und geradezu hübsch in ihrer Art.“ Und sie reichte ihm die Hand. „Ich bin ehrlich, ich möchte niemand täuschen, am wenigsten einen braven tüchtigen Menschen wie Sie, und ich fürchtete –“ sie stockte.
Der Kassierer blickte erröthend auf seine Fingerspitzen nieder, die er auf dem Pulte zu verschiedenen Figuren übereinander legte. „Sie brauchten nichts zu fürchten, Fräulein Meermann; ich würde keine vermessenen Hoffnungen gehegt haben, auch nicht, wenn Sie mich mit ein wenig Güte behandelt hätten. Ich begreife sehr wohl, daß ich den Damen nicht gefalle. Und Sie brauchen sich keinen Zwang mir gegenüber aufzuerlegen, weder im Guten noch im Bösen.“
Grete spielte mit ihrem Notizblock. Es ließ sich darauf nicht gut etwas erwidern, und doch wollte sie nicht ohne ein freundliches Wort von ihm scheiden.
„Was ist das für ein Buch, in dem Sie lesen?“ fragte sie endlich.
„Eine spanische Grammatik. In dieser Zeit giebt es ja doch im Geschäft fast nichts zu thun, und so verwende ich die stilleren Stunden, um meine Sprachkenntnisse zu erweitern. Zum Verkäufer tauge ich schlecht, und dieser Posten eines Kassierers, den Herr Franz mir freundlich eingeräumt hat, ist eigentlich für eine Dame bestimmt und dementsprechend besoldet. Bis zum Frühjahr aber hoffe ich, mich neben dem Französischen und Italienischen auch im Spanischen soweit vervollkommnet zu haben, daß ich auf die Stellung eines Korrespondenten hoffen darf.“
„Wie strebsam Sie sind, Herr Röver!“ rief Grete in unwillkürlicher Bewunderung.
Er lächelte gutmüthig. „Irgend etwas in der Welt muß man doch leisten. Ein freundliches Geschick hat es gefügt, daß ich Muße behalte zu meiner Ausbildung.“
(Fortsetzung folgt.)
Alle Rechte vorbehalten.
Polizei und Verbrecherthum in Berlin.[2]
In unseren bisherigen Schilderungen haben wir die Laufbahn der Verbrecher bis zu ihrer Verhaftung durch die Kriminalpolizei und ihrer Internierung im Central-Polizeigebäude am Alexanderplatz verfolgt; es erübrigt uns zum Schlusse dieser Artikel noch, einen Blick auf die Untersuchungshaft, die Verurtheilung der Ueberführten und schließlich auf die Sühne der blutigen That zu werfen. Wie wir schon früher erwähnt haben, währt der Aufenthalt eines eingefangenen Verbrechers im Polizeigefängniß am Alexanderplatz nur kurze Frist, da nach einer alten Verfügung die Untersuchungsakten eines jeden Verhafteten binnen vierundzwanzig Stunden so weit gefördert sein müssen, daß er zugleich mit den Akten dem Untersuchungsrichter überwiesen werden kann[.] Zu gleicher Zeit erfolgt seine Ueberführung in das Untersuchungsgefängniß zu Moabit mittels des „Grünen Wagens“, und dort wird er womöglich noch am selben, spätestens am nächsten Tage dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der ihn verhört und, falls er nicht seine Entlassung verfügt, was in den seltensten Fällen geschehen kann, die Untersuchungshaft über ihn verhängt. Diese kann Wochen und Monate lang dauern, bis die Akten über das Verbrechen abgeschlossen sind und in öffentlicher Gerichtssitzung die Anklage erhoben wird. Welche Anforderungen übrigens an die Thätigkeit und den Pflichteifer der Untersuchungsbeamten gestellt werden, geht daraus hervor, daß einzelne derselben jährlich bis dreitausend Personen vernehmen müssen, wozu sich noch ihre Anwesenheit bei Obduktionen, Lokalbesichtigungen oder Lokalterminen gesellt.
Unterwerfen wir nun, ehe wir uns den ferneren Schicksalen des Inhaftierten zuwenden, [732] das Moabiter Untersuchungsgefängniß selbst einer Besichtigung. In unmittelbarer Nähe des Kriminalgerichtsgebäudes in den Jahren 1876 bis 1881 erbaut und mit letzterem mehrfach direkt verbunden, gewährt es 1230 Gefangenen (darunter 220 weiblichen) Aufnahme, von denen 820 isoliert und 410 in Gemeinschaftshaft untergebracht werden können; das Männer- und das Weibergefängniß sind baulich vollständig voneinander getrennt, wobei wir erwähnen, daß sich die weiblichen Gefangenen meist in Gemeinschaftsräumen befinden, während über die männlichen mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich Einzelhaft verfügt wird. Hinter dem Verwaltungsgebäude mit den Bureauräumen, den Dienstwohnungen des Direktors, des Oberinspektors und des Anstaltsgeistlichen sowie dem Gefangenensprechzimmer und der Militärwache erhebt sich massig und drohend, in Ziegelrohbau ausgeführt, das Männergefängniß, auf allen Seiten von Mauern eingeschlossen und von mehreren Militärposten bewacht. Vier Stockwerke hoch, enthält es zugleich umfassende Boden- und Kellerräumlichkeiten; es ist strahlenförmig gebaut, in der Weise, daß fünf Flügel von einer Centralhalle sich abzweigen. Von diesem Centrum aus, in dessen Mitte sich eine gewaltige eiserne Säule erhebt, können alle Flügel überblickt werden; eiserne Brücken stellen die Verbindung her zwischen der Halle und den einzelnen Stockwerken, an deren Zellenreihen eiserne Laufgänge entlangführen, die wiederum untereinander durch Querbrücken verbunden sind. Man kann also auch in jedem Flügel von unten nach oben und von oben nach unten die genaueste Umschau halten und sich sofort von der kleinsten Unordnung durch den Augenschein überzeugen; außerdem wird jedes laute Wort, jedes noch so unbedeutende Geräusch durch alle Stockwerke vernommen. Dieses innere eiserne Gerippe des Gefängnisses erscheint wie ein riesiges Spinnengewebe, in welchem selbst die Spinne nicht fehlt, in der Gestalt eines Beamten, der auf der drittobersten Plattform jener Säule seinen Platz hat und von hier aus das ganze Innere überblickt; er ist es auch, der die Vorführung der Gefangenen vor den Untersuchungsrichter anordnet, nachdem ihm letzterer durch Telephon mitgetheilt hat, wen er zu sprechen wünscht. Der Aufseher stellt in solchem Falle in dem neben seinem Sitze befindlichen Verzeichniß die Nummer des betreffenden Gefangenen, die stets der Nummer seiner Zelle entspricht, fest, ruft durch ein Alarmzeichen – je nach der Anzahl der Schläge – einen der Aufseher jenes Flügels, in welchem sich die bewußte Zelle befindet, und befiehlt ihm die Vorführung des Gefangenen.
Die Isolierzellen sind alle genau nach demselben Muster eingerichtet; eine starke Bohlenthür, mit schwerem Riegelschloß versehen und derart angebracht, daß sie nicht ausgehoben werden kann, schließt die Zelle von den eisernen Laufgängen ab; an jeder Thür ist eine Klappe, durch welche den Gefangenen das Essen hineingereicht wird; eine kleine, von außen durch einen beweglichen Deckel verschließbare Oeffnung ermöglicht, ohne daß der Insasse etwas merkt, seine Beobachtung. Die Zellen sind vier Meter lang, fast zweieinhalb Meter breit und zweidreiviertel Meter hoch; der Thür gegenüber befindet sich über Mannshöhe das vergitterte Fenster, mit einer Vorrichtung zum Lüften, die von dem Gefangenen nach Belieben gestellt werden kann. Die Einrichtung jeder Zelle besteht aus einem Holztisch, der an einer Seite an der Wand befestigt und zum Herunterklappen eingerichtet ist, aus einem Schemel ähnlicher Konstruktion, einem Holzregal zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln – denn der Gefangene darf sich, wenn er über die nöthigen Mittel verfügt und der Arzt nichts dagegen einzuwenden hat, selbst beköstigen – aus einer eisernen, gleichfalls an der Wand befestigten und aufklappbaren Bettstelle mit Indiafasermatratze und Bettzeug, endlich aus den nöthigen Gegenständen zum Waschen, Wassertrinken, Säubern der Kleidung. In vorzüglicher Weise ist die Zufuhr guter und der Abzug der schlechten Luft geregelt; die Heizung geschieht durch erwärmte Luft. Durch ein Telephonzeichen kann ferner der Gefangene den Wärter herbeirufen und ihm seine Wünsche übermitteln.
Neben diesen Zellen giebt es auch noch sogenannte „schwere“ oder „Mörder“-Zellen, in welche gewöhnlich gefährliche Verbrecher gesteckt werden; in diesen ist die Thür innen mit Eisenblech beschlagen und noch mit besonders starken Riegeln versehen; der Boden ist nicht von Holz, sondern cementiert, das Gaslicht fehlt gänzlich und die Bettstelle ist von Holz, damit der Gefangene sich nicht von den Eisentheilen Brechwerkzeuge oder gar Waffen verfertigen kann. Außerdem befinden sich unter dem hölzernen Tische sowie an der Wand oberhalb des Bettkastens starke Eisenringe damit, wenn besondere Vorsicht geboten erscheint, der Verhaftete mit Ketten dort angeschlossen werden kann. Indessen hindert selbst diese äußerste Maßregel kühne Verbrecher nicht, Fluchtversuche zu unternehmen. So war vor einiger Zeit ein gefährlicher Einbrecher angekettet worden; als am nächsten Morgen der Aufseher die Zelle revidierte, fand er den Insassen auf seiner Lagerstatt sitzend und mit seinen Ketten Fangball spielend: von dem starken Drahtgeflecht, mit welchem das Luftloch der Zelle überspannt war, hatte dieser, indem er sich hoch emporreckte, mit den Zähnen ein Stück Draht abgerissen, wozu stundenlange Anstrengungen erforderlich gewesen waren; mit dem Drahte hatte er dann allmählich seine Ketten gelockert, bis es ihm endlich gelang, sie ganz abzustreifen. Alle weiteren Versuche aber, aus der Zelle zu entkommen, waren mißglückt, und so mußte er sich am nächsten Morgen ruhig in sein Schicksal ergeben und sich von neuem anschließen lassen. Uebrigens ist dieses „Anschließen“ nicht so schlimm, wie es sich anhört; die Handeisen, welche zumeist allein in Anwendung kommen, wiegen ein Kilogramm, zusammen mit den Fußfesseln, die selten gebraucht werden, drei Kilogramm. Im äußersten Nothfall nur bedient man sich der sechs Kilogramm schweren, aus starkem Leder und Eisen gefertigten Zwangsjacken, welche man bloß jenen Verbrechern anlegt, die entweder wirklich von einem Tobsuchtsanfall heimgesucht werden oder, um in die Gefangenenstation der Charité oder der Dalldorfer Irrenanstalt zu gelangen, den „wilden Mann“ spielen, d. h. sich als Tobsüchtige gebärden und alle Sachen ihrer Zelle kurz und klein schlagen. Für diese schlimmen Burschen sowie für die in irgend einer anderen Weise widersetzlichen Gefangenen giebt’s noch besondere Arrestzellen, die in den Kellergewölben liegen und als einzige „Ausstattung“ eine Pritsche, einen Eimer und einen Wasserkrug enthalten. Meist genügen einige Tage Haft da unten, um auch den widerspenstigsten „schweren Jungen“ wieder zur Vernunft zu bringen; immerhin aber bekommen es manche fertig, wochenlang dort auszuhalten, während sie zugleich Blödsinn heucheln und Tage hindurch in ein und derselben Stellung verharren. Durch ihre Ausdauer können sie selbst den gewiegtesten Arzt täuschen.
[733] Wird ein Untersuchungsgefangener in das Moabiter Gefängniß eingeliefert, so muß er, nachdem erst seine Eintragung im Bureau vollzogen ist, ein Bad nehmen; sind seine Kleider voll Ungeziefer oder sonst nicht mehr zu benutzen, so bekommt er Anstaltskleidung, im anderen Falle behält er den Anzug, in welchem er eingeliefert wurde. Sein Tageslauf ist von jetzt ab ein streng geregelter; früh morgens um sechs Uhr muß er sich auf ein lautes Zeichen hin von seinem Lager erheben und seine Zelle sowie deren Geräthe säubern; um halb sieben Uhr wird das aus warmer Suppe und Brot bestehende Frühstück verabreicht, dann ein Spaziergang unternommen auf einem der Höfe, die zwischen den fünf Flügeln des Gefängnißgebäudes liegen und kreisrunde oder ovale, mit Granitplatten belegte Wandelbahnen enthalten. Hier bewegen sich die Gefangenen mit fünf Schritt Abstand täglich eine Stunde lang, selbstverständlich unter Aufsicht und ohne daß gesprochen oder irgend eine sonstige Verständigung unternommen werden darf. In seine Zelle zurückgeführt, verläßt sie der Gefangene gewöhnlich an diesem Tage nicht mehr; er kann sich eine Beschäftigung, wie Wollezupfen, Dütenkleben u. s. w. ausbitten oder als „Kalfaktor“ zu den häuslichen Verrichtungen – Kochen, Waschen, Scheuern – melden, ein Zwang aber wird in dieser Beziehung auf ihn nicht ausgeübt. In jeder Zelle liegen zwei Erbauungsschriften auf, der Verhaftete kann jedoch noch andere Lektüre – Zeitschriften, geschichtliche, naturwissenschaftliche und ähnliche Bücher – aus der über dreitausend Bände enthaltenden Bibliothek beziehen, die ein Strafgefangener verwaltet; allerdings wird je nur ein Band für die Woche ausgeliehen. Um halb zwölf Uhr mittags wird in sauberen Blechschüsseln das Essen verabfolgt, durchaus schmackhaft und kräftig zusammengesetzt aus Hülsenfrüchten oder frischem Gemüse nebst Kartoffeln und Fleisch oder Schmalz; abends um halb sieben Uhr giebt es wiederum eine warme Suppe nebst Brot. Um acht Uhr muß sodann auf ein bestimmtes Zeichen in allen Zellen das Licht erlöschen, und tiefe Ruhe kehrt in das weite Gebäude ein.
Zweimal in der Woche und zweimal des Sonntags findet in der kleinen Kapelle des Gefängnisses, in der auch die Schule abgehalten wird, Gottesdienst statt; der Zuhörerraum dieser merkwürdigen Kirche ist amphitheatralisch gebaut und enthält gegen achtzig schmale, vorn offene, sonst aber vollständig voneinander abgeschlossene und überdachte hölzerne Zellen, so daß die Gefangenen sich weder sehen noch sprechen können. Der Zugang erfolgt durch eine schmale Thür von der oberen Reihe der Plätze aus, in solchem Abstand, daß der erste Gefangene schon in seinem Gehäuse sitzt, wenn der zweite in die Kapelle eintritt, und so fort; in gleicher Weise verlassen die Zuhörer den Raum, in dem sie während des Gottesdienstes durch zwei Beamte beaufsichtigt werden.
So scharf nun auch die Ueberwachung der Untersuchungsgefangenen ist, so diensteifrig die zahlreichen Beamten sind – es giebt ihrer 120 – so stehen die Verbrecher doch häufig in geheimem Verkehr miteinander, tauschen ihre Erfahrungen und Befürchtungen aus und geben sich gegenseitig Winke für die bevorstehenden Verhöre und Gerichtsverhandlungen. Den gewöhnlichsten Weg für diese oft erstaunlich sinnreichen und erfinderischen Verständigungen bilden die „Kassiber“, kleine Stückchen Papier mit Notizen, die bei irgend einer Gelegenheit – dem erwähnten Spaziergang, der Vorführung vor den Richter, einer gemeinsamen ärztlichen Untersuchung – einer dem anderen zusteckt; auch von einer Zelle zur anderen wissen sie durch eine völlig ausgebildete „Klopfsprache“ einen Verkehr herzustellen; für jeden Buchstaben besteht nämlich ein besonderer Klopfton, und die Wände der Zelle, die Heizungsröhren geben für diese merkwürdige Sprache den Schallleiter ab. Auf diese Weise erhält oft ein schon seit längerer Zeit Verhafteter von seinem Zellennachbar, der erst neuerdings eingebracht wurde, die wichtigsten Nachrichten über Vorkommnisse in der „Außenwelt“ und kann danach sein Vertheidigungs- oder Ableugnungssystem einrichten. Ja, die Spitzfindigkeit auf diesem Gebiet geht bei erfahrenen Verbrechern so weit, daß sie sich bei den Schulstund[e]n in der Kapelle, wo keiner den anderen sieht, wohl aber jeder den anderen hört, durch den Wortlaut und die Betonung ihrer Antworten zu verständigen wissen! Auch Thüren, Bänke, Tische etc. werden zu allerhand Mittheilungen benutzt, die häufig mit den Fingernägeln, mit einem Steinchen oder einer Stecknadel eingeritzt werden; die Innenseiten der Thüren und die Wände jener Räume, in denen die Untersuchungsgefangenen im Moabiter Kriminalgerichtsgebäude sich aufhalten, ehe sie vor den Untersuchungsrichter gelangen, weisen häufig wahre Blumenlesen solcher „Bekanntmachungen“ auf. Da liest man: „Traut nicht dem Bäckerfritzen, er hat gepfiffen“ (verrathen), oder: „R. soll alles einräumen, ich komme dafür ’raus“, oder auch eine Frage: „Was macht E.? – Ich sitze seit sechs Wochen in Untersuchung.“ Selbst poetische Gemüther haben sich hier verewigt:
„Wer Freiheit nicht zu schätzen weiß,
Darf nur dies Haus betreten,
So wird er schon in kurzer Zeit
Für seine Freiheit beten!“
und ein anderer Reim versichert:
„Selbst in dem tiefsten Kellerloch
Denk’ ich an meine Liebste noch!“
Freilich sorgen Oelfarbe und Tünche bald genug für das Verschwinden dieser Korrespondenzen, aber in vielen Fällen haben sie inzwischen schon ihren Zweck erfüllt, und wenn sie auch nicht gerade von jenen Gefangenen, an die sie gerichtet sind, an Ort und Stelle gelesen werden, so gelangt ihr Inhalt doch bei der nächsten Gelegenheit durch die Vermittlung hilfreicher Genossen an seine richtige Adresse. –
Wir haben oben angeführt, daß nach dem Abschluß der Untersuchung das gerichtliche Verfahren eröffnet und der Gefangene, je nach der Schwere seiner That, vor die Strafkammer oder das Schwurgericht gestellt wird. Diese Verhandlungen finden ausschließlich im Moabiter Kriminalgerichtsgebäude statt, „im Kriminal“, wie die Verbrecher sagen, oder kurz: „in Moabit“, wie es im Publikum heißt. Der Verkehr im Innern des neu erbauten gewaltigen rothleuchtenden Gebäudes, das dem ganzen angrenzenden Stadttheil seinen Stempel aufgedrückt hat, [734] gleicht schon an den gewöhnlichen Tagen mit seinem unruhigen Hin und Her, seinem rastlosen vielgestaltigen Durcheinander einem aufgeregten Bienenschwarm; treppauf, treppab, durch die großen Vorhallen und über die weiten Flure fluthen die Menschenwogen dahin, hier sich stauend, da mit eiliger Hast fortstürmend, weil sie falsch gegangen sind und die Stunde ihrer Vorladung herangerückt ist. Mit flatternden Talaren, auf dem Kopfe das schwarzsamtene Barett, brechen sich Richter und Rechtsanwälte durch die vor den einzelnen Sälen und Gerichtszimmern Harrenden Bahn; mit würdigen Mienen schreiten die Gerichtsdiener einher oder sie rufen mit einförmiger, laut schallender Stimme die Namen der vorgeladenen Parteien auf; in nervöser Erregung sitzen auf den Bänken mehrere Zeugen, andere wieder blicken mit immer größer werdender Ungeduld auf die langsam vorwärtsschreitenden Zeiger der Uhr – was wird vielleicht die nächste Sekunde ihren Angehörigen, die eben hinter jener Thür vor dem Gerichtshof stehen, bringen: Freisprechung oder Verurtheilung, unsagbare Freude oder tiefstes Elend?
Zeitigt also schon jeder gewöhnliche Tag in diesem Justizpalast eine Reihe ergreifender wechselvoller Bilder, in denen sich häufig ganze Menschenschicksale widerspiegeln, herrscht hier jederzeit ein eigenthümlich dumpfer bedrückender Bann, dem sich selbst der Unbetheiligte nicht entziehen kann – so nimmt diese nervöse Spannung noch bedeutend zu und scheint sich auf einen einzigen Fleck zu konzentrieren, wenn hier einer der großen Kriminalprozesse abgewickelt wird, deren das Berliner Verbrecherthum leider mehrere im Jahre veranlaßt. Der große Schwurgerichtssaal im ersten Stockwerk bildet dann den Hintergrund zu diesen Tragödien aus dem Weltstadtleben, dessen furchtbarste Tiefen und erschreckendste Abgründe hier aufgedeckt werden, in der packenden Schilderung des Staatsanwalts, in der ruhigen Beleuchtung des Schwurgerichtsvorsitzenden, unter der gespannten Theilnahme der Geschworenen und dem fieberhaften Interesse der Zuhörer.
Goldig fluthen die Sonnenstrahlen durch die hohen buntbemalten Bogenfenster in den Saal und bilden einen grellen Gegensatz zu den blutbefleckten Gegenständen, die dort auf einem Tischchen vor dem Richterkollegium liegen als stumme Zeugen einer entsetzlichen That, die hier ihre Sühne finden soll; für diese Sühne tritt mit feurigen Worten die Rede des Staatsanwalts ein, deren anklagende Sätze, schon durch den Tonfall hervorgehoben, in der lautlosen Stille wie grollend dahinrollen und selbst auf die in den vorderen Bänken sitzenden Zeugen, alte bekannte Verbrecher, sowie auf die unter den Zuschauern befindlichen Zöglinge des Verbrecherthums, die sogenannten „Kriminalstudenten“, die hier ihre theoretischen Studien machen, einen sichtlichen Eindruck hervorbringen. Und aller Augen fliegen hinüber zu dem Thäter hinter der niedrigen hölzernen Schranke dort, der, den Kopf auf die Hände gestützt, in dumpfer Betäubung vor sich hinbrütet, nur noch von einem Gedanken erfüllt, dem an den nahenden Urtheilsspruch. Und dann kommt er, dieser gefürchtete Augenblick – seit längerer Zeit bereits haben sich die Mitglieder des Gerichtshofes und die Geschworenen zurückgezogen und müssen alsbald wieder erscheinen, die Zeugen wagen kaum miteinander zu sprechen, im Zuhörerraum tuschelt man leise hin und her, und an dem Tische der Berichterstatter huschen die Federn hastig über das Papier; von draußen herein tönt zuweilen der Sang eines Vogels oder das ferne Läuten der Pferdebahn, vom Flur her läßt sich das gedämpfte Raunen der Menschenmenge vernehmen, die wegen des Prozesses aus ganz Berlin hergeeilt ist, aber keinen Einlaß mehr in die überfüllten Galerien erhalten hat.
Doch nun athemlose Ruhe – die Thür an der Rückwand des Saales öffnet sich, und langsam, feierlich, mit ernsten Mienen nahen Richter und Geschworene und nehmen ihre Plätze ein; welche bangen, drückenden, schier endlosen Sekunden! Jetzt erhebt sich der Präsident und bedeckt sein Haupt mit dem schwarzen Barett, noch stiller wird es im Saale, aller Augen und Ohren hangen an ihm; nur der Verbrecher, der stehend sein Urtheil anhören sollte, aber kraftlos wieder zurückgesunken ist, hat den Kopf tief gesenkt, und wie mit Drommetentönen, wie mit den Stimmen des jüngsten Gerichts schallt es nun zu ihm herüber, daß ihn die Geschworenen des Mordes für schuldig befunden und die Richter ihn zum Tode durch Henkershand verurtheilt haben. –
Und die Richtstätte, wo der alttestamentliche Spruch: „Wer Menschenblut vergießt, dess’ Blut soll wieder vergossen werden“, erfüllt wird, befindet sich nahe dem Orte, wo das Urtheil gefällt wurde: in dem an der Lehrterstraße in Moabit gelegenen Zellengefängniß. Dort, auf einem schmalen von hohen Gefängnißmauern eingeschlossenen Hofe, waltet in Gegenwart weniger Zeugen bei Tagesanbruch, wenn Berlin noch im Schlummer liegt, der [735]
Henker seines blutigen furchtbaren Amtes, und nur der schwache Klang des Armsünderglöckchens kündet der nächsten Umgebung an, daß ein Mensch zum Tode geführt ward! Wenige Stunden später, und die Riesenstadt hat bei ihrem Erwachen schon Kenntniß erhalten von der Vollstreckung des Urtheils, denn grellrothe amtliche Plakate verkünden an den Anschlagsäulen die Enthauptung des Mörders, und durch alle Straßen und Gassen, in die entferntesten Ecken und Winkel dringt die Kunde von der blutigen Sühne der blutigen That. Auch durch die Verbrecherkreise fliegt d[i]e Kunde, sie findet ihren Weg durch die stärksten Gefängniß- und Zuchthausmauern in die entlegensten Zellen hinein, überall Schrecken und Entsetzen verbreitend und eine eindringliche Saat aussäend.
Nachdruck verboten.
Alle Rechte vorbehalten.
Gefährliches Unkraut.
Der Kampf ums Dasein ist nicht allein in der Thierwelt entfesselt, auch in dem stillen Pflanzenreiche ringt Art gegen Art. Wer Augen für das Walten und Weben der Natur hat, sieht diesen Kampf auf Schritt und Tritt. Der Naturforscher verfolgt ihn mit Interesse, der Landwirth mit tiefem Ingrimm, wenn die bebauten Aecker zu Schlachtfeldern in diesem stillen Kriege werden und die sorgsam gehegte Saat nutzbringender Pflanzen dem Unkraut unterliegt.
Da grünt im Frühjahr der Klee zur Freude des Landmannes, und das üppige Wachsthum verspricht einen guten Schnitt; allein obwohl der Himmel lacht und Regen und Sonnenschein in richtigem Maße abwechseln, verändert sich unverhofft das günstige Bild. Das frische Grün der Blätter schwindet, verdorrt senken sich die Pflanzen zu Boden, das ganze Kleefeld krankt, aber über den siechen Kulturpflanzen erhebt sich kerzengerade, lebensvoll, in violettrothen Blüthen prangend, der „Kleeteufel“, der Urheber dieser Verwüstung.
Unter dem Schutze des Blätterdaches der Kleepflanze hat er gekeimt und sich spargelartig erhoben, während seine Wurzeln unter der Erde ihr Minierwerk begannen. Er hat fadenartige Saugwurzeln ausgesandt und sie in die Wurzeln des Klees versenkt; hierdurch entzog er diesem seine Nahrung und wuchs als Schmarotzer auf fremde Kosten.
Wir wandern an einem andern Kleefeld vorüber; es steht in gutem Wachsthum, aber während wir unsern Blick darüber hinschweifen lassen, entdecken wir hier und dort breite muldenartige Vertiefungen, Stellen, an welchen der Klee zurückgeblieben ist und wie niedergetreten auf dem Erdboden liegt. Haben hier etwa Hirsche oder Rehe geäst? Durchaus nicht. Was wir vor uns haben, das ist wieder der stille Kampfplatz verschiedener Pflanzen. Auch hier ist der Klee einem Feinde erlegen, nur ist dieser nicht auf den ersten Blick sichtbar, er erhebt sein Haupt nicht so frech wie der Kleeteufel. Nähern wir uns der Stelle und bücken uns, so bemerken wir, daß die Kleepflanze von feinen gelben, röthlichen und purpurnen Fäden umstrickt ist. Das sind die blattlosen gelben Stengel der Kleeseide, welche mit kleinen weißen und röthlichen Blüthen besät sind. Auch die Kleeseide ist ein Schmarotzer, ernährt sich jedoch auf andere Weise als der Kleeteufel. Ihr Samen keimt zusammen mit der Kleesaat; er entsendet fadenartige Wurzeln in die Tiefe der Erde und fadenförmige Stengelchen hinauf an die Oberfläche. Diese feinen Ranken suchen gleich denen der Ackerwinden die Stengel des Klees zu umspinnen. Ist ihnen dies gelungen, so bohren sie sich mit Saugwurzeln in das Innere der Stengel ein und haben damit ihre Existenz als Stengelschmarotzer begründet. Denn von diesem Augenblick an stirbt die Wurzel der Kleeseide ab und der Schmarotzer nährt sich nur noch vom Safte der Kleepflanze. Diese siecht natürlich dahin, die Kleeseide aber spinnt ihre Netze weiter aus und treibt lebenskräftig ihre Blüthen.
Eine ähnliche Windenpflanze, die „Flachsseide“, nistet sich auf den Flachsfeldern ein und bewirkt hier in gleicher Weise ihre Verheerungen.
Geht in den geschilderten Fällen das Schmarotzerthum gleichsam hinterlistig vor, so sehen wir andere Arten des Unkrauts in ritterlicher oder raubritterlicher Art zum offenen Kampfe gegen die Kulturpflanzen ziehen.
Im Sommergetreide, auch auf Kartoffelfeldern, erblickt man öfter eine bis zu 60 cm hohe Pflanze mit krautigem einfachen oder ästigen Stengel und lanzettlichen Blättern. Die unteren Blätter sind fiederspaltig, die oberen einfach. Die Pflanze ist blaugrün an Stengel und Blatt, oben aber trägt sie leuchtend gelbe Strahlen- und Scheibchenblüthem. Ihr lateinischer Name lautet Chrysanthemum segetum, im Volksmunde heißt sie die „gelbe Wucherblume“. Sie macht ihrem Namen alle Ehre, denn wo sie sich einmal eingestellt hat, verwandelt sie den Acker bald in ein schön gelbes, aber nichts weniger als gewinnbringendes Blumenfeld. Wegränder sind ihre Niststätten, von denen aus sie meistens ihre Raubzüge gegen die Aecker unternimmt.
An Wegrändern und feuchten Gräben lauert auch der gemeine Huflattich, hervorstechend durch seine großen, bis 25 cm im Querdurchmesser haltenden, herzförmigen, auf der Unterseite weißwollig behaarten Blätter. Er blüht frühzeitig, schon im März und April; seine Blüthen sind denen der Kuh- oder Kettenblume ähnlich, unterscheiden sich von diesen jedoch durch die wollige Behaarung und den Besitz von schuppigen braunen Blättchen. Wenn die goldgelben Blüthenköpfchen des Huflattichs welken und der Samen zu reifen beginnt, dann wächst noch der Blüthenschaft in die Höhe, der einen möglichst hohen Standpunkt zu erreichen sucht; [736] denn sein Samen ist beflügelt, und so strebt die Pflanze danach, ihn dem Winde möglichst günstig darzubieten, damit er dann weit über Aecker und Felder verbreitet werde.
Wie einst die Mongolenschwärme den Drang nach dem Westen verspürten, so wandert ferner ein älteres gelbes Unkraut von Osten gen Westen. Es ist das „Frühlingskreuzkraut“ (Senecio vernalis), das in unseren östlichen Provinzen auf Sandfeldern und Schonungen besonders zahlreich verbreitet und bereits bis nach Brandenburg vorgedrungen ist. Es blüht zweimal im Jahre, im Mai bis Juni und im September bis November, sein befiederter Samen wird wie der des Huflattichs vom Winde verweht.
Auch die Wiesen haben ihre gefährlichen Feinde. An den Ufern der Flüsse und Bäche, an Grabenrändern wächst die „gebräuchliche Pestwurz“ (Petasites officinalis), die mit außerordentlich großen Blättern ausgestattet ist; erreichen doch diese sogar 40 cm im Querdurchmesser. Wo sich die Pestwurz ausgebreitet hat, da wächst kein Gras.
Der Landwirth kennt diese seine Feinde, und verschiedene Regierungen haben Verordnungen erlassen, laut welchen die Grundbesitzer verpflichtet sind, die genannten Arten von Unkraut auf ihren Feldern zu vernichten. Es genügt aber dabei nicht, diese Feinde der Felder vom Acker zu entfernen und abseits zu werfen, sondern man muß sie wirklich vernichten, was am einfachsten durch Verbrennen geschieht.
Um nun die Landwirthschaft im Kampfe gegen das Unkraut zu unterstützen, hat der Realgymnasiallehrer B. Farwick die geschilderten Schädlinge in naturgetreuen farbigen Abbildungen auf sechs Tafeln zusammengestellt (Verlag von Fr. Wolfrum, Düsseldorf). Dieselben eignen sich vorzüglich als Lehrmittel fär den Anschauungsunterricht in den Schulen. Der Kampf des Menschen gegen das Unkraut ist an sich ein fesselndes Thema, die Vorführung und Besprechung jener gefährlichen Pflanzen bietet außerdem mehrere pädagogische Vortheile. Der Schüler lernt nicht nur die Pflanzengestalten kennen, er wird auch in merkwürdige Geheimnisse des Pflanzenlebens eingeführt, und zugleich wird in ihm durch den Hinweis auf die Verpflichtung, die Schädlinge auszurotten, der gemeinnützige Sinn wachgerufen oder gestärkt.
Aus diesem Grunde möchten wir die Farbendrucktafeln „Wucher- und Schmarotzerpflanzen, deren Vertilgung behördlich angeordnet ist,“ als Bildungsmittel für die Jugend den Schulen zur Beachtung empfehlen.
Es wird gut sein, den Winter zum sorgfältigen Studium der Tafeln zu benutzen, damit die bösen Feinde im kommenden Frühjahr die Vertheidiger des heimathlichen Bodens wohl gerüstet finden. J.
Nachdruck verboten.
Alle Rechte vorbehalten.
Deutsche Originalcharaktere des achtzehnten Jahrhunderts.
Es gab unter den deutschen Gelehrten in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sehr sonderbare Käuze, und namentlich die Gewaltherrschaft des Königs Friedrich Wilhelm I. von Preußen brachte es zuwege, daß Universitätsprofessoren sich in Hofnarren verwandelten und dabei mit den höchsten Ehren und Titeln ausgezeichnet wurden. Es gab gelehrte „Spottgeburten“, welche dazu besonders veranlagt waren und sich in diesem trüben Fahrwasser mit großem Behagen bewegten, ohne daß man deshalb berechtigt wäre, ihrer Gelehrsamkeit zu nahe zu treten. Zu diesen Zwitternaturen, deren Nachruhm in einem zwiespältigen Lichte schillert, gehört auch Dr. Salomon Morgenstern, der zu zwei preußischen Königen in nahen Beziehungen stand, zu Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., und als ein Erbstück des gestrengen Vaters auf den genialen Sohn überging, welcher sonst von dem Hofinventar des Soldatenkönigs wenig genug herübernahm.
Salomon Morgenstern war am 8. April 1706 zu Pegau im Kursächsischen geboren, besuchte das Gymnasium zu Altenburg und ging in seinem zwanzigsten Jahre auf die Universität Jena, um sich der Gottesgelahrtheit zu widmen. Nach beendigtem Studium wurde er in Leipzig Magister der Theologie und bald darauf Professor in Halle, wo er indeß seine theologischen Studien, wie es scheint, an den Nagel hing und vorzüglich über Geographie und Geschichte las.
Schon in jungen Jahren hatte er Tüchtiges geleistet und sich einen Namen gemacht. Im Jahre 1734 war seine „Staatsgeographie von Rußland“ erschienen, durch welche er der Kaiserin Elisabeth bekannt wurde, die ihn mit einem Gehalt von 1000 Thalern nach Petersburg berief. Das war ein schöner Erfolg für einen Gelehrten von 28 Jahren; man darf daher die wissenschaftlichen Verdienste des kleinen Morgenstern nicht unterschätzen.
Seine Persönlichkeit aber war sehr seltsamer Art, und gerade das Auffallende seiner äußeren Erscheinung, wie es auch auf dem von uns gebrachten alten Porträt hervortritt, sollte für sein Schicksal entscheidend werden. Der kleine possierliche Mann, etwas verwachsen, drollig in Haltung und Bewegungen, erlebte bei seiner Durchreise nach Petersburg in Berlin ein merkwürdiges Abenteuer.
Der wachhabende Offizier am Thore zu Potsdam habe, so wird erzählt, den Gelehrten wegen seiner komischen Persönlichkeit dem König gemeldet, dieser habe das Original zur Audienz befohlen und, da er allen seinen Anforderungen an einen Hofgelehrten entsprach, ihm erklärt, er dürfe nicht weiter reisen. Morgenstern erwähnte seine günstigen Aussichten in Rußland, entschloß sich indessen, zu bleiben, als ihm die Stelle eines Königlichen Hofraths mit 500 Thalern Gehalt und freier Wohnung in Potsdam angeboten wurde. Er trat sogleich ins Tabakskollegium ein; denn darauf kam es dem König in erster Linie an, einen Ersatzmann für den seligen Gundling zu haben, der in diesem Kollegium die Zeitungen vorgelesen und erklärt hatte und nebenbei die Zielscheibe der rohesten Soldatenwitze gewesen war.
Es gehörte Muth dazu, im Tabakskollegium die Wissenschaft zu vertreten, da die tapferen Haudegen, die dort zechten, dieselbe für eitel Narretei hielten. Die Schicksale Gundlings mußten allen zur Warnung gereichen, welche nach ihm so gefährliche Pfade wandeln wollten. Gundling war Professor an der Ritterakademie und Rath bei dem Oberheroldsamt gewesen. König Friedrich Wilhelm I. hatte diese Aemter bei seinem Regierungsantritt aufgehoben und Gundling dafür zum Hofrath und Zeitungsberichterstatter im Tabakskollegium ernannt. Gundling war von da an der ständige Begleiter des Königs; er wurde Oberceremonienmeister und Nachfolger des großen Leibniz in der Stellung eines Präsidenten der Berliner Akademie. Aber damit war es der vom Könige ironisch gemeinten Ehren noch nicht genug. Der Gelehrte des Tabakskollegiums wurde in den Freiherrnstand erhoben, mit sechzehn Ahnen väterlicher und mütterlicher Seite, und zum Kammerherrn ernannt. Das alles mochte für einen jungen Mann wie Morgenstern etwas Verlockendes haben, und doch konnte er sich wohl nicht darüber täuschen, daß diese Würden keineswegs vor dem Hohne des Königs und seiner Umgebung schützen konnten. Pflegte man doch dem Herrn von Gundling allerlei Figuren von Eseln, Affen und Ochsen an sein Staatskleid zu heften, zwang man ihn doch, aus den Zeitungen über seine eigene Person die boshaftesten Artikel vorzulesen, welche der König selbst an die Redaktionen hatte schicken lassen; man setzte ihm einen Affen zur Seite, der ganz so wie er selbst gekleidet und mit dem Kammerherrnschlüssel geschmückt war. In Wusterhausen, wo stets einige junge Bären im Schloßhof herumliefen, legte man dem armen Gundliug ein paar davon ins Bett, und obschon ihre Vorderfüße verstümmelt waren, so hätten sie ihn doch fast totgedrückt. Ein andermal schrieb Gundlings Nebenbuhler im Tabakskollegium, Faßmann, eine derbe Satyre gegen diesen unter dem Titel „Der gelehrte Narr“ und mußte sie Gundling im Kollegium überreichen. Dieser, hochroth vor Zorn, ergriff eine zum Pfeifenanbrennen mit glühendem Torfe gefüllte kleine Pfanne und warf sie Faßmann ins Gesicht. Sofort bearbeitete der Angegriffene, nach den nöthigen Vorbereitungen, vor den Augen des Königs Gundling derart mit der Pfanne, daß derselbe vier Wochen lang nicht zu sitzen vermochte. Seitbem kam es öfters zum Faustkampf zwischen den gelehrten Herren. Sogar eine Leichenfeier ins Lächerliche zu ziehen, scheute sich der König nicht: er ließ Gundling, als dieser starb, in einem mächtigen Weinfaß begraben, trotz aller Einsprüche der Geistlichkeit! Und jene Züchtigung mit der Rauchpfanne, das Begräbniß im Weinfaß waren „Auszeichnungen“ für den Nachfolger von Leibniz, für den Präsidenten der Berliner Akademie! Die Gelehrten waren dem König nur „Pedanten, Tintenkleckser, Schmierer“, und er behandelte sie demgemäß.
Wenn Morgenstern sich durch das alles nicht irremachen ließ und nach Gundlings Ehren trachtete, so glaubte er vielleicht, das Mißgeschick seines Vorgängers vermeiden zu können. Gundling hatte alle Würde dadurch eingebüßt, daß er ein Säufer geworden war. Auch kam es Morgenstern zu statten, daß er nicht der einzige war, der die Rolle eines Hofprofessors und Hofnarren, welche [737] beide innig verschmolzen waren, zu spielen hatte. Sein Genosse war ein entlaufener Mönch, ein Tiroler Namens Graben zum Stein, im Spott Graf zum Stein genannt und ebenfalls hoher Ehren gewürdigt; denn er wurde Vicepräsident der Akademie und Ceremonienmeister. In dem Diplom, das dem Vicepräsidenten am 19. Januar 1732 ausgestellt wurde, mußte sich nicht nur dieser „Astralicus“, wie sein Spottname lautete, sondern auch die ganze Akademie den bittersten Spott gefallen lassen; sie sollte darüber wachen, daß die Kobolde, Alpen, Irrwische, Wassernixen, verwünschte Leute und Satansgesellen ausgerottet würden; wenn der Graf zum Stein dergleichen Ungethier tot oder lebendig bei dem König einliefern würde, solle er für das Stück sechs Thaler Belohnung erhalten. Die vergrabenen Schätze sollte man mit der Wünschelruthe durch Segenssprüche, Allrunken und auf andere Art heben, wobei der Graf zum Stein den vierten Theil davon erhalten werde. Die Kalender müsse er so einrichten, daß die Prognostica glücklich getroffen, der guten Tage soviel als möglich eingesetzt, die bösen aber vermindert würden. Der Graf habe ferner Anzeige zu machen, wenn der Thierkreis sich am Himmel verrücke, Mars einen freundlichen Blick auf die Sonne werfe oder mit der Venus, dem Saturn und dem Mercurius im Quadrat stehe.
Es scheint in der That, daß die schlimmste Erbschaft Gundlings auf die Schultern des „Grafen“ abgeladen wurde, während der Knirps Morgenstern trotz seiner ihn zum Hofnarren stempelnden Erscheinung ein gewisses Ansehen zu behaupten wußte. Das hinderte freilich nicht, daß der König unter Beiziehung des Tirolers auch mit ihm einen Hauptspaß veranstaltete, um zu zeigen, wie gründlich er die Gelehrsamkeit verachte. Morgenstern und Astralicus sollten an der Hochschule zu Frankfurt an der Oder ein wissenschaftliches Duell ausfechten über das Thema „Gelehrte sind Salbader und Narren“.
Am 10. November 1737 kam der König in einem Jagdwagen, neben welchem Morgenstern einherritt, nach Frankfurt. Tags darauf fand die Disputation statt. Der König war mit seinen Offizieren frühzeitig erschienen; Morgenstern hatte das Katheder bestiegen und zwar in einer merkwürdigen Kleidung. Er trug ein mit lauter silbernen Hasen gesticktes blausamtenes Kleid mit großen rothen Aufschlägen, eine rothe Weste, eine sehr große über den ganzen Rücken herunterhängende Perücke, statt des Degens einen Fuchsschwanz und auf dem Hute statt der Federn Hasenhaare. Der König hatte den Professoren durch die Pedelle ansagen lassen, sie möchten erscheinen, um Morgenstern zu opponieren; doch fehlten viele Professoren, als der König schon an Ort und Stelle war. Er ließ sie holen und sagte zu den Offizieren: „Morgenstern ist klüger als alle Professoren. Ein Quentchen Mutterwitz ist besser als ein Zentner Universitätsweisheit.“
Man erstaunt, wenn man in diese Komödie berühmte Namen mitverwickelt sieht, welche der Wissenschaft zur Ehre gereichen. Der Rektor der Universität war der Geheime Rath Johann Jakob Moser, ein Württemberger, mit Recht der Vater des deutschen Staatsrechts genannt, zugleich ein Mann von unabhängiger Gesinnung, der später für seinen Mannesmuth im Kampfe für die ständischen Rechte Württembergs gegenüber dem gewaltthätigen Herzog Karl mehrere Jahre lang in der Festung Hohentwiel eingekerkert wurde. Auch in Frankfurt gab er sich nicht dazu her, die Wissenschaft zum Harlekinsspiel zu erniedrigen und weigerte sich entschieden dem Dr. Morgenstern zu opponieren. Dieser Mannesstolz vor Königsthronen schien doch seine Wirkung nicht zu verfehlen; wenigstens hielt es der König für angebracht, etwas zu äußern, was fast wie eine Entschuldigung klang. „Was ist’s denn?“ meinte er. . „Jeder Mensch hat seinen Narren; ich habe den Soldatennarren. Einer (auf Moser deutend) hat den geistlichen Hochmuthsnarren, ein anderer einen anderen; es ist ja nur erlaubter Spaß!“ Nachdem er sich so mit seinem Gewissen abgefunden hatte, rief er den Studenten zu: „Scheut Euch nicht, Jungen, tretet näher und beweist Morgenstern, daß er ein Narr ist.“
Jetzt begann ein unbeschreiblicher Tumult; Morgenstern wußte sich vor dem Andrang der beweiskräftigen Jugend nicht zu helfen, und der Rektor selbst mußte eingreifen, um die Ruhe wieder herzustellen. Es fanden sich mehrere Professoren die den Stolz Mosers nicht theilten und auf den Spaß des Königs eingingen. So entwickelte sich ein scharfes Wortgefecht, bis nach einer Stunde der König innehalten ließ. Er machte Morgenstern ein großes Kompliment, drehte sich um, pfiff und klatschte in die Hände. Alle Anwesenden folgten seinem Beispiel.
Morgenstern blieb bis zum Tode Friedrich Wilhelms I. dessen Vertrauter, das erfahren wir aus seinen eigenen Aufzeichnungen. Der König schloß sich mehrmals mit ihm ein und ließ sich von ihm ungestört über alle Hof- und Familiengeschichten Auskunft geben. Morgenstern war eben darin aufs beste bewandert, wie er denn überhaupt zum Spionieren ein angeborenes Talent hatte. Doch war er unparteiisch in seinen Berichten und trat niemand zu nahe. Die Königin wußte dies wohl; sie ertheilte ihm eine Belohnung und sagte ihm ihren Schutz zu.
König Friedrich Wilhelm I. dachte schon im Jahre 1738 ernstlich daran, abzudanken – darüber lassen Morgensterns Denkwürdigkeiten keinen Zweifel übrig. Es war dem König vollkommen Ernst damit, und in langen Gesprächen mit seinem Günstling wurde erwogen, was nach der Abdankung geschehen solle. Anfangs wollte sich der König nach Wusterhausen zurückziehen, dann aber in die Niederlande, und es wurde von ihm und Morgenstern ein genauer Plan ausgearbeitet, wie das alles künftig eingerichtet werden, wo der König seinen Wohnsitz aufschlagen, ja sogar, welche Kleider er tragen solle. Es war da von einem ganz braunen Tuchkleid und schwarzseidenen Strümpfen mit Wickeln die Rede. Noch auf seinem Kranken- und Sterbebett kam der König auf diesen Plan zurück und verhandelte darüber aufs neue mit Morgenstern, der auch in der letzten schweren Zeit nicht von seiner Seite wich.
Der kleine Gelehrte war ein findiger Kopf und sehr verwendbar fürs Auskundschaften und Vorbereiten großer Pläne, das erkannte auch Friedrich II., der Morgenstern in seinen Stellungen beließ, nachdem er die Regierung angetreten hatte. Kaum hatte er die Absicht gefaßt, Schlesien zu erobern, als er den Vertrauten seines Vaters, das unscheinbare Männlein, in die schlesische Hauptstadt schickte, um dort die nöthige Stimmung für den beabsichtigten Staatsstreich hervorzurufen, der die gute Stadt Breslau, die sich, so abhängig sie von österreichischen Einflüssen war, doch ihrer Unabhängigkeit rühmte, in eine preußische Stadt verwandeln sollte. Und nun zeigte sich das merkwürdige Schauspiel, daß ein in Hofkreisen heimischer Gelehrter, der sich zu allerlei Narrheiten hatte hergeben müssen und unter dem Stockregiment eines Gewaltherrschers zu stehen gewohnt war, sich auf einmal in einen Volksredner und Volksverführer zu verwandeln wußte und auf die Bürger und Handwerker von Breslau den größten Einfluß gewann. Morgenstern war der beredsame Wühler, welcher dem Vorgehen des Königs Friedrich II. von Preußen in Schlesien die Bahn öffnete.
Friedrich hatte das Schwert gezogen, die Preußen waren in Schlesien eingerückt. Das Oberamt in Breslau und ein Theil des Rathes waren österreichisch gesinnt und unterstützten die Forderung der Oesterreicher, Breslau möge die kaiserlichen Truppen aufnehmen. Dagegen aber wandten sich die Zünfte und die Bürgerschaft, sich auf das alte Recht der Stadt stützend, neutral zu bleiben, eigene Besatzung zu haben und beiden feindlichen Heeren die Pforten zu verschließen. Einer der eifrigsten Vorkämpfer dieses Rechts war der Beischuster Döblin, der sein Handwerk längst beiseite geworfen sich auch nie in der Schusterzunft großen Ansehens erfreut [738] hatte, weil er keine selbständigen Kunstwerke lieferte, sondern Stiefel und Schuhe nur zu flicken und zu besohlen pflegte. Dafür war er ein gewaltiger Redner vor dem Herrn und nach dieser Seite hin zollten ihm alle Zünfte ohne Ausnahme begeisterte Anerkennung.
Mit dem Beischuster schloß nun Morgenstern innige Freundschaft; er gab sich zunächst Mühe, Stimmung zu machen und das Volk einzunehmen für den jungen König von Preußen, dessen Vorzüge er in das hellste Licht zu setzen wußte. Und wenn die beiden im Breslauer Rathskeller ihre feurigen Reden hielten, so vergaßen alle, auf die „Lümmelglocke“ zu hören, welche das Zeichen gab, den Keller zu schließen. Der Hofrath und der Beischuster standen auch an der Spitze der Volksmenge, die, ins Rathhaus eindringend, den hohen Rath nöthigte, den Einmarsch österreichischer Truppen abzulehnen und die Selbständigkeit der gemeinen und freien Stadt Breslau aufrecht zu erhalten. Friedrich unterschrieb den Vertrag der Neutralität, aber mit dem Zusatz „unter den jetzigen Konjunkturen und so lang sie dauern werden“, ein Zusatz, auf den die Weisheit der Breslauer Rathsmänner nicht sonderlich achtete. Dr. Morgenstern hatte inzwischen über die Stimmung der Breslauer dem König genauen Bericht erstattet, und dieser hielt bald darauf als Gast des Rathes seinen Einzug in die Stadt, auf schnaubendem Schimmel, im blausamtenen Kleide mit weißen Achselbändern, mit dem silbernen Sterne geschmückt, über all dem Glanze einen schlichten blauen Mantel. Das war der erste Triumph des kleinen Morgenstern, denn hinter diesem harmlosen Einzug und der Gastfreundschaft der neutralen Stadt lauerten ganz andere Dinge!
Doch es bedurfte zum völligen Triumphe vor allem eines Sieges: das österreichische Heer mußte geschlagen werden, und das geschah in der ruhmreichen Schlacht bei Mollwitz. Nun brauchte der König Geld und schrieb eine Steuer aus für ganz Schlesien — die Beredsamkeit Morgensterns und seines Genossen Döblin brachte es dahin, daß die Breslauer Zünfte sich aus freien Stücken erboten, diese Steuer mit aufzubringen. Darauf konnte sich der kleine Doktor viel zugute thun; denn es gehört zu den seltensten Ereignissen der Geschichte, daß sich eine Bürgerschaft dazu drängt, eine freiwillige Steuer zu zahlen und als dann nach der Schlacht bei Mollwitz die Oesterreicher sich durch Hinterlist der schlesischen Hauptstadt zu bemächtigen suchten, wobei Intriguen der Nonnen und der adeligen Damen, jene bekannte „Verschwörung der Frauen“, mitspielten, da war Morgenstern mit seiner feinen Spürnase wieder auf dem Platze und half nach Kräften diese geheimen Gespinste entwirren und den Einzug der preußischen Truppen, der jetzt eine politische Nothwendigkeit geworden war, vorbereiten. So hatte dieser „Hofnarr als Demagoge“ nicht geringen Antheil daran, daß Breslau eine preußische Stadt wurde.
Morgenstern verscherzte auch später nicht die Gunst des großen Königs, der ihn zum Vicekanzler von Schlesien ernannte. 1756 wurde er von Friedrich nach Potsdam berufen, wo er bis zu seinem Tode am 16. November 1785 blieb. Der kleine Mann hatte ein Alter von fast 80 Jahren erreicht.
Das nachgelassene Werk von Hofrath Morgenstern „Ueber Friedrich Wilhelm I.“ erschien im Jahre 1793. Es ist eine sehr beachtenswerthe Schrift, denn Morgenstern war wie wenige in der Lage, ein Charakterbild dieses eigenartigen Fürsten zu entwerfen, dessen Vertrauen er bis zuletzt genoß; er verschweigt seine Fehler nicht, aber er entschuldigt sie und rechnet am Schlusse den König zu den wahrhaft großen Fürsten, die für das Glück ihrer Völker regiert haben.
Der Verfasser selbst, eine der buntscheckigsten Persönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts – Gelehrter, Diplomat und Hanswurst, je nachdem die eine oder die andere dieser Schubladenrollen angebracht war oder auf höheren Befehl gespielt werden mußte, gehört weder zu den Zierden der deutschen Wissenschaft, noch zu den Staatsmännern von Ruf und Bedeutung; sein Charakter war nicht makellos; er war geizig, eigensinnig und Anhänger einer cynischen Denkweise; für die Stellung der Gelehrten jener Zeit aber ist dieser närrische Kauz neben Gundling in hohem Maße bezeichnend, er ist überhaupt eines der eigenartigsten und drolligsten Exemplare, welche die deutsche Professorengeschichte aufzuweisen hat.
Blätter und Blüthen.
Distanzritt und Humanität. In den ersten Oktobertagen hat sich zwischen Berlin und Wien ein Schaustück abgespielt, das die Augen von ganz Europa auf sich lenkte und die öffentliche Aufmerksamkeit, insbesondere in Deutschland und Oesterreich-Ungarn, lebhaft beschäftigte.
Es war ein Wettreiten veranstaltet zwischen deutschen und österreichisch-ungarischen Offizieren, und zwar in der Weise, daß die Deutschen von Berlin nach Wien, die Oesterreicher von Wien nach Berlin zu reiten hatten. Hohe Preise waren für die Flinksten ausgesetzt, und zu dem Sporn, der in diesen respektablen Summen und in zwei Ehrenpreisen lag, trat noch der landsmannschaftliche Ehrgeiz – wer reitet besser, der Deutsche oder der Oesterreicher?
Ein tapferes Reiterstück, männliche Kraft, Geistesgegenwart und Ausdauer wissen auch wir zu schätzen, und wenn es bei dem geblieben wäre, was anfangs wohl mit diesem Distanzritt in Aussicht genommen war, nämlich zu zeigen, was ein tüchtiger Reiter mit seinem guten Rosse leisten kann, ohne das letztere zu Schanden zu reiten, so hätten die Sieger allgemeinen Beifalls sicher sein dürfen. Aber es ist leider ganz anders gekommen!
Es wurde geritten, schneidig und scharf, Tag und Nacht, mit spärlicher Ruhe und spärlicher Nahrung, erst wohl in fröhlichem Trab, zuletzt in hastigem Voranhetzen – und sie kamen an, die edlen Renner, todmüde und abgetrieben, mit sporenzerfetzten Flanken und striemenbedecktem Leib, mit hängender Zunge und stumpfen verglasten Augen, wenige Stunden am Ziele, und sie mußten elend verenden, wenn sie nicht schon unterwegs auf der Strecke geblieben waren, einer um den anderen ein Opfer für – ja, was war’s, wofür sie geopfert wurden?
Es gehört zu den Obliegenheiten unserer Heeresleitung, sich über die Leistungsfähigkeit des ihr zu Gebote stehenden Materials an Menschen und Thieren Klarheit zu verschaffen. Es ist dies von höchster Bedeutung für den Krieg, also für die Vertheidigung des Vaterlandes. Hätte sich der Ritt in dem durch diese Pflicht gegebenen Rahmen gehalten, hätte man sich, wie es zweifellos der schon angedeutete ursprüngliche Gedanke der Veranstalter war, darauf beschränkt, festzustellen, wieviel ein geübter Reiter auf gut eingerittenem, sorgfältig trainiertem Pferde im Dauerritt zu leisten vermöge, ohne dabei samt seinem Rosse dienstunfähig zu werden, so hätte sich dagegen nichts einwenden lassen.
Leider ist die Ausführung diesem Gesichtspunkt nicht treu geblieben. Die Idee des Distanzritts Berlin-Wien verwandelte sich während der Ausführung in eine reine Sportsidee, und diese Ausartung des ursprünglichen Plans ist es, welchem von rund zweihundert edlen Pferden an die dreißig zum Opfer gefallen sind, derer nicht zu gedenken, die infolge der ubermäßigen Anstrengungen zu elenden Krüppeln herabgesunken sind, kaum noch fähig, als Droschkengäule traurigster Sorte ihr Dasein zu beschließen.
Und darum hat sich mit Recht die öffentliche Meinung empört über die Scenen, die sich in diesen Oktobertagen zwischen dem Tempelhofer Steuerhäuschen und Floridsdorf abgespielt haben! Wie, dürfen wir künftig mit pharisäischem Gesittungshochmuth auf die Stiergefechte der Spanier herabschauen? Wie, dürfen wir auch künftig dem armen Karrenführer die Polizei auf den Hals schicken, wenn er um seines kümmerlichen Erwerbes willen sein kläglich verkommenes Thier einmal übermäßig anstrengt und es mit grausamen Peitschenleben vorwärts treibt? Wahrlich, zwischen Wien und Berlin ist Schlimmeres geschehen in diesen Tagen, und die, welche die Verantwortung dafür tragen, können nicht die Entschuldigung für sich beanspruchen, daß sie nicht wußten, was sie thaten.
Man sage nicht: wer konnte ahnen, daß es so gehen würde! Wir können nicht annehmen, daß die Theilnehmer an dem unheilvollen Ritte sich über die Leistungsfähigkeit ihrer Pferde so sehr im Unklaren befunden haben, daß sie die Folgen nicht hätten voraussehen können; jedenfalls mußten sie im Verlauf des Ritts die unzweideutigste Aufklärung gewinnen, wohin die Ueberspannung sie führen würde, und sie mußten die Aufregung, welche sie dem Ziele entgegentrieb, bemeistern.
Nun das Unglück geschehen ist, bleibt uns nur noch übrig, die Hoffnung auszusprechen, daß ein derartiger Versuch in diesen Formen nicht wiederholt [739] werde. Wir aber reichen den Preis denjenigen Reitern, denen menschliches Mitgefühl mit ihren Thieren über sportlichen Ehrgeiz ging und die unterwegs lieber den weiteren Wettbewerb aufgaben, als daß sie sich zu Mitschuldigen an einer jammervollen Thierquälerei gemacht hätten!
Die Wollspinne. (Mit Abbildung S. 738). Es dürfte wenige Pflanzengebilde geben, welche ein vom Herkömmlichen so abweichendes Aeußere besitzen wie die Wollspinne oder Grapple-plant (Harpagophyton procumbens), von welcher unsere Abbildung eine mittelgroße Frucht in halber Größe darstellt. Die ausdauernde, krautige Pflanze ist in Südwestafrika einheimisch, hat also für unsere Kolonialfreunde noch ganz besonderes Interesse. Sie kriecht am Boden entlang und entwickelt auch auf demselben ihre Früchte. Die Ursachen für ihre wunderliche Gestaltung lassen sich unschwer finden. Die an der Erde liegenden Früchte könnten nur schwer verbreitet werden, wenn sie nicht besondere Einrichtungen besäßen,
welche eine Weiterbeförderung ermöglichen. Als solche Verbreitungsausrüstungen wirken nun die mit starken Haken besetzten Arme, welche in trockenem Zustand sämmtlich etwas aufwärts gekrümmt sind. Wehe dem Thiere, das auf eine solche zähholzige Frucht tritt. Die Arme klammern sich an den Fuß des unglücklichen Opfers, peinigen uud martern es, so daß es vor Schmerz davon flieht und sich unterwegs durch Stoßen und Stampfen von dem Unhold zu befreien versucht. Dabei wird die Frucht schließlich an der Spitze gesprengt und die Saaten fallen nach und nach aus der oberen Oeffnung, weit entfernt von dem Standorte der Mutterpflanze. Die in Südafrika in großen Herden vorkommenden Wiederkäuer, besonders Antilopen, dann aber auch das von den Europäern eingeführte Rindvieh sind die hauptsächlichsten Verbreiter der Pflanze. Uebrigens zeigen Verwandte dieser zu der Familie der Pedaliaceae gehörigen Art ebenfalls ähnliche Haftvorrichtungen, wie z. B. das bisweilen in Gärten gezogene Gemshorn (Martynia proboscoidea). Udo Dammer.
Wohnung und Krankheit. Als die Cholera vor wenigen Monaten an der Küste des Kaspischen Meeres den Boden von Europa betrat, da fehlte es nicht an gewichtigen Stimmen, die das Vorhandensein einer Gefahr für Deutschland leugneten. Andere sahen schwärzer und behielten leider recht. Die Cholera wußte die Verkehrsmittel der Neuzeit, die Dampfer und Eisenbahnen zu benutzen, in raschem Fluge durchbrauste sie die weite Länderstrecke vom Kaspischen Meere bis zur Ostsee, und ehe der Sommer zur Neige ging, forderte sie auch schon ihre Opfer auf den Schiffen, die jenseit des Oceans im Hafen von New-York lagen. Indem die Cholera so auch bei uns Tausende niederstreckte, gab sie die empfindliche Lehre, daß die Fortschritte der Hygieine in den Großstädten noch nicht zur vollen Geltung gelangt sind. Ein Umstand war es vor allem, der in Hamburg neben der schlechten Beschaffenheit des Trinkwassers der Ausbreitung der Seuche Vorschub leistete – der mangelhafte Zustand der Wohnungen.
Im letzten Halbheft der „Gartenlaube“ ist das Kapitel „Gesundheit und Städteerweiterung“ behandelt und dabei ausgeführt worden, daß es Pflicht der Gemeinde und des Staates sei, für gesunde Wohnungen zu sorgen. Wir wollen heute unsere Aufmerksamkeit auf eine andere Seite der Sache richten. Auch wenn der Staat und die Gemeinde in der angeführten Richtung ihre Pflicht vollauf gethan haben, so ist damit doch nur die Hälfte der Aufgabe gelöst, denn das zweckmäßig gebaute Haus allein schützt uns nicht, es kommt noch darauf an, wie wir es erhalten, wie wir in ihm leben. In den herrlichsten Palästen kann man ungesund wohnen.
Man braucht dabei nicht bloß an die Cholera zu denken, die uns nur in Zwischenräumen heimsucht, andere Seuchen bedrohen uns zu jeder Zeit und fordern mehr Opfer als jene asiatische Plage. Da ist der gefürchtete Typhus, der Würgengel der Kinderwelt – die Diphtherie und der schlimmste Feind der europäischen Menschheit, die Tuberkulose. Gegen diese und andere einheimischen Feinde müssen wir stets gerüstet sein, und wenn wir es sind, dann sind wir auch gegen die Cholera gewappnet und brauchen sie nicht zu fürchten.
Die Natur der Seuchen ist erst seit wenigen Jahren erkannt worden, und neu sind noch die Maßregeln die zur Verhütung dieser Geißeln der Menschheit angewendet werden sollen. Daraus erklärt es sich, daß sie weiteren Volkskreisen nicht genügend bekannt sind und daß hier Unterlassungssünden selbst dort vorkommen, wo eine Schar gebildeter Männer über das Wohl und Wehe der Stadt zu wachen hat. Noch mehr werden aber solche Unterlassungssünden in der privaten häuslichen Hygieine begangen. Eine Wandlung zum Besseren kann nur durch zweckmäßige Belehrung des Volkes erzielt werden. Die Schule bietet in dieser Beziehung fast nichts, die Schüler verlassen meist die Schulbänke, ohne auch nur die wichtigsten Grundsätze der Gesundheitspflege zu kennen. Hier wäre also zuvörderst Hand anzulegen. Aber selbst wenn das ausgeführt wird, so wird doch mit der Schulweisheit allein auch in der Zukunft niemand sein Leben durch auskommen. Er muß sich vielmehr selbst fortbilden, muß Zeit finden, nicht nur Tagesblätter und Romane, sondern auch belehrende Bücher zu lesen. Diese Mahnung bezieht sich aber nicht allein auf Männer, sondern noch mehr auf Frauen. Die Frau waltet am häuslichen Herde, sie sorgt für die Erhaltung und Reinlichkeit der Wohnung, sie ist bei Krankheitsfällen in der Familie die erste naturgemäße Pflegerin, und so ist auch ihr Verhalten von der höchsten Bedeutung für das Gesunderhalten der Wohnung. Es ist darum von größter Wichtigkeit, die Hausfrauen hygieinisch auszubilden und sie zu lehren, wie den Keimen der Seuche der Zutritt zum Hause gewehrt, wie ein trotzdem entstandener Krankheitsherd mit einfachen Mitteln, namentlich durch eine vernünftige Krankenpflege, unterdrückt werden kann.
Dieses Ziel der Aufklärung, das heute in Anbetracht der Choleragefahr auch den sonst Gleichgültigeren so dringend erstrebenswerth scheint, das aber in Wirklichkeit stets und unablässig zu verfolgen ist, hat C. Falkenhorst in seinem volksthümlichen „Buche von der gesunden und praktischen Wohnung“ verfolgt. Er bietet dem Leser hier eine erschöpfende Darstellung der Haushygieine in einer Form, die anregend wirkt, vor allem aber widmet er der Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten und einer vernünftigen Krankenpflege Beachtung. Wir möchten es darum als ein zeitgemäßes Fortbildungsbuch, als einen zuverlässigen Rathgeber allen denjenigen empfehlen, die als Hausvorstände über das gesundheitliche Wohl der Familie zu wachen haben.
Das Blücher–Denkmal für Caub. (Mit Abbildung.) Der Gedanke, dem geschichtlich denkwürdigen Uebergang Blüchers über den Rhein bei Caub einen Merkstein der Erinnerung zu widmen, ist kein neuer. Schon zwei Denksteine kennzeichnen die Stelle, wo die ersten Truppen der vereinigten preußisch-russischen Armee das linke Rheinufer in der Nacht vom 31. Dezember 1813 auf den 1. Januar 1814 erreichten, und den Plan, ein Denkmal für Blücher hier zu errichten, faßte schon vor nahezu zehn Jahren der jetzige Bürgermeister des Badeortes Neuenahr am Niederrhein, der Rittmeister a. D. Hepke. Kaiser Wilhelm I. stimmte seiner Absicht aufs lebhafteste zu, und nur der Umstand, daß die Sammlungen für das Nationaldenkmal auf dem Niederwald durch anderweitige Aufrufe nicht durchkreuzt werden sollten, machte eine vorläufige Verschiebung wünschenswerth. Sobald dann das Niederwalddenkmal fertig war, stand der Inangriffnahme des Projektes nichts mehr entgegen, und heute darf man annehmen, daß die Vollendung des Werkes in nächster Zeit zur Thatsache werden wird. Schon sind etwa 36000 Mark vorhanden, während etwa 50000 Mark benöthigt werden. Die Grundsteinlegung soll im nächsten Frühjahr stattfinden.
Als Platz für das Denkmal ist in Aussicht genommen eine Uferstelle in Caub, welche den Vorzug eines höchst malerischen Hintergrundes hat. Wohl wird ein weiter Ausbau in den Rhein hinein, eine Art Terrasse nöthig werden, um den nöthigen Raum zu gewinnen, aber der Denkmalsausschuß dürfte nicht ohne Erfolg auf die patriotische Theilnahme der deutschen Nation sich verlassen. Die Mehrkosten für diese Anlage werden sicher noch durch Gaben aus allen Gauen Deutschlands gedeckt werden.
Professor Fritz Schaper in Berlin ward dazu ausersehen, das Standbild zu schaffen, seit wenigen Tagen ist es im Modell vollendet, und wir zweifeln nicht, daß die ausgezeichnete Schönheit des Kunstwerks, von der auch unser Bild eine Vorstellung zu geben vermag, dazu beitragen werde, die weiteren Sammlungen kräftig zu fördern. Schapers Auffassung der Gestalt des volksthümlichen Helden ist eine ganz vortreffliche. Rückblickend auf die heranrückenden Heerscharen, deutet er den Weg an, den die Truppen zu beschreiten haben. Der Mantel fliegt im eisigen Winde der Winternacht, das Antlitz zeigt mit besonderer historischer Treue die gutmüthigen Züge des tapferen Führers, die an ihm stets gerühmt wurden.
Und so wird sich denn in kürzester Frist an denkwürdiger Stelle das Bild des Marschalls Vorwärts erheben, zur Erinnerung an den Helden, dem Goethe in einer Grabschrift die Worte gewidmet hat:
„In Harren und Krieg, in Sturz und Sieg,
Bewußt und groß – so riß er uns vom Feinde los.“
Die neue Prachtausgabe von Uhlands Gedichten, welche soeben im Cotta’schen Verlag erschienen ist, wird ein großer Theil unserer Leser gewiß mit Freuden begrüßen. Es gab ja schon eine ältere Prachtausgabe der Uhlandschen Dichtungen. Hervorragende Künstler, ja die ersten Meister, wie Makart, Camphausen, Gabriel Max u. a., hatten daran mitgearbeitet und Zeichnungen beigesteuert, die man noch heute mit frischem Genuß betrachtet. Anderes freilich fiel der Veraltung anheim, auch die Technik der Vervielfältigung ist seitdem fortgeschritten. Kurz, es bedurfte einer Neugestaltung des alten Werkes, und diese ist nunmehr abgeschlossen. Eine Reihe begabter Künstler hat die Lücken gefüllt, welche unter dem Zwange des veränderten Geschmacks der Neuzeit in den alten Bilderschmuck gerissen werden mußten. Unsere heutige Nummer enthält zwei Proben aus der Reihe der neu hinzugekommenen Illustrationen, von denen die auf S. 716 eine Scene aus dem bekannten Liede darstellt: „Was klinget und singet die Straß’ herauf?“ während das Vollbild S. 717 die anmuthige Romanze von „des Goldschmieds Töchterlein“ begleitet. So bietet sich nun das alte Werk in verjüngter Gestalt, dabei zu einem wesentlich billigeren Preise, dem Leser dar. Gewiß wird die neue Prachtausgabe viel dazu beitragen, Uhlands Dichtungen heimisch zu machen unter seinem Volke.
Das Gesicht. (Zu unserer Kunstbeilage.) Die „Gartenlaube“ hat in der Kunstbeilage zu Halbheft 11 dieses Jahrgangs eine anmuthige Darstellung [740] des „Geschmacks“ gebracht, die dem Wiener Maler R. Rößler gelungen ist. Aus der Hand desselben Künstlers bringen wir heute eine Versinnbildlichung des Gesichts, hübsch erdacht und in ansprechender Gruppierung ausgeführt. Mit unverhohlenem Gefallen schmückt sich die Frauengestalt, die das Gesicht verkörpert, vor dem Spiegel, den ihr ein hilfsbereiter Putto vorhält, während ihr ein zweiter, selbst entzückt vom Glanz der edlen Metalle und Steine, die schimmernden Juwelen reicht. Als Sinnbild der Eitelkeit wiegt sich im Hintergrund ein Pfau: sehen, sich gefallen, gesehen sein wollen und Selbstgefälligkeit liegen nahe beieinander.
Kleiner Briefkasten.
C. V. in Lübz. Vor den Nicholsonschen Ohrtrommeln haben wir bereits im Jahrgang 1890 der „Gartenlaube“, Halbheft 1, dringend gewarnt.
H. in Ratibor. Das Ueberwintern der Goldfische bietet in mäßig geheiztem Raume gar keine Schwierigkeiten. Man giebt den Fischen nur weniger Futter als im Sommer.
G. Sch. in Pegli. Herzlichen Dank! Wir können Ihnen die Mittheilung machen, daß unser Aufruf zu gunsten des Erfinders F. G. Keller immerhin einigen Erfolg gehabt hat, leider noch nicht den, daß die größeren Papierfabriken mit namhafteren Summen für ihn eingetreten wären. Erfreulich ist dagegen, daß eine englische Fachzeitschrift, „The worlds paper trade review“, infolge unserer Anregnng auch in England für Keller wirbt.
Schachaufgabe Nr. 8.
Lösungspreisaufgabe vom VII. Turnier des Deutschen Schachbundes. (Dresden 1892.)
Von R. Weinheimer in Ottakring.
SCHWARZ

WEISS
Weiß zieht und setzt mit dem dritten Zuge matt.
Aus den elf Buchstaben des Wortes „Estremadura“ sind durch Umstellen sechs Wortpaare zu bilden. Dieselben bezeichnen: 1. eine Stadt in Ost-Indien und eine Gesinnungsart, 2. eine Insel im Indischen Ocean und einen Fluß in Deutschland, 3. einen deutschen Geschichtschreiber und eine Stadt in Hannover, 4. eine Blume und einen General Napoleons I., 5. einen deutschen Dichter und einen Präsidenten der nordamerikanischen Union, 6. einen Schiffstheil und eine Dichtungsart. – In jedem Wortpaare müssen sämmtliche Buchstaben des Wortes „Estremadura“ Verwendung finden. A. St.
Mit Hilfe eines Rösselsprungs sind aus den Buchstaben dieses Quadrats sieben Wörter von je sieben Buchstaben zu bilden. Dieselben bedeuten: einen traumähnlichen Zustand, 2. einen türkischen Titel, 3. eine Stadt in Persien, 4. das Gebiet eines Bischofs, 5. eine Stadt des Alterthums auf Euböa, 6. ein Feldhuhn, 7. eine deutsche Universitätsstadt. – Werden die gefundenen Wörter in die wagerechten Reihen des Quadrats eingetragen, so nennen die Buchstaben der ersten senkrechten Reihe den Verfasser und die der letzten den Titel eines in der „Gartenlaube“ veröffentlichten Romans.
In jedem der nachstehenden Sätze ist je ein Wort versteckt enthalten, dessen nähere Bezeichnung in Klammern angegeben steht.
Sind alle Wörter richtig gefunden, so nennen die Anfangs- und Endbuchstaben, erstere von vorn nach hinten, letztere von hinten nach vorn gelesen, den Namen eines berühmten deutschen Feldherrn und den Ort einer seiner siegreichen Schlachten.
1. Im elften Jahrhundert war Schwaben noch deutsches Herzogthum. (Ein männlicher Vorname.)
2. Am 26. August 1278 fiel Ottokar II. im Kriege gegen Rudolph von Habsburg auf dem Marchfelde bei Wien. (Ein Glücksspiel.)
3. Die Frage, ob die von Petrarca besungene Laura lediglich ein Bild seiner Phantasie war oder wirklich gelebt hat, ist noch nicht gelöst. (Ein Gebirge.)
4. Eine Gradeintheilung des Thermometers geschah durch Reaumur, Celsius und Fahrenheit. (Eine persische Königin.)
5. Die Schlacht von Courcelles, auch die von Colombey-Nouilly genannt, eröffnete in dem letzten deutsch-französischen Kriege die Kämpfe vor Metz. (Eine deutsche Stadt.)
6. Noch am letzten Tage vor seinem Tode arbeitete Mozart an dem berühmten Requiem. (Eine Tragödie Shakespeares.)
7. Schäfers Sonntagslied: „Das ist der Tag des Herrn“, ist eine Dichtung Uhlands. (Eine altnordische Dichtung.)
8. Der Maler Giulio Romano war ein Schüler Raphaels. (Ein berühmtes Fürstengeschlecht.)
[ Verlagswerbung Ernst Keil's Nachfolger für Neuauflage Gedichte von Ernst Scherenberg.]
- ↑ Wir bitten um Verbreitung dieses Gedichtes mit dem Hinweis auf unsere Sammlung. Die Redaktion.
- ↑ Vergl. Halbheft 12 dieses Jahrgangs.