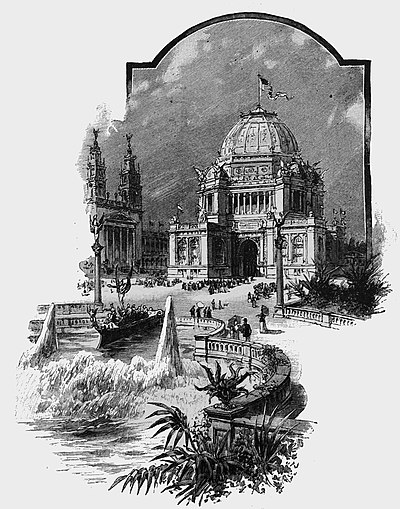Die Gartenlaube (1892)/Heft 18
[549]
| Halbheft 18. | 1892. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Jahrgang 1892. Erscheint in Halbheften à 25 Pf. alle 12–14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3–4 Wochen vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Ketten.
Otto Berry hatte sein heißersehntes Ziel erreicht, er stak glücklich in der schmucken Uniform eines Kavalleristen. Seine Eitelkeit überwand die für seinen verzärtelten Körper großen Anstrengungen des Dienstes, sie half ihm auch über die schmerzliche Wahrnehmung hinweg, daß durchaus nicht, wie er gehofft, ein müheloses Genußleben für ihn begonnen hatte. An Stelle des Schlenderns in kleidsamer Uniform, des Säbelklapperns und Kaffeehaussitzens, wovon er geträumt, galt es zunächst, einer eisernen Disciplin, hohen Anforderungen an körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sich zu unterwerfen, und manchmal dachte er wohl reuevoll daran, daß dagegen ein Leben im Comptoir an der Seite des nachsichtigen Vaters die reinste Spielerei gewesen wäre. Aber in einem Punkte hatte er sich doch nicht getäuscht, und das versöhnte ihn mit allem anderen: in der gesellschaftlichen Bevorzugung seines neuen Standes. Der Offizierssäbel war das Symbol einer überlegenen Kaste; die höchste Arbeitskraft, ergraute Weisheit, Charakter und Talent, alles stellte der schmale Stahl in Schatten. Was Wunder, daß Otto in seinem aufs Aeußerliche gerichteten Sinn es kaum erwarten konnte, bis auch ihm das ersehnte Reich sich öffnete. Einstweilen mußte er sich wohl oder übel mit der bescheidenen Rolle begnügen, die ihm seine kürzlich erfolgte Ernennung zum Fähnrich gestattete.
Es hatte einer sehr nachdrücklichen Aufforderung des Papas bedurft, um ihn in dieser Stimmung zu veranlassen, bei dem Mahle, das den Fabrikbeamten gegeben wurde, zu erscheinen, und er hatte seine Zusage an die Bedingung geknüpft, einige Kameraden mitbringen zu dürfen. Abgesehen von der Mama, welche er durch diesen vornehmen Zuwachs – es waren Träger hochadliger Namen – geradezu zu Dank verpflichtete, hoffte er auch, dem Vater zu imponieren und ihn versöhnlicher zu stimmen. –
Hans machte zu dem Essen sorgfältig Toilette; er fühlte, daß von diesem ersten Auftreten als selbständiger Mann seine Zukunft abhängig sein könne. Frau Berry schrieb gewiß ihrer Tochter über den Abend nach Paris – wenn es dann hieß, er habe sich schlecht ausgenommen in der vornehmen Gesellschaft! Die Röthe stieg ihm ins Gesicht bei dem bloßen Gedanken. Er war nicht eitel, schon die strenge Arbeit ließ ihn nicht dazu kommen, aber heute betrachtete er sich zum ersten Male
[550] lange im Spiegel. Das rastlose Vorwärtsstreben, die Sorge um den Vater, die Erfahrungen in der „Fackel“ gaben ihm ein älteres Aussehen, als ihm an sich zukam. Ein dunkler Bartanflug ließ die weiße Farbe seines Gesichts um so lebhafter hervortreten. Das schwarze Auge blickte scharf mit frühem männlichen Ernste, die Stirn war umrahmt von kurzlockigem, glänzend schwarzem Haar. Hans konnte nicht für schön gelten, dazu waren seine Züge zu derb und unregelmäßig, aber er hatte schon jetzt einen männlichen Charakterkopf, der durch seine gehaltvolle Kraft auffallen mußte.
Frau Berry war sichtlich überrascht, als der junge Mann in den Salon trat; sie hatte ihn seit Claires Abreise nur selten und dann nur oberflächlich gesehen, und so war er ihr immer noch als Kind, als der Spielgenosse ihrer Tochter in Erinnerung. Heute früh erst hatte sie einen Brief von Claire erhalten, in dem sich diese angelegentlich nach Hans Davis erkundigte; sie hatte sich gefreut über die Gutherzigkeit des Kindes, das mitten im Pariser Leben des armen Knaben gedachte; jetzt beim Anblick des jungen Mannes schoß ihr plötzlich ein ganz anderer Gedanke durch den Kopf. Es war doch eine unverzeihliche Unvorsichtigkeit gewesen, die beiden jungen Leute so lange wie Kinder unbeachtet miteinander verkehren zu lassen! Wie leicht hätte das schlimm ausfallen können . . . oder war es schon schlimm ausgefallen? Hatte Claire aus tiefer liegenden Gründen als aus Gutherzigkeit sich so angelegentlich nach dem alten Kameraden erkundigt? Aber nein, das war ja die reine Unmöglichkeit, Unsinn! Ein Monteur, der Sohn eines Arbeiters, und Claire Berry! Trotzdem sie sich auf diese Weise zu beruhigen suchte, wollte doch der thörichte Gedanke, der sie verfolgte, nicht weichen. Aber sie war nicht gewohnt, sich von halben Befürchtungen lange quälen zu lassen, und beschloß, der Sache rasch auf den Grund zu kommen. Sie war noch allein mit Hans, der sich in seiner freudigen Unruhe fast allzu pünktlich eingestellt hatte, so konnte sie ungestört ihren Zweck verfolgen. Scheinbar harmlos begann sie von der Kindheit ihres Pflegebefohlenen zu reden, von einzelnen Ereignissen daraus, die in enger Beziehung zu Claire standen.
Hans, dessen Herz bei diesem vertraulichen Gespräch und den alten Erinnerungen höher und höher schlug, hatte Mühe, seiner Aufregung Herr zu bleiben. Er war sich bewußt, wie viel er durch ein unvorsichtiges Wort verrathen könne, und widerstand daher lange der Versuchung, sich nach Claire zu erkundigen. Endlich vermochte er doch die langersehnte Frage nicht mehr zurückzuhalten.
„Wie geht es Fräulein Claire?“ Er fühlte, daß er glühend roth wurde, und schlug vor dem forschenben Blicke der Kommerzienräthin verwirrt die Augen nieder.
Frau Berrys Befürchtungen regten sich mit verdoppelter Macht. Mit bewußter Grausamkeit gegen Hans, dessen Frage so herzlich geklungen hatte, erwiderte sie daher leichthin:
„Gut geht es ihr, nur zu gut! Sie vergißt darüber fast ihre Heimath, ihre Eltern. Sie schreibt wenig und, wenn es geschieht, sichtlich zerstreut, mitten aus der Hochfluih des Pariser Lebens heraus. Gott, ich gönne es ihr von Herzen, sie soll ihre Jugend genießen! Aber sie wird nicht mehr zu kennen sein, wenn sie wieder kommt.“
„O, das glauben Sie gewiß nicht, Frau Kommerzienrath!“ erwiderte Hans in einem schmerzlichen Tone.
„Je nun, die Welt ist nun einmal nicht für Kinder da,“ entgegnete sie, „und Claire war ein Kind, ein rechtes Kind, das nie ernst zu nehmen war – immer seinen Einfällen folgend wie damals, als sie ein lebendiges Menschenkind, das jetzt in Gestalt eines jungen Mannes vor mir sitzt, gegen einen Automaten eintauschen wollte.“
Die Räthin sprach nachlässig, scheinbar gleichgültig mit dem Fächer spielend. Doch Hans fühlte deutlich genug die Absicht heraus, ihm den Abstand zwischen Claire und ihm zu zeigen.
„Der Automat liegt längst in der Rumpelkammer, vergessen, werthlos, ein toter Mechanismus; das Menschenkind aber lebt, fängt erst an, recht zu leben, und wird alles dran setzen, nicht auch in die Rumpelkammer geworfen zu werden,“ versetzte er. Seine Schüchternheit war verschwunden; an der Räthin war es jetzt, vor diesen flammenden Augen den Blick zu senken.
In diesem Augenblick betrat Herr Berry den Salon. Hans verneigte sich ehrfurchtsvoll und bedankte sich, noch erregt von dem Gespräch, in überstürzten Worten für seine Beförderung und Einladung.
Herr Berry betrachtete mit Wohlgefallen den jungen Mann. „Na, Emilie, was sagst Du zu unserem Schützling, sieht er nicht besser aus als mancher Kavalier?“ rief er in bester Laune. „Hast Du ihm die Grüße Claires schon ausgerichtet? Sie erkundigt sich in jedem Briefe nach Ihnen, Herr Davis.“
Hans rächte sich durch einen vielsagenden Blick auf die Kommerzienräthin, die ihren Aerger nicht verbergen konnte; ein triumphierendes, spöttisches Lächeln erschien auf seinem Gesicht.
Das Klirren von Säbeln unterbrach die für die Räthin peinliche Scene. Otto trat ein, von zwei Kameraden begleitet.
„Graf Troste“ – „Baron Sina,“ stellte er die beiden Herren seinen Eltern vor, mit Absicht Hans völlig übersehend.
„Herr Davis, Monteur in meiner Fabrik“ – übernahm in auffälliger Weise Herr Berry die Vorstellung seines Schützlings.
„Ah, Sie auch hier? Gar nicht bemerkt – pardon!“ schnarrte Otto in den eben üblichen militärischen Nasenlauten, die er bereits bewundernswerth beherrschte. Eine leise aufsteigende Röthe ließ dabei auf seiner Stirn eine kleine Narbe erscheinen, die Hans wohl kannte.
Inzwischen hatten sich die eingeladenen Beamten im Vorzimmer versammelt, und der Kommerzienrath bot seiner Frau den Arm, um die neuen Gäste zu begrüßen.
Man begab sich zu Tisch. Hans kam auf Anordnung des Herrn Berry mitten unter die Fähnriche zu sitzen, und Otto fand das so unpassend, daß er sich entschuldigen zu müssen glaubte. „Ich sagte es Euch ja voraus – sehr gute Weine, aber etwas gemischte Gesellschaft für heute,“ flüsterte er den Kameraden so laut zu, daß Hans es hören mußte.
Ein Gefühl der Verachtung stieg in diesem auf gegenüber dem feigen Benehmen des einstigen Spielgenossen, gegenüber diesen Herren, die demnach nur den guten Weinen des Herrn Berry zuliebe gekommen waren.
Das allgemeine Gespräch drehte sich anfangs selbstverständlich um geschäftliche Ereignisse. Die neuen großen Bestellungen von Lokomotiven, die der Staat für seine Bahnen in den Berryschen Werken gemacht hatte, beschäftigten die Gemüther; jeden Tag fand man Verbesserungen in der Einrichtung und Vertheilung der Arbeit, machte man neue Erfahrungen in Bezug auf Material und Bauart.
Hans hielt sich bescheiden zurück, obwohl ihm das Besprochene wohl bekannt war und er lebhaften Antheil an der ganzen Sache nahm; handelte es sich doch um seine Lieblinge, die Maschinen, deren geheimste Regungen er belauschte!
Otto unterhielt sich unterdessen angelegentlich mit den Fähnrichen über die jüngsten Vorgänge auf dem Gebiet der Kunst, des Theaters, des Rennplatzes; er sprach über alles in demselben überlegenen, halb geringschätzigen Tone, nur bei der Erörterung der Rennen erwärmte er sich etwas und nahm eine respektvolle, der „Wichtigkeit“ des Stoffes angemessene Haltung an.
Er that sich nicht wenig zu gute darauf, in diesen Dingen schon völlig bewandert zu sein, und wurde nur dann etwas in seinem Selbstgefühl gestört, wenn ihm bei einer nach seiner Meinung besonders gelungenen Behauptung sein Vater einen ironischen, fast verächtlichen Blick zuwarf, der einen schmerzlichen Ausdruck gewann, sobald er auf Hans hinüberschweifte, welcher auf einzelne Fragen des Direktors treffende, ernstes Studium verrathende Antworten gab. Es handelte sich um die überaus wichtige Verkuppelung der Triebräder, um eine Erhöhung des Adhäsionsgewichts, von welchem die Zugkraft der Maschine allein abhängig ist. Hans hatte diesem Gegenstand schon lange seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt und war auf rein empirischem Wege zu einer neuen Idee gelangt, deren Ausführung ihm zwar noch nicht ganz klar war, die aber an sich durchaus nicht außer dem Bereich der mechanischen Möglichkeit lag. Der Direktor und Herr Berry wechselten vielsagende erstaunte Blicke und hörten den Auseinandersetzungen des jungen Mannes mit sichtlichem Eifer zu.
Da fiel der Name „Claire“ in der Unterhaltung der anderen Partei . . . Hans wurde zerstreut, verlor die Klarheit – die Triebräder und Kurbelstangen verwirrten sich plötzlich, eine [551] gewaltigere Kraft war auf sein Gedankenbild gestoßen und zertrümmerte es.
„Claire bewegt sich mitten in den schöngeistigen Kreisen von Paris, verkehrt mit den Großen der Kunst und Litteratur – ich beneide sie darum! Ihre Briefe beschämen mich geradezu, ich ersehe daraus, wie weit wir zurück sind. Das gute Kind wird sich schwer wieder in die hiesigen Verhältnisse finden –“ bemerkte eben Frau Berry.
„Allerdiugs, wenn sie hier nur von Maschinen-Verkuppelungen hört, oder wie das Zeug heißt, dann wird sie wohl auf und davon laufen und das Heimweh nach Paris ist ihr dann nicht zu verübeln,“ entgegnete Otto spitzig.
„Und doch bin ich überzeugt, daß Fräulein Claire sich für dieses Zeug lebhaft interessieren wird, sobald sie weiß, daß es von größter Wichtigkeit werden kann für das Haus ihres Herrn Vaters,“ rief Hans, fortgerissen von seiner Erregung.
„Bravo Davis! Sie haben meinen Herrn Sohn gut abgeführt!“ Eine starke Gereiztheit klang aus diesen Worten des Kommerzienraths.
„Abgeführt?“ fragte Otto, und die Narbe auf seiner Stirn brannte hochroth. „Ich merke nichts davon und kann Herrn Davis gegenüber wohl auch nie in diese Lage kommen!“
Die Entgegnung sollte scherzhaft sein, aber aus dem leichten Gesprächston klang tiefe Gereiztheit.
„Ich freue mich wirklich,“ setzte er dann zu seinem Vater gewendet hinzu, „wenn Claire wiederkommt, sie wird ein anderes Leben bringen und eine andere –“
Er stockte.
„Gesellschaft, meinst Du? Sprich’ es nur aus!“
„Nicht gerade, aber mehr Abwechslung, meine ich. Und das wird Dir selbst gut thun, Papa, und Dich erheitern. Ein Kreis von Kavalieren, Künstlern, Schriftstellern, kurz das, was man ‚Welt‘ nennt, wird sich hier versammeln. Oder willst Du Claire etwa zum weiblichen Leiter Deiner Werke heranbilden, zu einer Lokomotivenbauerin? Dafür ist Paris eine schlechte Schule!“
„Weder das eine noch das andere wird ausschließlich geschehen. Warum soll sich nicht beides vereinigen lassen, der Verkehr mit dem, was Du ‚Welt‘ nennst, und die Pflicht? Ich bin unter strenger Arbeit aufgewachsen, mitten im Gewoge der Fabrikthätigkeit, ich kenne daher den beglückenden Einfluß der Kunstgenüsse auf den Menschen zu wenig, um entscheidend darüber sprechen zu können; doch glaube ich daran. Aber jedenfalls ruht das wahre Glück, die echte Befriedigung nicht in solch schöngeistiger Beschäftigung allein, die doch immer nur ein Genießen ist, sondern in praktischer Arbeit, in dem Schaffen greifbarer Werthe . . . Sie mögen lächeln, meine Herren, über diese Anschauung, sie veraltetet nennen –“ fuhr er fort, indem er sich zu den Kameraden seines Sohnes wandte, deren Lippen sich wirklich verrätherisch kräuselten – „aber dies ist nun einmal meine Ueberzeugung. Ich bin daher auch kein besonderer Freund der Künstler, Dichter, Musiker von Fach – was diese schaffen, das sind in meinen Augen keine greifbaren Werthe; sie sind für mich mehr oder minder Drohnen.“
„Demnach bist Du auch ein abgesagter Feind aller Kavaliere?“ fiel Otto gereizt ein.
„Wenigstens kein Verehrer von ihnen – wenn sie nichts weiteres sind,“ war die mit starker Betonung gegebene Antwort.
Jetzt verlor Otto vollends die Ruhe. „Aber Papa! Was sollen sich die Herren hier denken? – Papa meint es nicht so, Troste –“
„Gewiß meine ich’s so; aber die Herren können und werden sich nicht dadurch getroffen fühlen, sie sind ja mehr als Kavaliere – sind die Beschützer dessen, was wir hervorgebracht haben, vor fremden Angriffen, und so lauge diese Beschützer nöthig sind und mit Aufopferung und Pflichttreue ihrem Beruf nachkommen, wird jeder vernünftige Mensch sie ehren –“
Man war allgemein froh über diese Wendung des allen peinlich gewordenen Gesprächs. Nur Otto beruhigte sich nicht, er fühlte den Hieb und wandte sich in seinem Zorne gegen Hans, der nach seiner Meinung allein die Schuld an dieser Erörterung trug.
Wenig schlagfertig, wie er war, suchte er vergeblich nach einem verletzenden und doch an diesem Orte möglichen Worte. Dadurch noch mehr gereizt, griff er zum nächsten besten, zu einer zufälligen Beobachtung, die in gar keinem Zusammenhang stand mit dem eben Gesprochenen.
„Sagen Sie einmal, Sie künftige Leuchte unter den Maschinenmenschen, was Sie jeden Sonntag in der äußersten Westvorstadt, in der Kleegasse – Verzeihung, meine Herren, daß ich diesen Namen hier nenne – zu suchen haben? Ich hatte bereits zweimal das Vergnügen, Ihnen auf dem Wege zur Kaserne dort draußen zu begegnen – einmal kamen Sie eben heraus, einmal gingen Sie eben hinein. Machen Sie da auch Studien über Triebräder, Verkuppelungen und dergleichen – was?“
Hans wechselte die Farbe, das Messer zitterte in seiner Hand und Herr Berry stutzte sichtlich. „Ein Spaziergang führte mich hinaus – ich verirrte mich –“ erwiderte Hans unsicher und verwirrt.
Allen fiel sein Benehmen auf, Otto staunte selbst über die unerwartete Wirkung seiner Worte; alles, was er gehofft hatte, war, den Verhaßten durch seine hämische Aeußerung in Verlegenheit und vielleicht für einen Augenblick in eine schlimme Beleuchtung zu bringen; nun ermuthigte ihn dessen Unruhe, weiter zu gehen; daß Papa auch jetzt wieder für seinen Schützling Partei nehmen würde, war nicht zu befürchten, denn eine wohlbekannte Falte erschien auf der Stirn des Kommerzienraths, als er erwartungsvoll zu Hans hinübersah. Der aber schien gar nicht kampfbereit und blickte ängstlich vor sich hin.
„Zweimal verirrt man sich doch nicht so leicht an derselben Stelle,“ warf Otto nachlässig hin, „vollends ein Maschinist wie Sie, der sich in dem Gewirr unzähliger Schrauben und Triebräder zurechtfinden muß. Wenn Sie keine bessere Erklärung finden können –“
„Ich suche keine, da ich Ihnen keine Rechenschaft über die Verwendung meines Sonntags abzulegen habe.“
Er betonte das „Ihnen“ stark mit einem Blicke auf Herrn Berry, durch den dieser bewogen wurde, so nachdrücklich das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu leiten, daß sein Sohn gezwungen war, zu folgen. Aber trotz der Bemühungen des Kommerzienraths wollte keine unbefangene Stimmung mehr aufkommen; der Zwiespalt zwischen Vater und Sohn war zu offenkundig hervorgetreten und das Bewußtsein dieser Spannung wirkte bedrückeud.
Am unglücklichsten war Frau Emilie, die sich alle Mühe gab, durch gesteigerte Liebenswürdigkeit den übeln Eindruck zu verwischeu, den „leider“ die Ansichten ihres Mannes auf die beiden Kameraden des Sohnes hatten machen müssen. Sie kannte ihren Gemahl nicht mehr, ein fremder Geist sprach aus ihm. Wer hätte heute in ihm den Nachkommen der Marquis von Berry erkennen sollen! Wie der nächste beste Volksredner hatte er gesprochen, und gerade heute mußte das sein in Gegenwart adliger Gäste, wie sie sonst in ihrem Hause sich nicht einfanden! Zum ersten Male während ihrer Ehe fühlte sie, die Tochter eines verarmten, aber altadligen Geschlechts, in ihrem Familienstolz sich verletzt.
Erleichtert athmete sie auf, als ihr Gatte früher denn gewöhnlich die Tafel aufhob und die Gäste sich rasch entfernten; weiß Gott, was am Ende noch alles hätte zum Vorschein kommen können! Otto verabschiedete sich mit seinen Kameraden.
„Ich muß noch ein paar Stunden in guter Gesellschaft zubringen, Mama, das wirkt reinigend,“ sagte er. „Wir gehen noch ein wenig in den Klub.“
Frau Emilie seufzte.
„Ich finde es ganz begreiflich, mein Sohn, es war ein schrecklicher Abend.“
„Hoffen wir auf Claire, sie wird unsere Bundesgenossin sein und durch Papas Pläne sehr bald einen Strich machen. Was ich dazu thun kann, soll geschehen.“
Mit einem Handkuß nahm Otto Abschied von der Mutter, die bedenklich und besorgt aufathmend das Haupt schüttelte, als sei ihre Hoffnung auf Claire nicht eben zuversichtlich. – –
„Folgen Sie mir, Herr Davis!“ sagte Berry zu Haus, als sich dieser empfehlen wollte. In tiefer Erregung kam Hans der Aufforderung nach. Die widersprechendsten Gefühle stürmten durch seine Brust. Nun wird der Kommerzienrath Rechenschaft verlangen über seinen Aufenthalt in der Kleegasse, und wenn er die Wahrheit erfährt, wird er sicher seine Hand [552] zurückziehen, den Schuldigen entlassen – der ganze Zukunftstraum ist zertrümmert. O diese Ketten an die ihn das Schicksal geschmiedet, an denen es ihn willenlos herumzerrte – sollten sie denn ewig klirren? Waren sie nicht zu zerreißen mit starker Hand? Was war zu thun? Frei bekennen und die Folgen muthig tragen oder feige lügen und ein andermal vorsichtiger sein – so stand die Wahl.
Die Minute, die verging, bis er im Arbeitszimmer Berrys stand, dünkte Hans eine Ewigkeit.
„Setzen Sie sich!“ begann der Kommerzienrath, als er in dem dunklen Raume Licht gemacht hatte.
Es galt also ein längeres Verhör. Aber Herr Berry sah nur sehr nachdenklich, nicht erregt aus – das gab Hans seine Fassung zurück.
„Sie sind ein guter Zeichner, Herr Davis, wollen Sie mir morgen Ihren Gedanken über die vorhin erwähnte Verkuppelung bei den Lokomotiven genau aufzeichnen? Er interessiert mich, und ich werde ihn von einem Ingenieur auf seine Verwendbarkeit prüfen lassen.“
Hans konnte seine Ueberraschung über diese unerwartete Wendung nicht verbergen.
Berry lächelte.
„Beruhigen Sie sich, ich werde dafür sorgen, daß Ihnen die Ehre und der Ertrag der Erfindung zugute kommt, wenn etwas an der Sache ist. Aber geben Sie sich keiner überstürzten Hoffnung hin, unter hundert scheinbar sehr geistreichen Problemen der Art zeigt sich vielleicht nur eines praktisch verwerthbar. Immerhin ist es für einen jungen Mann Ihres Alters und Ihrer Vorbildung schon sehr viel, wenn er überhaupt auf neue Ideen kommt. Und ich weiß das sehr wohl zu schätzen.“
„Ich werde mein Möglichstes thun, die Zeichnung zu machen, obwohl ich selbst noch nicht ganz im klaren bin, aber etwas ist daran, das fühle ich bei der Montierung einer jeden Maschine von neuem,“ erwiderte Hans beglückt.
„Gut.“
Berry stand auf.
„Nun zu etwas anderem. Was hatten Sie an den beiden Sonntagnachmittagen in der Kleegasse zu suchen? Es ist das doch ein sonderbarer Aufenthalt. Sprechen Sie offen!“
Hans zuckte zusammen und hob jetzt plötzlich den Kopf, den er, im Nachdenken über die zu entwerfende Zeichnung, gesenkt hatte. Da fiel sein Blick auf ein Gemälde über dem Schreibtisch – Claire als Mädchen, eine Puppe unter dem Arme, das liebe etwas trotzige Gesichtchen von blonden Locken umwallt; so hatte er sie in frühester Erinnerung. Sein Auge blieb starr daran haften, als habe er die Frage überhört.
Berry entging es nicht, er wartete ruhig, doch mit einer gewissen Spannung in den Zügen.
„Ich war bei meinem Vater!“ klang es dann fest aus dem Munde von Hans; sein Blick ruhte noch immer auf dem Bilde, als spreche er nur zu Claire.
„Ich wußte es. Gut, daß Sie die Wahrheit gesagt haben. Ich will Ihnen nicht vorhalten, was zu thun Ihre Pflicht gewesen wäre, ich will Ihnen einfach die Last abnehmen, mit der Sie doch nicht fertig werden können. Gehen Sie nächsten Sonntag wieder hin und bestellen Sie Ihren Vater für Montag früh acht Uhr zu mir aufs Bureau – es ist ja nicht anzunehmen, daß ihn jemand erkennt. Ich werde für ihn auf eine Weise sorgen, daß er Ihren Weg nicht weiter zu kreuzen braucht, verbitte mir aber dann jede weitere Gefühlsseligkeit von Ihrer Seite. Es giebt Nothwendigkeiten im Leben, die grausam zu sein scheinen und es manchmal auch sind, mit denen man aber rechnen muß.“
Hans war erschüttert. Dieser Mann häufte mit kalter Miene und dürren Worten Wohlthat auf Wohlthat. Jetzt fielen sie ja – die Ketten, die sich von Tag zu Tag enger um ihn geschlungen hatten, nun war er frei!
„Herr Kommerzienrath, wie soll ich Ihnen danken!“ stammelte er verwirrt.
„Mit einer guten Zeichnung vorderhand. Gehen Sie nur rasch daran, die Sache hat Eile! Gute Nacht, Herr Davis!“ Berry kehrte sich um und machte sich über seine Papiere. Hans war entlassen, kurz wie immer, als habe sich nichts weiter ereignet.
Mit einem Gefühl der Erlösung wanderte er durch die stille Nacht nach Hause; das gefährliche Geheimniß war weggewälzt von seiner Brust; wenige Tage noch und er sollte zum letzten Male die „Fackel“ betreten. Daß sich der Vater weigern würde, der Aufforderung Berrys zu folgen, war ja doch undenkbar. Jetzt bot sich dem Unglücklichen endlich die Möglichkeit, herauszukommen aus seiner jetzigen Umgebung und zugleich zu menschenwürdigerer Arbeit zu gelangen, und damit mußte der böse Geist von ihm weichen vor dem Hans zitterte, mußten jene wilden Anfälle aufhören, die den Verbitterten auf die Bahn des Verbrechens zu reißen drohten.
Vergeblich suchte Hans den Schlaf; seine Gedanken kehrten immer aufs neue zu seiner Erfindung zurück, deren Bild ihn unausgesetzt verfolgte. Zuletzt kleidete er sich wieder an, holte Reißbrett, Lineal und Feder hervor und begann beim Scheine der Lampe zu zeichnen, zu rechnen. Nie war sein Geist so frei, so klar gewesen. Rasch entfernte er den Aufriß einer Lokomotive, der vor ihm lag, er störte nur seine rege Phantasie, die alles, was hier. in starrer Ruhe vor ihm stand, in lebendiger, ineinander greifender Bewegung erblickte.
Stunden verrannen. Endlich verlangte die Natur ihre Rechte. Das Zimmer um ihn her verschwand. Aber noch im Traume sah er die arbeitende Maschine. So wie er sich’s gedacht, paßten die einzelnen Theile ineinander, Rad an Rad, Kurbel an Kurbel. Und plötzlich griffen die Räder und Kurbeln ineinander, in rasender Eile sich vorwärts bewegend. Es brüllte und stampfte und dampfte dahin über das weiße Papier hinaus, hinaus aus der Stube, an der Stadt vorbei, durch Wälder und Felder, über Brücken und Dämme, durch finstere Tunnels – und er selbst stand auf der Maschine, die Steuerung in der Hand, jauchzend über die stürmische Fahrt. Nun blitzte ein Meer von Lichtern durch die Nacht, die Maschine sauste mitten hinein, mitten durch eine dunkle schreiende Menschenmasse, über große Plätze, durch breite Straßen, bis vor einen mächtigen Palast – da hielt sie mit einem Rucke. Unter dem Portal stand eine vornehme Dame, ganz in Weiß, Blumen im Haar, vom Lichte umstrahlt, und er sprang hinab von der qualmenden Maschine, stürzte in ihre ausgebreiteten Arme, in die Arme Claires! Und alle jubelten und jauchzten umher – nur das Pfeifen der Maschine tönte schrill dazwischen. Eben wollte er zur Lokomotive zurück, die gellende Pfeife abzustellen, da erwachte er, den Zirkel noch in der Hand.
Verstört hob er den Kopf, der auf dem Reißbrett geruht hatte, auf der vollendeten Zeichnung. Im Dämmerschein des Morgenlichts, das zum Fenster hereinfiel, hoben sich sauber und klar in der Mitte des weißen Papieres die Linien der Maschine ab. Allein Hans achtete nicht weiter darauf, nur die Bilder seines Traumes suchte er sehnsüchtig festzuhalten. Im Fabrikhof erwachte schon das Leben – die Arbeit rief! Er löste die fertige Zeichnung ab, legte sie in einen Umschlag und übergab sie dem Mädchen, das ihm sein bescheidenes Frühstück brachte, mit der Weisung, das Paket noch diesen Morgen ins Bureau des Herrn Kommerzienraths zu bringen. Dann ging er ernst und ruhig wie immer hinüber in die Monteurwerkstätte.
| * | * | |||
| * |
Am nächsten Sonntag machte sich Hans früher als sonst auf den Weg zur Kleegasse. Er konnte den Augenblick nicht mehr erwarten, wo er seiner Sorge ledig sein würde, und eine gewisse Unruhe beschlich ihn, ob sein Vater auch willfährig sich erweisen würde. Zugleich trat der Vorgang mit Holzmann am vorigen Sonntag wieder in allen Einzelheiten vor sein Auge und steigerte seine Qual.
Ohne das Wirthszimmer zu betreten, begab er sich auf einer Hintertreppe sofort hinauf zur Kammer des Vaters. Sie war heute verschlossen. Er pochte ungeduldig an die Thür – keine Antwort! Also nicht zu Hause! Vielleicht war er unten in der Wirthschaft.
Das Schanklokal war überfüllt, ein wüster Lärm herrschte an allen Tischen und über dem ganzen Raume lag ein dicker Dunst von Branntwein und Tabaksrauch. Noch nie war ihm der Ort so abstoßend erschienen. Forschend hielt er Umschau, aber auch hier war der Gesuchte nicht zu erblicken.
Da wurde er von der Wirthin bemerkt. „Warten Sie einen Augenblick!“ rief sie ihm zu. Aus einer Schublade am Schenktisch
[553][554] holte sie einen beschmutzten zusammengefalteten Zettel, den sie ihm mit einem neugierigen Blicke übergab. Ohne die Frau weiter zu beachten, entfaltete er das Papier und las bei der grauen trüben Beleuchtung mit klopfendem Herzen die unbeholfene Schrift.
„Ich will Dir nicht weiter im Wege stehen, und das Kommandieren vertrage ich auch nicht, darum verschwinde ich. Die
Stadt ist ja groß. Freu’ Dich, so viel Du willst, mir ist auch wohler so. Wir passen nicht zusammen. Vielleicht glückt’s mir
auch einmal, dann werde ich mich vielleicht melden. Bis dahin adieu! Sei gescheit und sorge für Deinen Vortheil, alles andere
ist fauler Witz, ich pfeife drauf. J. D.“
Als Hans zu Ende gelesen hatte, schwamm vor seinen Augen alles durcheinander in einem brausenden Nebel, aus dem fahle Lichter leuchteten. Mühsam faßte er sich. Ein Gedanke stieg in ihm auf – er rief die Wirthin, die sich mittlerweile entfernt hatte. „Erinnern Sie sich noch des Mannes, welcher vorigen Sonntag bei Davis und mir war?“ fragte er erregt.
„Freilich erinnere ich mich, der Holzmann war’s,“ entgegnete die Frau.
„Ganz richtig, Holzmann heißt er. War dieser Holzmann während der Woche öfters bei Davis?“
Die Wirthin sah ihn mißtrauisch an. „Ich mag das Spionieren nicht,“ sagte sie dann gehässig. „Ich merke die Sache schon lange; mich wundert nur, daß er’s so lange ausgehalten hat, der Davis, er ist sonst nicht so. Und so durchsichtig wie Sie ist mir noch keiner von der Sorte vorgekommen. Sie sind einmal nicht der Rechte zum Aushorchen für die Zwei; lassen’s die Händ’ davon und mir meine Ruh’!“ Mit einem verächtlichen Blicke ging sie zu ihren Gästen.
Es blieb für Hans nichts anderes übrig, als sich zu entfernen. Die letzten Worte der Wirthin beschäftigten ihn nachhaltig. „Für die Zwei" hatte sie gesagt – kein Zweifel, der Vater war die Woche über mit Holzmann zusammengewesen, auf seine Veranlassung hatte er diesen Schritt gethan. Nun war er wohl ganz in der Macht dieses Schurken, der ihn nur allzugut für seine Zwecke zu benutzen wußte. Und er selbst? Aufs neue preßte ihn die Kette, von der er eben gelöst zu sein meinte.
Herr Berry zuckte die Achseln, als ihm Hans die Mittheilung brachte, und schaute ihn mit einem sonderbaren mitleidigen Blicke an. „Sie sehen, ich thue, was ich kann. Sollten Sie je etwas Näheres von Ihrem Vater erfahren, so verschweigen Sie es mir nicht . . . Die Zeichnung hat mich sehr interessiert, Sie werden noch davon hören. Lassen Sie sich inzwischen durch diese Wendung der Angelegenheit mit Ihrem Vater, so ärgerlich sie ist, nicht in Ihrer Arbeit stören!“ sagte er nachdenklich und gab das Zeichen der Entlassung.
Hans stieg langsam die Treppe hinab. Zu ebener Erde lagen die Kassenräume. Es war gerade Zahltag, die Thüren gingen beständig auf und zu, das Klirren des auf die Marmorplatte hingeworfenen Geldes drang heraus und rief ihm die verdächtigen Worte Holzmanns ins Gedächtniß zurück. Nun wird sie der gewissenlose Mensch dem Vater alle Tage vorsprechen, in den finsteren häßlichen Höhlen unter der Erde und zuletzt – – einem plötzlichen Instinkt folgend, ging Hans in das Kassenzimmer; wenn man ihn nach seinen Wünschen fragte, konnte er sich ja Kleingeld einwechseln.
Riesige eiserne Schränke standen in dem vergitterten Raume, sie machten einen sicheren Eindruck. Seine Blicke prüften die Wände, sie waren offenbar von Eisen oder mit Stahlplatten beschlagen – trotz des Anstriches entgingen ihm die runden Köpfe der Schrauben nicht. Die Fenster waren vergittert und hatten eine Vorrichtung für dichten Verschluß. Außerdem war ein eigener Nachtwächter da. Das Gelingen eines Einbruches schien also unmöglich ohne das Einverständniß und die Hilfe eines treulosen Angestellten, und wie sollte ein solcher zu haben sein?
Beruhigter verließ er das Lokal; niemand hatte in dem herrschenden Durcheinander auf ihn acht gegeben. Seine Besorgniß schwand mehr und mehr – der Vater hatte am Ende recht, daß er die Sprache dieser Menschen nicht verstehe und Dinge fürchte, die nur in seiner Einbildung beständen. Sein jugendlicher Sinn half ihm rasch über die letzten Bedenken hinweg, und bald füllte ihn sein neuer Wirkungskreis ganz aus und der Gedanke: Empor zu Claire!
Kommerzienrath Berry hatte auf den ersten Blick in der Zeichnung seines Schützlings einen vortrefflich verwerthbaren Gedanken gefunden; er selbst war als Techniker hervorragend genug, um durch Verbesserungen im einzelnen, für welche dem jugendlichen Erfinder die nöthige technologische Erfahrung fehlte, der neuen Idee ihre volle Tragweite zu geben.
Bei dem ungeheuren Wettbewerb gerade in diesem Industriezweig war eine so wesentliche Verbesserung von unabsehbarer Bedeutung für sein Haus.
Er ließ, ohne Wissen von Hans, ein Modell der Maschine herstellen, um ihre Leistungfäigkeit zu erproben. Der Erfolg war ein entschiedener, soweit er sich in solch verkleinertem Maßstab beobachten ließ. So entschloß er sich denn, zur Fabrikation im großen zu schreiten; unter dem Namen des „Berryschen Systems“ sollte die neue Konstruktion in die Welt gehen. Er that das weniger aus persönlichem Ehrgeiz als aus praktischen Gründen. „System Berry“ war ein Name, der Aufsehen und Vertrauen erwecken mußte, ganz anders als ein „System Davis“, wie es von rechtswegen hätte heißen sollen. Wer ist denn dieser Davis? Ein junger Monteur, der nicht einnmal auf einer technischen Hochschule war! Wenn man das erfährt, wird man darin einen willkommenen Anlaß finden, alles Mögliche und Unmögliche an der Maschine auszusetzen zu haben und tausend Zweifel zu hegen.
Trotz seiner guten Gründe war es dem Kommerzienrath peinlich, Hans diesen Vorschlag machen zu müssen, und ohne seine Einwilligung konnte er doch nicht handeln. Er ließ ihn kommen, theilte ihm seinen Entschluß mit und setzte ihm die Veranlassung dazu auseinander. Jedenfalls, so schloß er, werde er dafür Sorge tragen, daß der Ertrag der Erfindung, falls sie sich in der Praxis bewähre, was ja immerhin noch eine Frage sei, dem Erfinder nicht entgehe; sobald es ohne zu großes Aufsehen und ohne üble Wirkung auf die anderen Angestellten geschehen könne, werde er zudem Hans eine seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten angemessene Stellung einräumen. Vorderhand verlange er aber von ihm unbedingtes Schweigen über seine Urheberschaft, die sich ja ohnehin nur auf den Grundgedanken beziehe und ohne Uebertragung ins Praktische von mäßigem Werthe sei. Hans ging nicht nur willig auf den gemachten Vorschlag ein, ohne irgend eine feste Bedingung daran zu knüpfen, er zeigte sich sogar selig darüber, eine solche Anerkennung gefunden zu haben und Herrn Berry einen Dienst erweisen zu können. Strahlend vor Glück verließ er das Zimmer seines Chefs.
So leicht hatte sich Berry die Sache nicht gedacht; nun trug die einstige Wohlthat seiner Gattin kostbare Frucht. Zu der natürlichen Neigung, welche er neuerdings für Hans gefaßt hatte, trat jetzt noch das gesteigerte Interesse des Geschäftsmannes, und der Fremde drohte in seinem Herzen immer mehr die Stelle einzunehmen, welche sein eigener Sohn Otto von Tag zu Tag mehr preisgab.
Dieser glaubte, als der Sohn eines reichen Vaters die Verpflichtung zu haben, dem Namen Berry, welcher bisher nur unter den Industriellen, auf dem Maschinenmarkt einen guten Klang hatte, auch in den ersten Kreisen der Gesellschaft Geltung zu verschaffen. Papa war zwar zu kurzsichtig und einseitig, um darauf etwas zu geben, und erschwerte ihm durch Knauserei diesen edlen Beruf; er aber war nicht der Thor, sich dadurch abschrecken zu lassen; für den einzigen Sohn des mächtigen Fabrikherrn gab es überall gegen einfache Unterschrift Geld genug.
Das Ziel seiner Wünsche, der Rennplatz, war dem Fähnrich noch verschlossen, doch bereitete er sich jetzt schon mit einem Eifer und einer Ausdauer, die ihm sonst nicht eigen war, auf die Zeit vor, wo mit dem Lieutenantspatent die ersehnten Pforten dieses Paradieses sich ihm öffnen sollten. Dem „Pferde“ war daher alles gewidmet, was er an jugendlicher Begeisterung zu vergeben hatte.
Seine Standesgenossen in dem elterlichen Hause heimisch zu machen, unternahm er keine weiteren Versuche, der erste war zu kläglich ausgefallen; damit wollte er warten, bis Claire zurückgekehrt war.
Auf sie setzte er alle Hoffnung, denn er hegte keinen Augenblick Zweifel, daß sie mit ihren ganzen Anschauungen auf seiner und der Mama Seite stehen würde. Das war ja nicht anders denkbar nach einem zweijährigen Aufenthalt in einem der [555] vornehmsten Häuser von Paris. Ja, er dachte schon weiter und schaute sich unter seinen Kameraden bereits nach einem passenden Schwager um, der durch seinen altadligen Namen und sein gesellschaftliches Ansehen ihm selbst zu einer gesicherten Stellung in den neuen Kreisen verhelfen sollte. Die reiche, schöne, feingebildete Claire hatte jedenfalls die Auswahl unter den Söhnen der ersten Häuser. Wenn Reichthum und Schönheit allein nicht verfingen, so blieb es ja jedem unbenommen, das Wappen der alten Marquis von Berry wieder hervorzuholen und neben dem seinen auf den Kutschenschlag malen zu lassen. So sah er denn mit rosigen Hoffnungen dem Ablauf seiner Fähnrichszeit entgegen; wenn alles gut ging, dann konnte seine heißersehnte Beförderung zum Lieutenant ungefähr mit der Rückkehr Claires zusammenfallen.
Mit solchen Gedanken war Otto ein fremdes Element im Hause Berry, und wenn er auf dem Rücken seiner schlankfüßigen „Thespis“ zum Stalle hinausritt, über den Fabrikhof der Stadt zu, gab er dem Pferde nervös die Sporen, um möglichst rasch herauszukommen aus dem eklen Dampf und Rauch, der nur die hellen Schnüre und den farbigen Besatz seiner Uniform schmutzig färbte.
Und der Dampf und Rauch schien täglich zuzunehmen, wie ein schwarzer Mantel lag er über den Werken, umsäumt von der purpurnen Gluth der flammenden Hochöfen. Herr Berry hielt sich jetzt mehr wie je in den einzelnen Werkstätten auf; es galt die Herstellung der neuen Maschine, über die bereits die abenteuerlichsten Gerüchte unter den Angestellten umgingen. Der Kommerzienrath war bisher noch nie als schöpferischer Mechaniker aufgetreten – alle Neuerungen, alle Entwürfe waren seither aus dem Konstruktionssaal der angestellten Ingenieure gekommen. Dort herrschte denn auch eine allgemeine Verstimmung, daß nicht wenigstens der Plan zur Ausarbeitung oder Prüfung vorgelegt worden war. Berry selbst machte jede einzelne Zeichnung und gab die einzelnen Theile an die einschlägigen Werkstätten aus; in eigener Person beaufsichtigte er auch die Anfertigung. In seiner Begleitung befand sich nicht einmal ein theoretisch gebildeter Techniker, sondern nur der junge, schon längst mit Neid betrachtete Monteur Davis.
Sollte am Ende gar dieser junge Mensch auf die neue Konstruktion gekommen sein? Begabt war er, ja mehr noch, er war ein technisches Genie, das mußte man ihm lassen – aber eine so weittragende Erfindung, wie dem Gerede und den Vorbereitungen nach die in Frage stehende war, die konnte doch nicht von einem einfachen Monteur ausgehen, der nur die Gewerbeschule hinter sich hatte!
Für Hans war es eine wonnevolle Zeit. Er sah seinen glücklichen Gedanken aus dem rohen Metall heraus allmählich zur Wirklichkeit werden. Unter den riesigen Eisenhämmern formten sich die glühenden Achsen und Kurbeln. Dann durfte er sie auf ihrem ganzen weiteren Entwicklungsgang begleiten an der Seite des Herrn Berry, der selbst auf den im Rohen geschmiedeten Stücken die Zeichnung punktierte, nach welcher die Stanz- und Schneidemaschinen arbeiten mußten, bis endlich die Dreherei die letzte Vollendung und Politur gab. Unermüdlich überwachte Berry besonders die Modellierung der Triebräder, in deren Anordnung und Form der neue Gedanke hauptsächlich zum Ausdruck kommen sollte. Er, der sonst nur in tadellosem Anzug durch die rußigen Räume gegangen war und nirgends selbst mit Hand angelegt hatte, steckte jetzt in alten Kleidern – der peinlich gepflegte, fast schneeweiße Bart, das Gesicht waren häufig geschwärzt, ja er griff wohl in seinem Eifer eigenhändig zu.
Die Arbeiter machten große Augen, wenn sie sahen, wie er mit dem Werkzeug nicht weniger sicher umzugehen wußte als sie selbst, und ihr Eifer wuchs; ihrem alten Hasse begann sich fast gegen ihren Willen ein gut Theil Respekt beizumischen. Dem Kommerzienrath entging dies nicht, und immer mehr erkannte er seine früheren Fehler. Er trat jetzt unwillkürlich in ein engeres Verhältniß zu den Arbeitern, lernte die Leute besser kennen und war nahe daran, wenn er so mitarbeitete unter den geschwärzten Gesellen, sich selbst nur noch als den ersten Arbeiter in diesen Räumen zu betrachten. In solchen Augenblicken ahnte er auch, wo der künftige Ausgleich liege für die beiden feindlichen Elemente der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, die er bisher im letzten Grunde für unversöhnlich gehalten hatte. Am innigsten gestaltete sich sein Verhältniß zu Hans. Die begeisterte Liebe des jungen Mannes zu seinem Beruf, dessen scharfer Blick für alles und jedes, was mit der Technik der Maschinen zusammenhing, flößte ihm die größte Achtung ein. Er bedauerte schon, daß er ihm keine höhere Ausbildung hatte zutheil werden lassen.
Es sollte so eingerichtet werden, daß die neu konstruierte Maschine gerade die fünfhundertste war, welche die Werke verließ; damit sollte für die Arbeiter und alle Angehörigen der Fabrik ein großes Fest verbunden sein, das im Frühjahr stattfinden sollte.
Berry hatte noch einen anderen Plan dabei, er wollte das Fest zusammenfallen lassen mit der Ankunft Claires – sie sollte das väterliche Haus in seinem vollsten Glanze, den Vater auf der höchsten Stufe seines Erfolges sehen. Sein Sohn war für ihn verloren, auf ihn würde auch dieses Ereigniß keinen Eindruck machen. Aber auf das höchste Glück eines Vaters, Freude und Stolz über die mühevollen Errungenschaften seines Lebens im Angesicht seiner Kinder zu lesen an einem solchen Ehrentag, darauf wollte er nicht verzichten. Was Otto ihm weigerte, sollte Claire ihm geben.
Er machte unzählige Pläne; auch dabei war Hans sein einziger Vertrauter, in dem es hell aufjubelte vor Freude, als er von der Rückkehr Claires zu der Feier erfuhr. Nun hatte sein Eifer keine Grenzen mehr; sein Traum von damals, als er über der Zeichnung einschlief, sollte zur Wirklichkeit werden – die Maschine trug ihn Claire entgegen! „Schwing Dich empor, so hoch Du kannst!“ Er hatte ihren Auftrag treu erfüllt mit all seinen Kräften.
Aber würde er denn nun auch etwas bedeuten für die vornehme Dame? Hätte er nicht noch mehr leisten, Größeres, Weittragenderes erfinden müssen? War nicht sein Können noch immer so gering?
Der letzte Gedanke erfüllte ihn mit bitterer Qual. Dann aber sagte er sich wieder in erwachendem Selbstbewußtsein, nicht an den Schranken seines Könnens liege es, nur an dem „Nicht dürfen“. Er selbst hätte dem neuen System seinen Namen geben müssen, das vielleicht die Welt sich eroberte, aber er – durfte nicht! Und warum? Weil er eben der simple Hans Davis war, gerade gut genug, um durch seine Leistungen den Glanz des Hauses Berry zu vermehren. Was ihm vor kurzem noch ganz natürlich erschienen war, schmerzte ihn jetzt, und ein geheimes Mißtrauen gegen den Kommerzienrath wollte ihn beschleichen. Wenn er nur wenigstens Claire hätte mittheilen dürfen, daß er mehr war als ein einfacher Monteur, dann würde er ja gern auf jeden Ruhm, auf jede Ehre, auf die Anerkennung der ganzen Welt verzichtet haben.
Mittlerweile rückte der wichtige Zeitpunkt immer näher, schon war der riesige Kessel in den Montierungsraum gebracht. Es war für Berry sehr schwer, dem jungen Davis die Oberleitung bei der Montierung zu übergeben, ohne die alten Werkmeister zu kränken oder den Gedanken nahezulegen, daß dieser Davis mehr als er selbst bei der Sache betheiligt sei. Nur durch seine ständige Gegenwart, indem er scheinbar selbst die Leitung übernahm, war es möglich, Hans in allem beizuziehen und doch weitere Unannehmlichkeiten hintanzuhalten.
Inzwischen fügte sich ein Glied nach dem anderen dem unförmlichen Körper an, der unter den Hammerschlägen erzitterte, von Tag zu Tag gewann er mehr Form und Leben. Die Ingenieure beobachteten mit kritischen Blicken und gaben sich alle Mühe, das sorgfältig gehütete Geheimniß ihres Chefs zu entdecken, der keine Zeichnung aus der Hand gab; die meisten waren erfüllt von der Hoffnung eines offenkundigen Mißerfolges. Auf den jungen Mann, der mit unermüdlichem Eifer drauf los hämmerte, achtete man kaum und verlachte die Arbeiter, die in ihm die Hauptperson sehen wollten. Lieber traute man noch dem Chef, der doch ein erfahrener Techniker war, eine gelungene Entdeckung zu als diesem grünen Jungen.
Es herrschte eine allgemeine Aufregung im Werke; in allen Sälen, unter dem Geschwirr der Treibriemen, dem Kreischen, Poltern, Schlagen der Maschinen wurde von der neuen Lokomotive gesprochen; es galt als eine Ehre, bei deren Herstellung beschäftigt zu sein. Schon machten sich die Lackierer daran, ihr ein flottes grünes Gewand anzuziehen.
[556] „Wie meinen Sie, daß ich sie taufen soll?“ fragte eines Tages Berry seinen Schützling, der eben mit dem Einsetzen der letzten Schrauben beschäftigt war.
Blitzartig kam diesem ein Gedanke, der Taufname lag ihm auf den Lippen – doch er wagte nicht, ihn auszusprechen.
„‚Berry‘ – nach dem System selbst, denke ich,“ sagte er dann zögernd, mit gerunzelter Stirn weiter arbeitend.
Berry erröthete leise, er glaubte einen leisen Spott herauszuhören. „Was meinen Sie zu ‚Claire‘, Davis?“ fragte er langsam.
Da sprang Hans aus seiner knieenden Stellung auf, hob hoch den Hammer und ließ ihn dröhnend auf den Kessel fallen. „Claire!“ rief er jubelnd – er selbst taufte die Maschine.
„Ei, da scheine ich ja Ihren Herzenswunsch erfüllt zu haben! Nun wohl, Sie haben entschieden dabei mitzureden. So dampfe sie denn als ‚Claire‘ durch die Welt, der Name wird ihr hoffentlich Glück bringen, und meine Tochter kann stolz darauf sein. Sorgen Sie jetzt nur, daß sie mir keine Schande macht, die neue ‚Claire‘! Und passen Sie auf die Röhrenlager recht auf! Der geringste Fehler wird natürlich dem neuen System zugeschrieben, wenn er auch ganz wo anders liegt, darauf müssen wir uns schon gefaßt machen; meine Herren Ingenieure hätten einen Mordsspaß, wenn alles schief ginge und die ‚Claire‘ sich gründlich blamierte!“
„Das wird sie nicht, verlassen Sie sich darauf, das wird sie nicht!“ Mit Feuereifer ging Hans von neuem ans Werk, so daß ihm der Schweiß in großen Tropfen von der Stirn perlte.
Die Kolumbische Weltausstellung in Chicago.
Weltausstellung“! Wohl nie ist dieses klangvolle Wort uns Deutschen so viel um die Ohren geschwirrt, als eben gegenwärtig.
Der alte Kampf um die Weltausstellung in der Reichshauptstadt Berlin ist aufs neue entbrannt, und er hat durch den eifersüchtigen Wettbewerb der Pariser eine bisher nie dagewesene Verschärfung erfahren. Fast könnte man darüber die „Kolumbische Weltausstellung“ vergessen, die sich drüben über dem Ocean vorbereitet, sorgten nicht eifrige Berichte über die Wunder, welche man dort zu erwarten hat, dafür, sie stets in Erinnerung zu halten, und knüpfte sie nicht an einen Gedenktag an, der denn doch zu bedeutsam ist in der Weltgeschichte, als daß er über dem Streite des Tages aus dem Auge verloren werden könnte.
Vierhundert Jahre sind verflossen, seit Christoph Kolumbus den Fuß auf amerikanischen Boden setzte; was Amerika in diesen vierhundert Jahren geworden, das zu zeigen wird in erster Linie der Zweck der „Kolumbischen Ausstellung“ sein und daran wird auch die ausgiebigste Betheiligung des alten Europas nichts ändern. Vor allem werden die „Vereinigten Staaten“ ihre ganze wirthschaftliche Machtfülle dafür in die Wagschale werfen, uns die Leistungsfähigkeit der Neuen Welt in riesenhafter Gestalt erscheinen zu lassen, und Südamerika wird, wenn anders seine politischen Zerwürfnisse nicht noch störend dazwischentreten, an diesem Bilde nach Kräften mitwirken. Bedenken wir ferner, daß Länder, deren Handelsverkehr mit der Neuen Welt bei uns in Europa gar nicht nach seinem ganzen Umfang ermessen wird und welche zu den bisherigen Ausstellungen nur einige exotische Kuriosa lieferten, wie z. B. China, Japan und andere asiatische Staaten, zum ersten Mal in größerem Maßstab ausstellen werden, so ist darin schon eine Reihe von Besonderheiten gegeben, welche der Kolumbischen Weltausstellung ein eigenartiges Gepräge aufdrücken. Und nun dazu der grandiose Hintergrund der echt amerikanischen Großstadt Chicago in ihrer herrlichen Lage an dem gewaltigen Michigansee!
Chicago ist nach New-York die bedeutendste und bevölkertste Stadt der Union; es übertrifft Philadelphia an Umfang und Einwohnerzahl und weist nach der letzten Zählung 1250000 Einwohner auf, von denen ein Drittel deutschen Ursprungs ist. Seine geographische Lage macht es zum Schlüssel des weiten gesegneten Westens, zum natürlichen Knotenpunkt der größten Eisenbahnlinien Amerikas, deren nicht weniger als sechsundzwanzig strahlenförmig dort zusammenmünden, und zum Ausgangspunkt für die hochentwickelte Binnenschiffahrt auf den fünf untereinander verbundenen riesigen nordamerikanischen Seen. Das mit der Stadt in unmittelbarem regen Verkehr stehende Gebiet ist dreimal so umfangreich als Europa ohne Rußland; Chicagos Handelsumsatz wurde im Jahre 1890 auf rund fünfeinhalb Milliarden Mark berechnet. Nichts vermochte die fast märchenhaft rasche Entwicklung der Stadt zu hemmen. Noch im Jahre 1833 ein kleiner Flecken mit 175 Häusern und 550 Einwohnern, zählte es 1871 bereits über dreimalhunderttausend Seelen. Wohl schien ein furchtbares Unglück es damals vom Erdboden vertilgen zu wollen: eine beispiellos heftige Feuersbrunst im Oktober des Jahres 1871 legte in drei Tagen den größten Theil des Geschäftsviertels in Asche. Aber rasch erstand das Zerstörte wieder aus den Trümmern, und nach zehn Jahren war auch die letzte Spur von einem Brande verwischt, der nach annähernder Schätzung einen Schaden von 800 Millionen Mark verursacht hatte. Groß angelegte Wasserwerke versorgen heute die Stadt mit Wasser, die Gesundheitsverhältnisse sind günstig, nicht zuletzt dank einem verschwenderischen Maße öffentlicher Gärten oder Parke, deren zwanzig theils innerhalb des Häusermeeres, theils an seinem äußeren Rande gelegen sind. – Zwei dieser Parke sind nun dazu ausersehen worden, die Ausstellungsgebäude aufzunehmen, der Jacksonpark, hart am Ufer des Michigansees, und „Midway Plaisance“, westlich an den Jacksonpark anstoßend.
Schon im Juni 1891 wurden die Arbeiten auf dem Ausstellungsplatz begonnen und seither – mit nur geringen durch finanzielle Schwierigkeiten hervorgerufenen Unterbrechungen – nach Maßgabe der vorhandenen Mittel fortgesetzt. Jetzt ist man soweit, daß voraussichtlich alle Bauten und Anlagen zur bedungenen Frist, dem 12. Oktober 1892, fertig sein können. An diesem Tage, dem historischen Jahrestag der Entdeckung Amerikas, an dem Kolumbus den Strand der Insel Guanahani betrat, soll die feierliche Uebergabe der Gebäude an die leitende Kommission von hundertundsechs Männern, die „Worlds Columbian Commission“, erfolgen. In der Zeit vom 1. November 1892 bis zum 10. April 1893 werden sich die weiten Räume mit den Schätzen der Aussteller füllen, um endlich am 1. Mai 1893 den Scharen der staunenden Besucher sich zu öffnen.
Gedenkt man schon jene feierliche Uebernahme der Gebäude mit einem gewaltigen Festespomp zu umkleiden, bei dem Reden, Musikaufführungen größten Stils mit eigens hierzu komponierten Tonwerken, Feuerwerk und Truppenschau ihre Rolle zu spielen haben, so wird selbstverständlich die endgültige Eröffnung in noch viel großartigerem Maßstab gefeiert werden. Insbesondere versprechen sich die Veranstalter viel von einer großen internationalen Flottenschau, die auf Ende April geplant ist. Man denke sich: auf der ungeheuren, am Ausgang der Chesapeakebay gelegenen Rhede von Hampton Roads sammeln sich die Flotten aller seefahrenden Nationen und dampfen von da gemeinsam in den Hafen von New-York, um hier an einem aus allen Welttheilen herbeigeströmten Publikum vorüberzudefilieren! Aber die schrankenlose Phantasie des Amerikaners schweift noch weiter. Er sieht diese Ungethüme der See auch die Mündung des Potomacstromes hinaufziehen, der Bundeshauptstadt Washington und dem Grabmal des großen George Washington ihre Huldigung darzubringen!
Kühn wie diese Festentwürfe sind auch die Rechnungen der Amerikaner. Man hat die Kosten der Ausstellung auf nicht ganz 75 Millionen Mark veranschlagt. Davon trägt die Stadt Chicago 20 Millionen bei, von einer allgemeinen Subskriptionsanleihe erhofft man etwa 23 Millionen, nicht weniger als 40 Millionen aber sollen die Eintrittsgelder ergeben. Man rechnet also, da der Eintrittspreis auf einen halben Dollar oder etwa zwei Mark festgesetzt ist, auf die Kleinigkeit von zwanzig Millionen [557] zahlender Besucher, welche sich in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Oktober 1893 in die Ausstellung ergießen sollen. Das sind durchschnittlich täglich gegen 110000 Personen!
Versuchen wir nun durch einen Rundgang über das Ausstellungsfeld ein Bild von der ganzen Anlage zu gewinnen und uns über die Bestimmung der einzelnen Baulichkeiten klar zu werden, wobei wir zu näherem Anhalt auf die Zahlen in unserer Uebersichtsskizze auf Seite 560 und 561 verweisen.
Der Flächenraum, den die Ausstellung bedeckt, umfaßt ungefähr siebzig Hektar. Mächtige Bäume und gefälliges Buschwerk füllen malerisch die Räume zwischen den Gebäuden, immer wieder aber öffnet sich der reizende Ausblick auf die weitgedehnte Wasserfläche des Michigansees. Zahlreiche Kanäle und Wasserstraßen durchziehen das Gelände, und wer will, der kann in bequemer Gondel sich von Ort zu Ort umherführen lassen.
Wir benützen einen der zahlreichen Schnellpassagier-Dampfer, welche uns die angenehmste Verbindung der Stadt Chicago mit Jacksonpark bieten, und landen am Hafen, der durch einen in den See hinausgebauten Damm (22) gebildet wird. Eine Gruppe kleinerer Gebäude, von einem Thurme überragt, fällt uns ins Auge: es ist das Kasino, Cafés und Wirthschaften, die uns neben leiblichem Genuß eine entzückende Fernsicht über den See bieten. Vom halbrunden Quai gegenüber grüßt eine seltsame Säulenreihe: es sind venetianische Säulen, welche allegorische Darstellungen der dreizehn ersten Unionsstaaten tragen; sie umziehen das Ostufer eines großen Wasserbeckens (11), in dessen Rundung eine hohe, von dem amerikanischen Bildhauer French in Paris modellierte Statue der Republik (13) sich erheben soll.
Jenseits, in der Verlängerung des durch allerlei farbige Springbrunnen belebten Bassins, steht das architektonisch hervorragendste Gebäude der ganzen Ausstellung, das Verwaltungsgebäude (10). Vier in ionischem Stile gehaltene Pavillons werden von einer flotten Riesenkuppel überragt, die eine Spannweite von sechsunddreißig und eine Höhe von achtzig Metern über der Grundfläche erreicht. Durch eine Thoreinfahrt in der stattlichen Breite von achtundzwanzig Metern betreten wir die mächtige Rotunde im Innern, von der aus die Zugänge zu den zahllosen Bureaus der verschiedensten Art führen. Das Dach der Pavillons ist flach, und alle vier sind durch äußere Galerien miteinander verbunden, so daß sich den Besuchern hier oben ein prächtiger Spaziergang bietet.
Südlich von dem erwähnten Wasserbecken dehnt sich das Gebäude für die Landwirthschaft (8, 12) mit einem kolonnadengeschmückten Anbau (6) für Versammlungen und Kongresse. Dem letzteren Zwecke dient auch die amphitheatralisch angelegte Versammlungshalle (2). Dem Landwirthschaftsgebäude gegenüber liegt der Industriepalast (17), naturgemäß das größte und umfangreichste Bauwerk der Ausstellung, das allein eine Fläche von 12 Hektaren bedeckt und 6 Millionen Mark kostet.
An Größe folgt dem Industriepalast zunächst das riesige Maschinenhaus (7) südlich vom Verwaltungsgebäude. Ihm gegenüber stehen die ebenfalls recht stattlichen Hallen für Bergbau und Metallurgie (14) und für Elektricität (15). Zwischen beiden, etwas weiter rückwärts, münden in einen geräumigen Bahnhof (9) die eigens für die Ausstellung angelegten Zweigstränge der Eisenbahnlinien, und wiederum nicht allzu weit entfernt erheben sich die Wände des Kolossalgebäudes für die Verkehrsmittelausstellung (16). Im Stile einer riesigen romanischen Basilika wird sie uns entgegentreten, von einer mächtigen Kuppel überwölbt und mit einem Zugang, dem man den stolzen Namen „Das Goldene Thor“ gegeben hat.
Diesem Bauwerk schließt sich an die Halle für den Gartenbau, ein besonders bevorzugtes Glied der Ausstellung, denn Chicago heißt nicht umsonst die „Gartenstadt“. Ein breit überkuppeltes Palmenhaus wird die riesigsten Exemplare dieser Gattung aufnehmen können, während ein eigener Raum für Prachtexemplare der „Victoria regia“ vorbehalten ist.
Ehe wir weiter schreiten, müssen wir einen Blick zur Rechten werfen. Aus glänzender Wasserfluth grüßt uns eine liebliche Insel, von freundlichem Grün bewachsen. Wir stehen an der „Lagune“ (18), dem zweiten großen Wasserbecken des Ausstellungsgeländes, und die menschenfreundlichen Veranstalter haben mit Rücksicht auf den reizenden Anblick, welchen sie bietet, in die Pavillons der Gartenbauhalle zweckmäßig Erfrischungsräume geplant.
Nun aber weiter!
In der Verlängerung der Gartenbauhalle liegt ein gefälliger, fast kokett schlichter Bau (21), der doch das merkwürdigste und absonderlichste Stück der Ausstellung birgt. Wir sind hier nämlich eingetreten in das Reich der Frau: eine junge Dame, Mrs. Sophia Hayden, hat den Plan zu dem Gebäude entworfen; was die Frauen Amerikas leisten in Kunst und Gewerbe, Wohlthätigkeit und Krankenpflege, Haus- und Küchenwesen, das wird hier zur Anschauung gebracht werden und sich messen mit dem, was ihre Schwestern in Europa erreicht haben. Eine Frau, die Gattin des Ausstellungspräsidenten Palmer, steht an der Spitze dieser Abtheilung und das Komite, das mit ihr zusammenarbeitet, setzt sich ausschließlich aus Frauen zusammen.
Im Rücken der beiden letzterwähnten Gebäude erstreckt sich Midway Plaisance (20). Hier ist Raum gelassen für die Fremden aller Nationen, sich mit kleineren Bauten ihrer heimischen Art den Besuchern vorzustellen; hier wird man durch eine Straße von Kairo wandern, in Indianerwigwams treten, chinesische, javanische, mexikanische, siamesische, polynesische und wer weiß was für Gehöfte bestaunen, im übrigen aber auch von einem deutschen Dorfe und von der getreuen Nachbildung einer mittelalterlichen deutschen Stadt sich anheimeln lassen.
An der Nordseite der „Lagune“ hat sich der Staat Illinois für seine Sonderausstellung ein eigenes Heim eingerichtet (25), ein Vorzug, den auch die Bundesregierung der Vereinigten Staaten genießt (23). Zwischen beiden, rings vom Wasser der Lagune umgeben, liegt die Fischereiausstellung (24) mit ihren Riesenbehältern für lebende Fische. Hinter dem Gebäude des Staates Illinois endlich erstreckt sich einem breiten Kanal entlang der Kunstpalast (26). Die Parkanlage (27), die von diesen Bauten und dem See umschlossen wird, ist vorläufig noch für Sondergebäude fremder Staaten vorbehalten.
Der Weg am Leuchtthurm vorüber führt zur Marineausstellung. Man hatte den sinnigen Gedanken, diese Ausstellung in einer naturgetreuen Nachbildung eines großen Küstenkriegsschiffs unterzubringen, welches da gleichsam im Hafen vor Anker liegt. Der Bau ist vom Seedepartement der Vereinigten Staaten entworfen und wird alle Fortschritte des Seekriegswesens, Schiffsgeschütze aller Kaliber, Drehthürme, Torpedos etc. zur Anschauung bringen. Und wer sich von den grausenerregenden Eindrücken dieser Höllenmaschinen erholen will, der kann hinaufsteigen auf den 23 Meter hohen Mast und seine erhitzte Phantasie kühlen an der erfrischenden Brise vom See her.
Noch haben wir, ehe wir diesen Rundgang schließen, einige Gebäulichkeiten am Südende des Platzes ins Auge zu fassen, es sind die Forstausstellung (4) mit der Dampfholzsägerei (3), bei dem Holzreichthum Nordamerikas ein hochwichtiges Glied des Ganzen, die ausgedehnten Viehställe (1) und die Molkerei (5).
Alle diese Gebäude, deren äußere Wandungen zumeist mit einer farbigem Marmor täuschend ähnlichen Masse, einer amerikanischen Erfindung (Staff), bekleidet sind, befinden sich zur Zeit in einem mehr oder minder vorgeschrittenen Stadium der Ausführung; doch nimmt man, wie schon erwähnt, an, daß sie sämmtlich am 12. Oktober fertig sein werden, so daß noch im Herbste dieses Jahres mit der inneren Ausstattung wird begonnen werden können. Selbstverständlich wird in der Erleichterung [558]
des Verkehrs innerhalb des Ausstellungsgebietes vermittelst elektrischer und anderer Bahnen und Wasserfahrzeuge, in Elevatoren etc., das äußerste gethan werden; das ist ja schon durch die in Aussicht genommene riesige Besuchsziffer bedingt. Bemerkenswerth ist noch, daß die Beleuchtung der Ausstellung gegen 140000 Lampen und 22000 Pferdekräfte erfordert! Für Trank und Speise sorgen zweihundert Wirthschaften, und wenn auch das Projekt des Morisonthurmes, der den Eiffelthurm der Pariser übertrumpfen sollte, ebensowenig zur Ausführung kommen wird wie der Silberpalast, den einer aus dem Silbervorrath des Schatzamts zu Washington zu erbauen vorschlug – es handelt sich um die runde Kleinigkeit von zwei Milliarden Mark – so wird es doch nicht an allerlei anderen Wunderdingen fehlen, die internationale Schaulust mächtig anzuregen. Da spricht man von einem lenkbaren Aluminiumluftballon, von einem kalifornischen Riesenbaum mit der Einrichtung eines Pullmannschen Salonwagens, Restauration und Küche im Inneren, von einer künstlich nachgebildeten Austernbank und was dergleichen reizende Dinge mehr sind.
Kurz, die „Kolumbische Weltausstellung“ setzt alle Hebel in Bewegung, durch Größe, Neuheit und Kühnheit alle ihre Vorgängerinnen zu schlagen und einen Markstein zu bilden in der Geschichte der Ausstellungen. Manche Uebertreibung läuft dabei mit unter; man nimmt’s nicht so genau, wenn es gilt, die Erwartungen aufs äußerste zu spannen. Möchten die Chicagoer doch sogar eine Ausstellung von Geist und Wissen veranstalten in ihren Gelehrten- und Künstlerkongressen, die sie aus aller Herren Ländern zusammenladen wollen! Wie dem aber sei, die Gartenstadt am Michigansee wird auch ohne solche Stückchen im nächsten Jahre das Wallfahrtsziel für viele Millionen Menschen bilden, sie wird dem, der sehen kann und sehen will, gar viel zu lernen und zu denken geben.
„Das Geheimniß des Schlosses von St. Leu.“
Es ist dafür gesorgt, daß es der Republik Frankreich in ihrer steten Fortentwicklung und Festigung nicht an Hemmnissen und Widerwärtigkeiten aller Art fehle, und immer wieder droht von Zeit zu Zeit die Frage der Wiederherstellung einer Monarchie greifbare Gestalt anzunehmen. Zwar sind die Franzosen vorläufig die Napoleoniden los geworden, auch die Bourbonen brauchen sie nicht mehr zu fürchten, da ja das ganze Haus ausgestorben ist; aber um so rühriger erweisen sich im stillen die Nachkommen des ehemaligen „Bürgerkönigs“ Louis Philipp und zeigen dadurch aufs deutlichste, daß sie nicht gesonnen sind, ihre Ansprüche auf den Thron Frankreichs aufzugeben. Bis zur Stunde freilich hat es den Anschein, als könnten alle solche Bestrebungen nichts bedeuten, als wären die reichen Schenkungen des Herzogs von Aumale eitel „verlorene Liebesmüh’“. In der That ist eine Dynastie Orleans dermalen noch so undenkbar wie vor fünfzig Jahren. Die Franzosen wissen zu gut, wie verhängnißvoll diese Fürstenfamilie in die inneren Geschicke ihres Landes eingegriffen und welches Unheil der gekrönte Bankier Louis Philipp trotz all seiner „Biederkeit“ in die französische Gesellschaft getragen hat. Ueber das „Julikönigthum“ hat die Geschichte längst ihr abfälliges Urtheil ausgesprochen, aber weniger bekannt dürfte sein, wie der König der „richtigen Mitte“ gleich zu Beginn seiner Herrschaft ein Regierungsprogramm enthüllt hat, welches, folgerichtig durchgeführt, ganz geeignet war, in der Folge die Dynastie Orleans dem Lande verhaßt und verächtlich zu machen. Wir meinen die Art und Weise, in welcher Louis Philipp bei jeder ihm halbwegs passenden Gelegenheit sich beeiferte, seinen stark ausgeprägten Erwerbssinn, seine Lust an der Vermehrung des rein persönlichen Besitzes, zu bethätigen.
Durch das Gesetz der Milliardenentschädigung, welches am 23. April 1825 der Kammer vorgelegt worden und mit 221 gegen 130 Stimmen durchgegangen war, wurde den Orleans eine Entschädigung von 80 Millionen Franken zugesprochen, welche Summe mit dem aus den Stürmen der Revolution „geretteten“ Besitz vereinigt ein Gesammtvermögen von über 100 Millionen darstellte. Als durch die Julirevolution die Orleans auf den Thron kamen, erwies sich Louis Philipp gleich von Anfang an als sorgsamer Familienvater, indem er durch eine Schenkung unter Lebenden sein großes Vermögen den Kindern zu sichern bestrebt war, ganz im Gegensatz zu den alten Gebräuchen der französischen Könige, deren Privatgüter „vermöge der vollständigen Ehe der königlichen Person mit dem Staate“ bei der Thronbesteigung mit den Staatsdomänen verschmolzen wurden.
Bald aber führte ein ganz besonderer „Glücksfall“ seinem Hause einen neuen Besitzzuwachs von beiläufig 60 Millionen zu durch ein Ereigniß, welches in den Geschichtsbüchern unter dem Titel „Das Geheimniß des Schlosses von St. Leu“ aufgeführt wird.
Am 27. August 1830, morgens neun Uhr, wurde nämlich der letzte Sproß der ruhmvollen Familie Condé, der Vater des unglücklichen Herzogs von Enghien im Schlafzimmer seines Schlosses zu St. Leu, unfern von Paris, erhängt aufgefunden. Prinz Louis Heinrich Josef von Condé, Herzog von Bourbon, hatte die letzten Jahre seines bewegten Lebens in ländlicher Zurückgezogenheit verbracht. Er hatte die Julirevolution mit einem Feste auf seinem Landsitze gefeiert und später in aller Form dem neuen Konig seine Huldigung dargebracht. Die Königin Marie Amalie hatte ihn in seinem Schlosse besucht und sich herbeigelassen, seiner wahrlich nicht im Geruch der Heiligkeit stehenden Hausgenossin aufs freundlichste zu begegnen. Diese, die Baronin Feuchères, ehemals Sophie Clarke, eine englische Abenteurerin niederster Art, war die Tochter eines Fischers von der Insel Wight. Der Prinz Condé hatte sie in London, während er mit dem Grafen von Artois als [559] Flüchtling daselbst lebte, kennengelernt, sich lebhaft für das witzig muntere und hübsche Naturkind interessiert, es auf seine Kosten erziehen und zu seiner Gesellschafterin ausbilden lassen. Aber er erntete schlechten Lohn für all seine Wohlthaten. Sophie Clarke, in Bälde zu einer stattlich schönen, ebenfo klugen wie energischen Dame herangewachsen, bereitete ihrem Adoptivvater manche schwere Stunde. Sie hatte Condé’s Adjutanten, einen braven Offizier, den Baron Feuchères, geheirathet, doch wurde nach einem ärgerlichen Prozeß die Ehe bald wieder aufgelöst, und die geschiedene Frau ward nunmehr des Prinzen erklärte Freundin. Bald wußte sie sich des schwachen Greises derart zu bemächtigen, daß dieser kaum mehr einen Schatten freien Willens besaß und geradezu in beständiger Furcht vor seiner Peinigerin lebte. Jahrelang arbeitete sie daran, Condé zu bestimmen, daß er den dritten Sohn des Herzogs von Orleans zu seinem Universalerben einsetze und ihr selber bedeutende Legate zuwende. Um dieses Ziel zu erreichen, mußte ein langer und heftiger Widerstand beseitigt werden, allein die Baronin verstand es, mit allem Aufwand an List und Thatkraft langsam, aber um so sicherer vorzugehen. Erst sollte die Adoption einem anderen Prinzen des königlichen Hauses zu theil werden. Die Feuchères suchte also zunächst Fühlung mit dem Hofe und bot anfänglich der Herzogin von Berry ihre Dienste an, weil Condé in der That damals beabsichtigte, dem Herzog von Bordeaux seinen glorreichen Namen und seine unermeßlichen Besitzungen zu vererben. Aber der Graf von Artois, der später als Karl X. den Thron Frankreichs bestieg, nahm eine solche Schenkung nicht an und verwies Condé an seine näheren Verwandten, die Rohans. Der Feuchères selbst wurde der Zutritt zu den Tuilerien verweigert; sie beschloß, sich an die Orleans zu wenden, wo sie denn wirklich die beste Aufnahme fand. Die für die Familie Orleans „so interessante Angelegenheit“, wie der Herzogin eigene Worte lauteten, wurde alsbald eingeleitet und trotz aller Hindernisse zu einem gedeihlichen Ende geführt.
Die Feuchères wußte es durchzusetzen, daß Condé im Jahre 1822 den Herzog von Aumale aus der Taufe hob, und im April 1827 schien die Adoption des jungen Prinzen zur Thatsache werden zu wollen; aber am 2. Mai 1829 mußte dennoch die Sache in dieser Fassung wieder als gänzlich gescheitert angesehen werden. Nunmehr begannen die Anstrengungen zur Erlangung eines günstigen Testamentes.
Condé ertrug schwer und widerwillig das Joch, in welches die Baronin Feuchères ihn gespannt hatte; er wollte es um jeden Preis abschütteln, auch war ihm der Herzog von Aumale als Träger seines Namens gar nicht, als Erbe seiner Güter nur halb willkommen. Aber der alte Mann war dem intriganten Weibe in keinem Stücke mehr gewachsen, und um vor ihrer unausgesetzten Belästigung endlich einmal Ruhe zu haben, willigte er am 30. August 1829 ein, das längst in Bereitschaft gehaltene Testament zu unterschreiben. Es handelte sich um einen Besitzstand von 73 Millionen, wie uns Crétineau-Joly in seiner „Geschichte der letzten drei Prinzen aus dem Hause Condé“ genau mittheilt. Zwölf Millionen erbte die Feuchères als Lohn für ihre Bemühungen, der Rest, nach Abzug einiger Legate, fiel dem Haupterben, dem Herzog von Aumale, zu.
Da kam die Julirevolution, der Herzog von Orleans bestieg als „König der Franzosen“ den Thron. Die selbstsüchtige Handlung Louis Philipps, sein Privatvermögen den Kindern zu sichern, mißfiel der anständiger denkenden Nation und mußte auch einem Kavalier aus der alten Schule wie Condé stark mißfallen. Er wurde den Orleans gegenüber kälter, trotz der Aufmerksamkeiten, welche ihm von ihrer Seite geflissentlich erwiesen wurden; überbrachte ihm doch die Königin in eigener Person den Großkordon der Ehrenlegion!
Bald drohte eine ernste Gefahr, denn der reiche „Onkel“ wollte St. Leu verlassen, nach einem heftigen Streite mit seiner tyrannischen Freundin nach Chantilly übersiedeln. Schon ist der Wagen bestellt, dem Stallmeister sind die Diamanten anvertraut, der Prinz hat bereits eine Million, in gute Bankscheine umgewechselt, zum Mitnehmen im Bereitschaft. Einmal in Chantilly, wäre es ihm ein Leichtes gewesen, ein neues Testament zu machen. Soweit durfte es nicht kommen. Louis Philipp, von dem Vorhaben des Prinzen in Kenntniß gesetzt, beging in leidenschaftlicher Verblendung den unverzeihlichen Fehler, an die Feuchères zu schreiben, sie solle um jeden Preis des Prinzen Condé Abreise zu verhüten suchen. Welche Deutung das lasterhafte Weib den königlichen Worten „um jeden Preis“ gab, das zeigte sich, als man den alten Mann in seinem Schlafzimmer erhängt auffand. Niemand unter der Dienerschaft wollte an ein selbstgewähltes Ende aus Lebensüberdruß glauben, so absichtlich auch alle Veranstaltungen getroffen waren, um diesen Schein zu erwecken.
Das Schlafzimmer, gegen die Parkseite zu gelegen, hatte zwei Eingänge. Die Hauptthür, hinter der mit einem Schlüssel abgeschlossenen Flurthür gelegen, fand sich an jenem Morgen stark verriegelt, die andere Thür, auf eine Seitentreppe führend, war ebenfalls verschlossen, doch zeigte es sich später, daß ein dort angebrachter Mechanismus erlaubte, auch von außen her den inneren Riegel vorschnappen zu lassen. Ob diese Thür in der kritischen Nacht offen gestanden hatte und erst später verschlossen wurde, ist nicht festgestellt worden.
Der Körper des Prinzen war vermittelst zweier Taschentücher, von denen das eine um seinen Hals gelegt war, am Fensterhaken aufgeknüpft vorgefunden worden. Einer der Diener erklärte auf Gruud von Erfahrungen, die er im Orient gesammelt hatte, frei heraus, daß hier von einem Tode durch Erhängen nicht die Rede sein könne; ja Mr. Lafontaine, Generalinspektor der prinzlichen Forsten, machte den Versuch, sich in der angegebenen Weise mit zwei Taschentüchern aufzuhängen, und fand, daß es unmöglich sei, sich auf diese Weise das Leben zu nehmen. Hierzu kam noch der Umstand, daß die Taschentücher kunstvoll verschlungen waren mit einem sogenannten Weberknoten, welchen der Prinz, der infolge früherer Wunden am Oberarm und an der Hand halb gelähmt und ziemlich unbeholfen war, sicher in solcher Höhe über dem Kopfe nicht hätte knüpfen können, auch wenn er im übrigen diese Fertigkeit besessen hätte. Die Mbbel des Zimmers befanden sich in einer allzu schlau ersonnenen Unordnung. In einer Ecke stand ein Gewehr, sorgfältig gereinigt und frisch geladen: ein Umstand, der wohl einen Selbstmord vollständig ausschließt, denn der frühere tapfere Soldat, der bis zuletzt dem Jagdvergnügen mit Leidenschaft oblag, hätte sich sicher mit einer Kugel, nicht mit dem Stricke den Tod gegeben.
So war im Grunde eigentlich niemand da, der so recht an einen Selbstmord des Prinzen Condé glaubte, vielmehr bezeichnete die öffentliche Stimme von Anfang an die Feuchères als die Urheberin eines lange vorher geplanten Verbrechens. Dennoch wurde die Dame, nachdem eine höchst lässig und oberflächlich geführte Voruntersuchung ergebnißlos geblieben war, keiner kriminalgerichtlichen Verfolgung unterworfen, obwohl der Generaladjutant Louis Philipps, Theodor de Rumigny, der eigens nach St. Leu abgesandt worden war, an den König geschrieben hatte: „Der Tod des Prinzen sIeht nicht wie Selbstmord aus.“ Aber ein grimmiger Feind war der Feuchères erstanden in der Person des prinzlichen Almoseniers, Pellier de Lacroix, der bei der Beisetzung des Herzens von Condé in der Kapelle zu Chantilly in einer ergreifenden Trauerrede unumwunden erklärte, daß der Prinz vor Gott an seinem Tode unschuldig sei; das hieß so viel, als er sei ermordet worden, denn einen Selbstmörder hätte man ja nicht mit kirchlichen Ehren beerdigen dürfen. Derselbe thatkräftige Mann wußte es schließlich bei dem König durchzusetzen, daß nach beinahe drei Monaten der Fall wieder aufgegriffen wurde und daß ein Rathsherr des Appellhofes nach langer und mühsamer Prüfung einen Antrag stellte, nach welchem das Tribunal die Feuchères in den Anklagezustand versetzte.
Der Fall beschäftigte den ehrenwerthen Richter De la Huproye vom 6. Februar bis 2. Juni 1831; er hat während dieser Zeit 120 Zeugen verhört, 231 Aussagen entgegengenommen. Immer enger zog sich das Netz zusammen über dem Haupte des schuldigen Weibes und immer bänger wurde dem König zu Muth. Er hielt Berathungen ab mit seiner klugen Schwester, der Prinzessin Adelaide, und mit Persil, dem Generalprokurator des königlichen Gerichtshofes von Paris. De la Huproye war entschlossen, seinen Bericht der Anklagekammer vorzulegen; dies durfte nicht geschehen. Am 3. Juli abends begab sich Persil in die Wohuung des Richters, der uns Aufzeichnungen über diesen Besuch hinterlassen hat. Persil ruft aus: „Es handelt sich hier nicht um Schuld oder Unschuld eines anrüchigen Weibes, es handelt sich um das [560] Ansehen des Hauses Orleans, das in eine unheilvolle Solidarität verwickelt ist, aus welcher es um jeden Preis gezogen werden muß.“
Nach qualvollem Kampfe zwischen seiner Pflicht und den Rücksichten auf seine Familie ließ sich De la Huproye schließlich bestimmen, ein Entlassungsgesuch einzureichen, welches unter den für ihn ehrenvollsten Ausdrücken genehmigt ward. Sein Schwiegersohn, Theurier de Pommier, ward auf den Richterstuhl am Civiltribunal des Seine-Departements befördert. Die anderen Richter hatten zum Glück nicht den unbequemen Eigensinn des alten Starrkopfes, und so ging alles nach Wunsch.
Nun beachte man die rasche Erledigung des Falles! Am 4. Juni bringt der „Moniteur“ die Verabschiedung De la Huproyes und die Ernennung Theurier de Pommiers, am 10. Juni hat De la Huproye die ganze riesig umfangreiche Aktenmasse noch in Händen, dann erhält sie Persil, der sie an De la Huproyes Nachfolger, Brière-Valigny, übergiebt – und am 21. Juni schon ist geheime Sitzung, in welcher die Kammer entscheidet: „daß es nicht feststehe, daß der Tod des Prinzen Condé die Folge eines Verbrechens sei“. Gegen dieses Urtheil nun ergriff Maître Hennequin, der Vertreter des Prinzen Rohan, bereits am 24. Juni Berufung, und nunmehr zeigte es sich, daß aus den Akten ein wichtiger Theil verschwunden war, von unbekannt gebliebener Hand beseitigt. Am 22. Juli wurde dann des Prinzen Sache (Condés Mutter war eine Rohan-Soubise, der Klagesteller somit der nächste Anverwandte des Verstorbenen) vor der Kriminalkammer verhandelt und verworfen, „da der Rekurs-Ergreifende Civilpartei und als solche die Anklagekammer nicht anzurufen befugt sei.“ Es blieb also bei den Verfügungen des Testamentes.
Der schon erwähnte Almosenier des Prinzen von Condé, Abbé Pellier, hatte ein gründliches und ganz sachlich gehaltenes Buch: „Die Ermordung des letzten Condé erwiesen“ gegen die Baronin Fenchères und deren Advokaten veröffentlicht. Er wurde ohne weiteres seiner Stelle enthoben und ebenso die Maßregelung anderer mißliebig gewordener Personen vorgenommen. Auf die gefügigen Richter und Justizbeamten jedoch ergoß sich ein wahrer Gnadenregen von Auszeichnungen und Beförderungen. Dann wurde von des letzten Condé Hinterlassenschaft Besitz ergriffen in einer Weise, die mehr als bezeichnend war für die bereits bekannt gewordene „Sparsamkeit“ Louis Philipps; denn es blieben die wichtigsten Testamentsklauseln einfach unberücksichtigt, wenn dadurch „ökonomisiert“ werden konnte.
Nicht in Vincennes neben seinem unglücklichen Sohne wurde Condé bestattet, sondern in St. Denis; für Errichtung eines Erziehungshauses in Ecouen waren zwei Millionen ausgesetzt; diese stattliche Summe blieb so lange ihrer Bestimmung vorenthalten, bis die Beschwerden von seiten der Rohans so heftig wurden, daß man füglich nicht mehr darüber weggehen durfte. Die zahlreiche Dienerschaft Condés wurde alsbald verabschiedet, der bewegliche Nachlaß öffentlich an den Meistbietenden versteigert.
Die Fenchères, welche St. Leu erbte, das Schloß jedoch später niederreißen ließ, ist am 2. Januar 1841 in England an Halsbräune eines qualvollen Todes verstorben. Ihre Testamentsvollstrecker haben nie in Abrede gestellt, daß sie im Besitz eines Briefes gewesen sei, in welchem Louis Philipp ihr schrieb, sie müsse „um jeden Preis“ die Abreise des Prinzen verhindern. Dieser Brief mag sie vor dem Schafott bewahrt haben. Einige Zeit vor ihrem Tode wollte sie, um ihr Gewissen zu erleichtern, der Familie Orleans dieses Schriftstück, uuter Bedingungen natürlich, zurückgeben, doch brauchte man damals diese Dame nicht mehr zu fürchten, und so blieb ihr Anerbieten unbeachtet.
Heutzutage hat das düstere Geheimniß des Schlosses von St. Leu längst zu existieren aufgehört. Im vierten Bande seiner

Die Kolumbische Weltausstellung in Chicago.
Zeichnung von H. Nisle.
1. Ausstellung lebender Thiere. 2. Versammlungshalle. 3. Dampfsägewerk. 4. Forstausstellung. 5. Molkerei. 6. Kongreßräume. 7. Maschinenhalle. 8. u. 12. Landwirthschaftsgebäude.
9. Bahnhof. 10. Verwaltungsgebäude. 11. Großes Bassin. 13. Statue der Republik. 14. Bergbau. 15. Elektricität. 16. Verkehrsmittel. 17. Industriepalast. 18. Parkinsel. 19. Gartenbauhalle. 20. Fremdländische Dorf- und Stadt[??]pen. 21. Frauenpalast. 22. Kasino. 23. Gebäude der Bundesregierung. 24. Fischereiausstellung. 25. Gebäude des Staats Illinois. 26. Kunstpalast. 27. Parkraum für Sonderbauten fremder Staaten. 28. Marineausstellung. 29. Michigansee. 30. Lage der Stadt Chicago.
[561] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt.
weit angelegten Geschichte Louis Philipps hat der Historiker
Billault de Gerainville mit nahezu unumstößlicher Gewißheit
dargethatt, daß die Feuchères unter Mithilfe eines ihrer vielen
Anbeter den alten Fürsten in der Nacht vom 26. zum 27. August
mittels einer Serviette, die bei ihrer Auffindung noch Spuren
von Schnupftabak zeigte, erwürgt und alsdann die Leiche in der
Art, wie dies oben beschrieben wurde, an einem Fensterhaken
aufgehäugt hat. Der Mitschuldige des Schandweibes, welches
diesen verruchten Plan ersonnen hat, einzig um die auf den
nächsten Tag festgesetzte Uebersiedlung des Prinzen nach Chantilly
zu vereiteln, war ein schmucker Gendarmerie-Unteroffizier, der
tagsüber auf dem Schlosse im Zimmer des der Feuchères ganz ergebenen
Geistlichen Briant sich verborgen hielt. Er hat noch im
Jahre 1884 in Paris gelebt, in angesehener Stellung, inmitten
einer zahlreichen Familie, und dieser Umstand hat Billault de
Gerainville bestimmt, uns seinen Namen zu verschweigen, während
er an der Hand eines überreichen Materials uns alle Fäden der
fein gesponnenen und weit verzweigten Intrigue bloßlegt, durch
welche es dem „König Biedermann“ gelungen ist, seiner Familie
das reiche Erbe der Condés zu sichern.
Ueber den Tod und den Prozeß des Prinzen sind 27 zum Theil sehr umfangreiche Schriften erschienen, deren genaue Titelaufführung allein schon einige Seiten füllen würde; aber noch weit eingehender befassen sich handschriftlich erhaltene Aufzeichnungen mit dem Falle, Briefschaften, Abrechnungen aller Art, sogar die Schulhefte der Sophie Clarke, späteren Baronin Feuchères, haben Billault de Gerainville bei der Abfassung seines Buches vorgelegen. Nicht der unmittelbaren Mitschuld will er den König zeihen, „aber“, so schließt das betreffende Kapitel, „dadurch, daß Louis Philipp die Mörder seines Onkels entkommen ließ, indem er unter der empörendsten Herzenskälte alle Gefühle der Natur erstickte, hat er seinem Namen einen unauslöschlichen Fleck angeheftet, und die Nichtbestrafung des Verbrechens von St. Leu wird als eine ungesühnte That für immer mit erdrückender Schwere auf seinem Gedächtnisse lasten.“
Ueber den Eindruck, welchen der Fall Condé auf die Pariser und die Franzosen überhaupt machte, hat ein Zeitgenosse und zwar kein anderer als der deutsche Dichter Heinrich Heine sich geäußert in einer seiner ersten Korrespondenzen für die „Allgemeine Zeitung“, wo es unter dem Datum des 28. Dezember 1831 heißt:
„Mehr aber … wird der König jetzt durch den famosen Erbschaftsprozeß, den die Familie Rohan wegen der Bourbon-Condé’schen Verlassenschaft anhängig gemacht, aufs schmerzlichste kompromittiert. Dieser Gegenstand ist so entetzlich, daß selbst die heftigsten Oppositionsjournale sich scheuen, ihn in seiner ganzen grauenhaften Wahrheit zu besprechen. Das Publikum wird davon aufs peinlichste affiziert, die leise, verstohlene Art, wie man in den Salons darüber flüstert, ist beängstigend, und das Schweigen derjenigen, die sonst immer das königliche Haus vertreten, ist noch bedenklicher als das laute Verdammnißurtheil der Menge. Es ist die Halsbandgeschichte der jüngeren Linie, nur daß hier statt Hofgalanterie und Falsum etwas noch Gemeineres, nämlich Erbschleicherei und (von einer Theilnehmerin verübter) Meuchelmord in Rede stehn. Der Name Rohan, der auch hier zum Vorschein kommt, erinnert leider zu sehr an die alten Geschichten. Es ist, als hörte man die Schlangen der Eumeniden zischen und als wollten die strengen Göttinnen keinen Unterschied machen zwischen der älteren und jüngeren Linie des verfehmten Geschlechtes.“
Alle Biographen Louis Philipps, alle Historiker der Juli-Regierung von Louis Blanc angefangen bis zu Billault de Gerainville, dem jüngsten unter ihnen, sind einig in dem verdammenden Urtheil, welches sie über die verderbten Zustände fällen, die unter dem „Bürgerkönig“ bestanden. Auf einem der letzten sogenannten „Reformbankette“ sprach Lamartine die prophetischen Worte: „Nachdem wir die Revolution der Freiheit und [562] die Gegenrevolution des Ruhmes gehabt, werden wir die Revolution des öffentlichen Gewissens, die Revolution der Verachtung haben.“
Wenige Wochen später, am 24. Februar 1848 um die Mittagsstunde, bestieg Louis Philipp am Concordienplatz, der Stelle gegenüber, wo sein Vater Philip Egalité unter der Guillotine geendet hatte, den schlichten Einspänner, der ihn aus Paris führte, und als entthronter Herrscher hat der Greis seine letzten Tage in der Fremde verlebt. Die Juli-Dynastie ist in der That einer Revolution der Verachtung zum Opfer gefallen, das Schuldbuch der Familie Orleans war vollgeschrieben bis zum letzten Blatt.
Der Klosterjäger.
Es war Herbst geworden. Von den Buchen fiel bereits das welke Laub, und in den kühlen Nächten begannen vereinzelt schon die Hirsche zu röhren.
Wieder erwachte ein Morgen über dem See. Ein grauer, schwerer Nebel lagerte auf dem Wasser und fluthete um die Bartholomäer Klause. Man konnte kaum auf zwanzig Schritte sehen. Die Thür des Kirchleins war offen, und drinnen, im Dämmerlicht der schmalen Halle, stand Pater Eusebius neben dem Altar. Auf den Stufen kniete Wolfrat. Als er sich erhob, schlug er das Kreuz mit der linken Hand; der rechte Arm, den der Aermel umhüllte wie einen dürren Stecken, hing in einer ledernlen Schlinge.
Schweigend traten sie ins Freie und gingen zum Ufer.
„Schau, Wolfrat, da wartet schon das Schiffl,“ sagte Pater Eusebius und legte seine Hand auf die Schulter des Sudmanns. „Jetzt schau’ halt, daß Du gut heimkommst. Und gelt ... sei gescheit und mach’ keine Streich’ mehr!“
Wolfrat schüttelte den Kopf und griff nach der Hand des Paters. Die Augen gingen ihm über. „Vergelt’s Gott für alles, vergelt’s Gott tausendmal ...“ So stammelte er immer wieder und drückte und quetschte dabei die Hand des Paters, als wär’ sie eine Nuß, die er knacken müsse.
„Ja hörst nicht auf!“ stöhnte Eusebius und befreite seine roth überlaufenen Finger. „Der Kerl druckt noch mit einer Hand wie ein anderer mit zwei. Jetzt mach’ aber, daß Du weiter kommst . . . oder hast vielleicht an den fünf Monaten daherin nicht genug gehabt? Geh’, Wolfrat, geh’! Wenn der Schnee fallt, komm’ ich auch hinaus, und dann schau’ ich schon einmal nach, wie’s geht bei Dir daheim!“ Er schob den Sudmann in das Schiff, in welchem ein Knecht schon das Ruder bereit hielt.
Wolfrat konnte nicht sprechen, er nickte nur immer und winkte mit der Hand. Ein Ruck des Schiffes warf ihn auf den Sitz nieder. Schon nach wenigen Ruderschlägen war die Klause im Nebel verschwunden. Wolfrat trocknete die Augen und starrte mit verlorenem Blick in die grauen Schleier, die ihn umhüllten, ihn und das dunkle Los, dem er entgegenfuhr. Sein Herz dürstete nach Weib und Kind. Aber wie durfte er sich freuen, da ihm das Schwerste noch bevorstand. Mit dem lieben Herrgott war er vielleicht auf gleich gekommen; aber der Vogt hatte auch noch ein Wörtlein zu reden. Und wenn die Strafe überstanden war, wie sollte er dann schaffen für Weib und Kind mit seinem lahmen Arm? Im Sudhaus war es vorbei mit der Arbeit; da brauchte man Leute, die ihre ganzen, gesunden Glieder hatten. Mit der Bauernarbeit war es auch nichts; noch weniger mit Holzen und FlÖßen. Vielleicht aber fand sich etwas für ihn im Bergwerk? Auf einen Hauerdienst durfte er freilich nicht rechnen; aber einen guten Schlepper[1] gäbe er wohl noch ab; so schwer mochte keiner den „Hund“ laden daß er ihn nicht vom Fleck brächte. Ein Schlepper also! Er seufzte tief auf und strich mit zitternder Hand über den dürren Arm.
Da blies ihm ein frischer Wind in den Nacken; der See begann sich zu kräuseln, und der Nebel kam in Bewegung. Wie in Streit und Kampf wallten die grauen Massen durcheinander, wirbelten in drängender Eile über das Wasser, rissen entzwei, zeigten für einen Augenblick ein blaues Flecklein Himmel oder eine sonnig schimmernde Bergzinne, schlossen sich wieder und flossen wogend durcheinander. Doch immer dünner wurden die grauen Schleier, bald waren sie nur noch anzusehen wie ein bläulicher Duft, durch welchen schon der Glanz der Sonne herniederquoll auf das Wasser ... jetzt theilten sie sich mit einem klaffenden Riß über den ganzen See hin, legten sich an beiden Ufern mit fließenden Falten über den steilen Bergwald und schwammen langsam in die Höhe, spurlos zerrinnend in der leuchtenden Luft.
Ach, welch ein schöner Morgen! Mit nassen Augen blickte Wolfrat umher in all dieser farbigen Pracht des Herbstes: tiefblau der Himmel, weißglänzend alle Kalksteinfelsen der hohenl Wände, die Nadelwälder saftig grün, alles Laub so feurig gelb und roth, als stünde jede Buche und jeder Ahorn in hellen Flammen ... und über dem ganzen See, auf jeder kleinen laufenden Welle, blitzte der Widerschein der Sonne mit tausend gaukelnden Lichtern.
Der Nachen fuhr ans Land. Wolfrat stieg aus, reichte dem Knechte wortlos die Hand und ging mit raschen Schritten davon. Er athmete freier; es war etwas in seine bedrückte Seele gefallen wie ein Trost. Wo er auch ging ... überall Glanz und Licht. Die braunen Wiesen im Thau, die von Spinnwebnetzen überzogenen Stoppelfelder, die welken Hecken und Bäume, die weiße Straße, die fliegenden Fäden in der Luft ... alles schimmerte. Aus Höfen und Hütten, das weite Thal entlang, stieg in geraden Säulen der blaue Rauch. In der Ferne, zwischen schlanken Fichtenwipfeln, funkelten die vergoldeten Kreuze auf Thurm und Dach des Stiftes, und dahinter, gleich einem riesenhaften Grenzstein des Klosterlandes, erhob sich der Untersberg, über dessen höchste Felsen schon ein dünner Schnee gefallen war, so zart und duftig, als hätten die rothen Marmorstöcke weiß geblüht.
Nicht weit von der Seelände blieb Wolfrat verwundert stehen. Da war ein neues stattliches Haus aus der Erde gewachsen; es stand zwischen Bäumen und inmitten einer Wiese, die ein frisch geflochtener Hag umschloß. Der Unterstock war gemauert, der Oberstock aus zierlich gefächertem Sparrenwerk gebildet. Auf dem Giebel des weißen Schindeldaches war, die Vollendung des Hauses kündend, ein mit bunten Bändern geschmücktes Tannenbäumchen errichtet. Dem Haus zur Seite stand ein zweiter Bau, Stall und Scheune. Eine Schar von Arbeitern tummelte sich, um den Bauplatz zu räumen; aus allem Lärm klang immer wieder eine befehlende Stimme, die der Sudmann zu kennen meinte.
„Wohl wohl, da ist er schon!“ murmelte er und folgte mit sinnendem Blick dem Chorherrn, dessen schwarzes Kleid bald hier, bald dort, an allen Ecken und Enden auftauchte und wieder verschwand in treibender Geschäftigkeit.
Auf der Straße stand ein Wagen, der mit dem Abraum des Baues beladen wurde. Einen der Knechte, welche Gebälk und Steine zum Wagen trugen, fragte Wolfrat: „Wem gehört das Haus?“
„Dem Kloster. Um Sonnwend ist kein Stein noch gestanden ... und jetzt schau das Haus an!“ Der Knecht maß ihn mit zwinkernden Augen. „Wer bist denn Du?“
Wolfrat ging ohne Antwort davon; hinter seinem Rücken hörte er den Knecht noch sagen: „Meiner Seel’, das ist heilig der Sudmann, den der Bär in der Arbeit gehabt hat!“
Je näher Wolfrat dem Klosterdorf kam, desto heißer wurde ihm ums Herz. Von weitem schon suchte er den Giebel seines Lehens; er fand ihn nicht ... und ein quälendes Bangen beschlich ihn, als er neben dem Dach des Eggehofes, dort, wo sonst der moosbehangene Giebel seines Häusleins hervorgelugt hatte, einen First von frischen Brettern leuchten sah. Und immer größer wurden seine Augen, je näher er kam. War denn das noch sein [563] Lehen? Die Lehmwände weiß getüncht, das Dach geschindelt, kein schiefer Laden mehr, überall neue Bohlen und Bretter . . . das ganze Haus um ein doppeltes gewachsen, denn aus dem niederen Schuppen war ein Stall und eine Scheune geworden! Und das Rothe im Garten ... was war denn das? Herr Gott, das waren ja zwei grasende Kühe!
Wolfrat wurde bleich und zitterte. Jetzt wußte er, wie es stand. Sein Lehen war an einen anderen gefallen, der sich das Nestlein schön warm und sauber gerichtet hatte!
Taumelnden Ganges folgte er der Straße. Da sah er das Totenbrett seines Kindes.
„Schau, das hat er doch stehen lassen!“
Aber schief stand es, als wär’ es von einem Wagenrad gestreift worden. Wolfrat richtete es gerade und stampfte den Rasen fest, in dem es stak.
„Mariele!“
Er starrte die Zeichen des Namens an, von denen der Regen fast die ganze Farbe gewaschen hatte. Dann ging er mit hängendem Kopfe weiter. Er machte einen Umweg, um nicht am Sudhaus vorüber zu müssen. Nun stand er am Fuß des Nonnberges, vor der Gartenmauer des Klösterleins, und zog den Glockenstrang. Eine dienende Schwester öffnete.
„Was willst Du?“
„Ist die Seph’ noch da . . . die Polzer-Seph’? ... Ich möcht’ reden mit ihr.“
Die Schwester nickte und schloß die Thür; er hörte sie auf dem knirschenden Kies davongehen. Nach einer Weile näherten sich langsame Schritte, und Seph’ erschien auf der Schwelle. Sie erblaßte vor Schreck und Freude. Wortlos reichten sie sich die zitternden Hände und sahen sich an, mit Zähren in den Augen.
Endlich athmete Sepha tief auf. „Grüß Dich Gott, Polzer!“
„Grüß Dich halt Gott auch, Seph’!“
„Weil Du nur wieder da bist! Mein Gott, ist das eine schieche Zeit gewesen!“
„Gelt, ja!“
Er zog sie sanft von der Thür weg; der Mauer zu Füßen setzten sie sich auf den welken Rasen und ließen die Füße in den Straßengraben hängen. Sie schaute ihn mit kummervollen Blicken an. „Hast denn auch völlig den Gesund wieder?“
„Wohl wohl ... bis auf den da halt!“ Er streifte mit einem Blick seinen lahmen Arm. „Der wird auch nimmer anders ... den muß ich schon haben!“
Ein Schauer rüttelte ihre Schultern, als sie mit den Fingern über den schlotternden Aermel streifte und den leeren Knochen fühlte. Eine stille Weile verrann.
„Aber Du?“ sagte er. „Wie geht’s denn Dir? Ich mein’, Du thust auch noch ein lützel blasselen?“
„Da mußt keine Sorg’ haben. Ich bin lang wieder richtig beinander und kann wieder schaffen wie eh’. Aber jetzt halt ... weißt, ich schau nur so aus, weil ... weil halt ...“ Sie wurde roth. „Merkst es denn nicht?“
Er warf einen Blick über ihre Gestalt. „Seph’! Seph’! O du lieber Herrgott!“ stammelte er und drückte sie mit dem zitternden Arm an seine Brust. So saßen sie lange schweigend und starrten ziellos in den schimmernden Morgen.
„Jetzt kommt’s mir erst doppelt schwer an,“ murmelte er.
„Das wird wohl ein Schmerzenskindl sein . . . das arme Würml.“
„Und der Bub’? Sag’, was macht denn der Bub’?“
Da huschte ein Lächeln über ihre Züge. „Den wirst schier nimmer kennen! Wie der ausschaut! Wie’s helle Leben! Und gut hat er’s. Die besten Bröckerln schieben ihm die Schwestern zu. Ueberhaupt, Polzer . . . wie man da gut mit uns ist, das kann ich Dir gar nicht sagen.“ Die Thränen stürzten aus ihren Augen, aber sie fuhr sich mit dem Aermel über das Gesicht. „Wart’, ich hol’ Dir den Buben, daß doch auch eine Freud’ hast!“ Sie erhob sich und wollte zur Thür.
Er aber schüttelte den Kopf und hielt sie zurück. „Laß ihn, Seph’ .. bis ich wiederkomm’!“
„Wo gehst denn hin jetzt?“ Da sah sie den verstörten Ausdruck seiner Züge und stotterte: „Ja was hast denn?“
„Zum Vogt muß ich ... und muß mich angeben!“
„Polzer!“ schrie sie und blickte sich erschrocken nach allen Seiten um. Die Sprache versagte ihr; nur mühsam brachte sie noch die Frage heraus: „Es muß wohl sein?“
Wolfrat nickte. „Komm’, Seph’, machen wir’s kurz! Behüt’ Dich halt Gott derweil!“
Sie umklammerte seine Hand; aber es kam kein Laut mehr über ihre Lippen. Er machte sich los und ging mit raschen Schritten davon. Als er nach einer Weile zurückschaute, stand Seph’ noch unter dre Thür. Langsam schritt er weiter,. Bei der Wendung der Straße blieb er wieder stehen. Sepha stand noch immer auf dem gleichen Fleck.
„Geh’, Seph’,“ rief er ihr zu, „geh’ doch hinein!“
Da wandte sie sich und verschwand in der Thür.
Aufathmend schritt er dem Markt entgegen. Einige Leute sprachen ihn an, aber er nickte nur einen Gruß und ging vorüber. Bald erreichte er das Kloster. Die Wartestube des Vogtes war überfüllt. Eben schob Herr Schluttemann zur Thür ein altes Bäuerlein hinaus, das unter stotterndem Danke einen Bückling um den anderen machte.
„Ja, Mannerl, ja, ist schon gut!“ sagte der Vogt. „Und wenn Du wieder was brauchst, nachher komm’ nur gleich, gelt?“ Da sah und erkannte er den Sudmann. „Ja, grundgütiger Herrgott, ja, seh’ ich denn recht? Wolfrat, Du? Ja komm’ doch! So komm’ doch gleich herein zu mir!“. Er packte ihn bei der Hand und zog ihn hinter sich her in die Stube.
Wolfrat riß Mund und Augen auf und starrte Herrn Schluttemann an wie ein heiliges Wunder. Eh’ er noch wußte, wie ihm geschah, saß er schon in einem Lehnstuhl, und vor ihm hockte Herr Schluttemann mit schlenkernden Beinen auf dem Tisch. Lachend und immer die Hände reibend, haspelte der Vogt ein Dutzend Fragen herunter, ohne die Antwort auf eine einzige abzuwarten. Erschrocken hielt er inne, als sich Wolfrat plötzlich aufrichtete mit aschfahlem Gesicht.
„Ja was hast denn, Wolfrat, was hast denn?“
„Reden muß ich was! Für’s erst’ aber will ich noch ein Vergelt’s Gott sagen für alles, was man an meinem Weib und Kind gethan hat, und ... und nachher ... nachher will ich sagen ...
„Was denn? Was denn? Was denn?“
„Von wegen dem Jäger ... dem Haymo ... derselbig’, der ihn gestochen hat ... ich bin’s halt doch gewesen!“
Herr Schluttemann verlor alle Fassung. „Ja, Du Mensch, Du,“ stotterte er, „aber das ist ja doch gar nicht möglich!“
„Wohl wohl, ich bin’s gewesen!“
Der Vogt starrte den Sudmann an, griff sich an den Kopf und mit einem Mal rannte er davon, hinein in die Stube des Propstes. Herr Heinrich erhob sich von seinem Schreibpult; die Thüre blieb offen stehen, und Wolfrat konnte jedes Wort vernehmen.
„Reverendissime! Denket! Jetzt kommt dieser Wolfrat und giebt sich an und sagt, daß er es doch gewesen ist, der den Haymo gestochen hat.“
„Der Wolfrat?“ fragte Herr Heinrich ganz erstaunt und schüttelte den Kopf.
„Ja, der Wolfrat! Ich hab’ auch den Kopf geschüttelt! Aber der Mann ist da und sagt, er hat’s gethan!“
„Der Haymo hat aber für ihn gezeugt, und ein Jäger hat gute Augen!“
„Vielleicht hat er ein Erbarmen gehabt ...“
„Der Haymo lügt nicht. Ja, ja, Vogt, Ihr habt dem Mann damals unrecht gethan!“
„Aber meiner Seel’,“ stotterte Herr Schluttemann, „er steht doch draußeu und sagt, er hat’s gethan!“
„Das ist mir unbegreiflich! Aber wißt Ihr, was ich meine! Der Mann trägt es Euch nach, daß Ihr ihm unrecht gethan habt! Jetzt will er Euch den Streich heimzahlen und kommt und spielt Euch einen Possen und bindet Euch einen Bären auf ... zur Heimzahlung für den, der über ihn gekommen ist!“
„Ja, da soll ihn doch gleich ...“ Herr Schluttemann zog mit der Faust aus, um der Tischplatte eins zu versetzen; aber er besann sich noch zur rechten Zeit.
„Ich muß gestehen, das ist ein keckes Stücklein. Der Mann geht zu weit. Das greift hart an Eure Würde, Vogt! Das dürft Ihr Euch nicht gefallen lassen!“
„Und ich laß’ es mir auch nicht gefallen! Da soll ja doch ...“ [564] Herr Schluttemann stürmte mit puterrothem Gesicht hinaus in die Amtsstube. Er war seit Monaten zum ersten Male wieder in hellem Zorn.
Wolfrat stand mit rathlosen Augen, zitternd am ganzen Leib, mit jedem Athemzug die Farbe wechselnd.
Herr Schluttemann hielt ihm die Fäuste unter die Nase und schrie. „Gelt? Jetzt steigt Dir das Grausen auf! Wart, Du Gauner, Du schwollkopfiger, Dir will ich die Späßlein noch austreiben! Du sag’ mir noch einmal, daß Du’s gewesen bist! Gelt, jetzt verschlagt’s Dir die Red’? Wart’ nur! wart’! Den Vogt uzen! Wart’ nur!“ Herr Schluttemann stürzte auf die Wand zu und riß am Glockenstrang; ein Fronbot trat in die Stube. „Pack’ den Kerl! Marsch in den Block mit ihm! Und nur fest hinein!“
Der Fronbot faßte den Sudmann, der wie ein Trunkener zur Thür schwankte.
Herr Schluttemann that einen Pfiff, und als der Fronbot zurückkam, flüsterte er ihm zu: „Aber gieb mir ein lützel acht auf seinen lahmen Arm!“
Der Fronbot nickte und packte den Sudmann wieder beim Kragen. Ein Viertelstündlein später saß Wolfrat im Fronhof des Klosters auf der Erde, mit Arm und Füßen im Block gefesselt. Warm schien die Sonne auf ihn nieder. Einige Sperlinge kamen herbeigeflattert, guckten ihn mit schief gehaltenen Köpfchen neugierig an und flogen wieder auf das Dach. Aus dem offenen Fenster einer hochliegenden Zelle klang das sanfte Spiel einer kleinen Orgel.
Stunde um Stunde verging. Wolfrat rührte sich nicht; wohl brannten die Knöchel, und der Rücken schmerzte . . . aber er saß wie ein Träumender, und aus seinen glänzenden Augen rann Thräne um Thräne.
Als die Glocke zu Mittag läutete, kam Frater Severin mit eiller Holzbitsche und hielt sie an Wolfrats Lippen. „Da, trink!“
In langen Zügen schlürfte der Sudmann den Wein, bis ihm der Frater die Bitsche weg nahm mit den Worten: „Halt’ aus ein lützel, mußt ja nicht alles auf einmal schlucken! Sonst kriegst am End’ noch einen Rausch.“ Er stellte die Bitsche auf die Erde, stemmte die Fäuste in die Hüften und schnaufte. Wahrlich, Frater Severin hatte in all diesen Monaten sein Möglichstes gethan, um das „vollgedrückte Maß“, das ihm der Schöpfer gegeben, in unversehrter Fülle zu erhalten. Die paar Pfündlein, die er auf den Bergfahrten verloren, hatte er reichlich wieder zugesetzt.
„Viel Schweiß hat’s freilich gekostet . . . ui jei!“ sagte er, während er mit Wolfrat ein höchst einseitiges Gespräch führte, denn Frater Severin sprach allein und Wolfrat schwieg. „Aber schön ist’s da droben doch allweil gewesen! . . . Jetzt hat’s aber wohl ein End’ mit dem Bergsteigen. Weißt, jetzt muß ich Tag um Tag in der Küch’ stehen. Mit dem Frater Küchenmeister will’s gar nimmer recht vom Fleck. In der Hitz’ geht halt der Mensch auch auseinander wie der Teig in der Pfann’ . . . was kannst da machen! Er muß sich gar jämmerlich plagen mit dem Schnaufen. Und die Schneeros’ will ihm auch schon nimmer helfen! Ein Kreuz, ein rechtes Kreuz!“ Seufzend hob er die Bitsche von der Erde. „So, schluck’ nur wieder ein lützel!“
Wolfrat trank, und als die Kanne geleert war, ging Frater Severin davon. „Auf den Abend komm’ ich schon wieder!“
Aber er hatte da ein Versprechen gegeben, das er nicht halten konnte. Denn als die Sonne von den Dächern geschwunden war, als es zwischen den hohen Mauern des Fronhofes schon zu dämmern begann und Wolfrat einmal aufblickte aus seinem Träumen und Sinnen, stand Herr Heinrich vor ihm.
„Nun? Wird’s Dir schon bald zu lang?“
Wolfrat schüttelte den Kopf. „Ach, lieber, guter Herr, ich sitz’ ja gern, bis ich umfall’. Das ist ja doch gar keine Straf’!“
„So? Meinst Du?“ Herr Heinrich setzte sich auf den Block. Dann muß ich halt raiten mit Dir. Hast Du nicht Sünde mit Reue, Blut mit Blut bezahlt? Hast Du für das Leben, das Du dem Jäger nehmen wolltest, nicht Dein eigenes Leben schier hingeben müssen? Hat Dich nicht einer, der klüger ist als alle Richter der Welt, ein halb Jahr lang in den Block gelegt? Und trägst Du nicht ein Merkzeichen davon für Deine Lebzeit? Und den Steinbock, den hast Du wohl theuer genug erkauft ... mit dem letzten Blick Deines Kindes. Hätt’ ich Dich härter strafen können?“
Wolfrat ließ den Kopf sinken, und ein dumpfes Schluchzen erschütterte seine Brust.
„Schau, alles, was bös ist, straft sich selber! Noch keiner hat, wo er Böses gesät, eine volle Aehre geschnitten. Einen wachsenden Kern hat nur das Gute . . . man muß nur nicht allweil gleich die eigene Scheuer damit füllen wollen, muß auch säen können, wo andere ernten!“
„Wohl wohl, Herr, das muß heilig wahr sein. Was wär’ denn jetzt mit mir, wenn’s nicht gute Leut’ auf der Welt gäb’!“
„Ja, Wolfrat, das sag’ Dir nur allweil und allweil, dann wirst Du auch nimmer vergessen, daß man zusammenhalten muß und gut sein mit den anderen, hart nur gegen sich selber. Ich mein’, Du hast es doch gespürt, wie schwer und finster das Leben ist, und wie es über einem oft liegen kann, als wär’s ein ganzer Berg. Wenn Du so einem begegnest, der schwer zu tragen hat, dann mußt halt auch flink zuspringen . . . wirf nicht noch einen Stein drauf, sondern hilf ihm tragen! Wirst sehen, Ihr kommt dann allbeid’ zu einem sonnigen Fleckl, wo man rasten und ausschnaufen kann für den weiteren Weg.“
„Wohl wohl, Herr,“ sagte Wolfrat, mit feuchten Augen zu Herrn Heinrich aufblickend. „Aber wie soll denn ich noch was helfen können in der Welt . . . ungrade Finger greifen schlecht.“
„Nützen und zum guten helfen kann einer auch mit halben Armen. Wenn nur ein ganzes Herz dabei ist! Und schaffen wirst auch noch können für Weib und Kind. Man muß halt ein richtiges Geschäftl suchen für Dich.“
„Vergelt’s Gott, Herr, vergelt’s Gott!“ stammelte Wolfrat. „Schauet, da hab’ ich halt gemeint . . . einen Schlepper im Salzberg thät’ ich allweil noch abgeben.“
„So? Hast denn schon einmal im Berg gefördert?“
Der Sudmann schüttelte den Kopf.
„Da wird’s schwer halten! Alles will gelernt sein. Ich mein’, Du wirst im Sudhaus bleiben müssen. Mit dem Feuern und Suden hat’s wohl ein End’, aber Ausschau halten und in die Pfannen lugen und Kerbschneiden[2] wirst allweil noch können. Verdienst ja auch ein lützel mehr dabei. Der alte Rottmann[3] will sich zur Ruh’ setzen . . . was der gehabt hat, wirst ja wissen. Und jetzt komm ... steh’ auf!“
Herr Heinrich erhob sich und öffnete den Block. Wolfrat aber blieb sitzen und rührte sich nicht; er starrte nur immer den Propst an und würgte nach Worten. Herr Heinrich mußte ihn am Arm fassen und aufrichten.
„Geh’ nur, Wolfrat, geh’! Deine Seph’ wartet daheim; sie wird sich ängstigen, wenn Du so lange bleibst. Streck’ Dich . . . und geh’ heim!“
Wolfrat stand mit gebeugtem Rücken; das Sitzen im Block hatte ihn ganz steif gemacht; aber das schien er nicht zu fühlen.
„Heim? Heim?“ stotterte er mit halb erstickten Lauten. „Ja, wo bin ich denn daheim? Jetzt saget nur gleich: im Himmnel . . . und ich glaub’s auch!“
„Später einmal!“ lächelte Herr Heinrich. „Für jetzt noch in Deinem Lehen. Wo denn sonst? Nun aber geh’ und behüt’ Dich Gott!“ Er führte den Wankenden zum Thor und schob ihn auf die Straße.
Ein paar Schritte taumelte Wolfrat vorwärts. Als er hinter sich das Thor ins Schloß fallen hörte, stammelte er erschrocken: „Jesus Maria! Ich hab’ ja ganz vergessen ...“ Er stürzte zurück und schlug mit der Faust an die Bohlen. „Herr, Herr! Lasset mich doch hinein . . . lasset mich doch ein Vergelt’s Gott sagen ...“
„Dank’ einem anderen!“ klang die Stimme des Propstes, während seine Schritte sich entfernten.
Wie ein Berauschter schwankte Wolfrat auf die Straße und starrte in der Dämmerung umher, als wär’ es eine neue Welt, die ihn umgab. Da sah er die Mauer des Friedhofs und hinter ihr die steinernen Kreuze ragen. Aufschluchzend stürzte er hinzu und fand auch hier ein geschlossenes Thor. Am eisernen Gitter sank er nieder und streckte den einen Arm durch die Stäbe, als könnte er hineingreifen bis zum Grab seines Kindes.
[565] Auf dem Thurm begann die Glocke zu läuten. Sanft hallend schwebten ihre Klänge über das weite Thal, zu Ruh’ und Frieden mahnend. Wolfrat bekreuzte sich und murmelte, immer von Schluchzen unterbrochen, den Mariengruß. Dann sprang er auf und stürzte davon. Keuchend erreichte er sein Lehen. In der Stube brannte schon ein Licht. Unter der Thür trat ihm sein Weib entgegen.
„Seph’! Seph’!“
Mehr brachte er nicht heraus. Er wankte, und sie mußte ihn stützen. Als er in die Stube trat, streckte er die Hand, als ob er mit einem einzigen Griff alles erfassen möchte, was ihn umgab. Sie ließ ihn auf die Bank sinken, und da saßen sie nun und hielten sich wortlos umschlungen, bis von draußen ein aufgeregtes Stimmlein tönte:
„Mutterl! Mutterl! All’ beid’ sind hinein in Stall . . . ganz alleinig!“
Wie eine Hummel kam Lippele in die Stube gesurrt und stand erschrocken stille.
„Ja Bürscherl,“ fragte Wolfrat mit schwankender Stimme, „kennst mich denn nimmer?“
„Jegerl, der Vater, der Vater!“ schrie der Bub’ in heller Freude, kletterte auf Wolfrats Knie und drückte und küßte ihn, daß ihnen beiden fast der Athem verging.
„Aber Seph’! Wo ist denn die Dirn’?“
„Ich weiß nicht, was mit der sein muß! Jetzt hat man sie wieder im Klösterl gehalten. Und die ganze Zeit her ...“
Aber Sepha konnte nicht weiter sprechen. Denn Lippele
drückte ihr die Hand auf den Mund und gebot: „Sei still,
Mutterl, ich muß dem Vater was zeigen!“ Und von Wolfrats
Knien auf die Erde niederrutschend, schrie das Büblein mit
brennendem Gesicht: „Schau’, Vater, schau’, was ich schon kann!“
Im Hui hatte der kleine Kerl das Jöpplein heruntergerissen; er warf es zu Boden, duckte sich ... und schwupp, stand er kerzengerade auf dem Kopf. Freilich plumpste er gleich wieder auf die Seite, aber das that dem Stolz keinen Eintrag, mit dem er sich erhob.
„Und das hast im Klösterl gelernt?“ staunte Wolfrat.
„Wohl wohl, aber nit von den Klosterfrauen!“
Seph’ und Wolfrat sahen sich an und mußten hellauf lachen ...
Wie lange, lange war es her, seit in dieser Stube das letzte Lachen verhallt war!
Am anderen Morgen, zu früher Stunde schon, verließ Pater Desertus das Stift und ging mit eilenden Schritten dem Klösterlein der frommen Schwestern zu.
Einige Stunden später wanderte Herr Heinrich nach dem See. Als er am Eggehof vorüber kam, sah er beim Hag, der das Gehöft vom Polzerlehen trennte, den Eggebauer mit Wolfrat beisammenstehen; der Bauer ließ den Kopf hängen, Wolfrat aber hatte ihm den Einarm auf die Schulter gelegt und schien dem Bekümmerten mit herzlichen Worten zuzusprechen.
Mit sinnendem Lächeln schritt Herr Heinrich dahin unter dem welkenden Laubdach der die Straße geleitenden Bäume. „Wieder einer, der im Schatten die Sonne fand! Freilich, nur einer! Aber laß ein einzig’ Tröpflein in den See fallen, es zieht doch immer seine Wellen und rühret hundert andere!“
Nach einer Stunde erreichte Herr Heinrich die Seelände. Die beiden Fischerknechte, welche mit dem Spannen der feuchten Netze beschäftigt waren, zogen die Kappen und traten ihm entgegen.
„Habt Ihr den Jäger nicht herkommen sehen über den Steig?“
„Den Haymo? Nein, Herr!“
„Dann habet eine Weil acht, er muß wohl kommen! Doch braucht Ihr ihm nicht zu sagen, daß ich nach ihm fragte. [566] Saget ihm nur: wenn er mich etwa sprechen wollte, dann fänd’ er mich beim neuen Haus.“
Herr Heinrich ging, und die Knechte glotzten ihm nach. Es währte nicht lange, so hörte man auf dem Steig ein Griesbeil klirren und klappernde Schritte näher kommen.
Haymo tauchte unter den Bäumen auf. Sein Gang war langsam und müde; das Antlitz sah verkümmert aus, obwohl es geröthet war; denn er hatte schwer getragen; die Armbrust war um seinen Hals gehängt und der Rücken mit einem vollgestopften Bergsack beladen.
„Was tragst denn da?“ fragte einer der Knechte.
„Mein Sach’!“ erwiderte Haymo mit zuckenden Lippen.
„Ja, was ist denn? Es liegt doch allweil noch kein Schnee droben? Ziehst denn schon ab von der Röth’?“
„Wohl wohl,“ murmelte der Jäger.
„Mußt vielleicht in ein anderes Revier? Auf den Roint oder auf den Griesberg hinauf?“
Haymo schüttelte den Kopf und starrte vor sich nieder.
„Wo willst denn hin jetzt?“
„Ins Kloster hinein zum Herrn.“
„Den kannst näher haben. Grad’ ist er zum neuen Haus hinaufgegangen.“
„Zum neuen Haus?“ Haymo schaute mit verlorenen Blicken auf und that einen schweren Athemzug. „Kann ich bei Euch derweil meinen Sack einstellen?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er in die Fischerhütte, legte den Bergsack in die Stube, nickte den Knechten einen Gruß zu und folgte der Straße.
Das „neue Haus“ war ja leicht zu finden. Ueber die goldig schimmernden Baumwipfel leuchtete das weiße Dach herüber mit dem bändergeschmückten Tannenbäumchen. Als sich Haymo mit zögernden Schritten dem Thor näherte, das den frisch geflochtenen Hag durchbrach, blieb er plötzlich stehen wie von freudigem Schreck betroffen. Es war ihm, als hätte er aus einem der offenen Fenster ein klingendes Lachen gehört. Er lauschte . . . aber alles blieb still. Ein bitteres Lächeln zuckte um seine Lippen. War ihm das in all diesen langen bangen Wochen nicht zu hundertmalen geschehen? Wenn er durch den stillen Bergwald gestiegen oder hinweggegangen war über ödes Gestein, versunken in seine träumende Sehnsucht, dann hatte er mit einem Mal diese süße, klingende Stimme gehört, bald wie aus weiter Ferne, bald wieder, als wäre sie dicht an seinem Ohr. Doch hatte er sich, mit stockendem Herzschlage jählings umgewandt, so waren rings um ihn nur die leeren Lüfte gewesen, die stillen Bäume und das schweigende Gestein. und wenn er in dunkler Nacht auf der Wolfshaut lag, vor Ermüdung fiebernd an allen Gliedern . . . wenn nach martervollem Sinnen und Grübeln der Schlaf ihm die Lider schwer machte, daß sie sanken, dann klang es plötzlich hell und weckend in seinen Schlummer. „Haymoli!“ Er fuhr in die Höhe, strich die zitternde Hand über die Stirn und lauschte . . . und fand sich allein, umgeben von tiefer Finsterniß, und nur seine Seufzer klangen in der stillen Hütte.
„Es geht mir halt überall nach!“ murmelte er, während er mit irren Blicken das stattliche Haus überflog.
Zögernd betrat er den Hofraum und erbleichte, als er einer alten Ulme zu Füßen, auf einem moosigen Steinblock, Herrn Heinrich sitzen sah.
„Haymo? Du?“
Der Jäger zog die Kappe, und während er sie zwischen den Händen zerknüllte, trat er mit gesenktem Kopfe näher.
„Grüß Gott, Herr!“
„Wie kommst Du da her? Was hat Dich ins Thal geführt?“
„Herr!“ Die Stimme des Jägers schwankte. „Heut’ ist der Michelstag.“
„Der Michelstag?“ sagte Herr Heinrich ganz erstaunt. „Richtig, der Michelstag! So, so! Der Michelstag? Und deshalb kommst Du herunter?“
„Wohl wohl! Ich hätt’ ja nimmer bleiben dürfen . . . auch wenn ich mögen hätt’.“ Immer leiser wurde Haymos Stimme. „Heut’ geht ja mein Dienst aus!“
„Richtig, richtig! Von heut’ an hab’ ich einen Klosterjäger weniger . . . den besten. Und jetzt bist gekommen und willst mir ‚Behüt’ Gott‘ sagen, gelt? Und dann willst Dir einen neuen Herrn suchen?“
Haymo knüllte an der Kappe, verdrehte den Kopf, als quäle ihn ein Krampf im Nacken, und zog die Brauen zusammen wie einer, der auf der Folter liegt und doch keinen Schmerzenslaut will hören lassen.
„So red’ doch, Haymo, schau’ mich an!“
Aber nur noch tiefer senkte Haymo den Kopf, während er mit heiserer Stimme Wort um Wort vor sich hin stieß. „Ich bitt’, Herr, daß Ihr es kurz machet. Wenn’s mich auch gleich nimmer fort lassen will . . . von Euch . . . fort muß ich halt doch.“
„Mußt Du? So? Und was willst Du jetzt . . .?“
„Was ich halt wollen muß – ein einzigs halt! Gerad’ noch ein einzigs im Leben . . . und allweil das einzig’ . . . und ich weiß doch kein Straßl nimmer, wo ich’s find’. Ich hab’ mich halt verschuldigt, und jetzt muß ich’s büßen. Und wenn ich gleich einmal noch hinlauf’ an mein Glück ... es bleibt halt doch allweil nur ein halbet’s.“ Er wandte sich ab, weil er spürte, daß ihm die Augen übergingen.
„Haymo!“
Der Jäger erzitterte bei dem warmen, herzlichen Klang seines Namens.
„Hab’ ich recht gehört? Du möchtest gern bleiben bei mir?“
Haymo sagte nicht Ja und nickte nicht mit dem Kopf; er wandte sich nur noch mehr von Herrn Heinrich ab und drückte das Kinn auf die Brust.
Der Propst betrachtete ihn eine Weile mit leisem Lächeln. „Also bleiben möchtest Du? Schau, Haymo, das merk’ ich gern, daß ich Dir lieb geworden bin als Herr. Schade! Warum hast Du nicht früher gesprochen! Denn jetzt . . . jetzt wird es wohl zu spät sein. Heut’ ist der Michelstag, Du bist nicht mehr mein Klosterjäger.“
Jetzt nickte Haymo, und ein schwerer Athemzug erschütterte seine Brust.
Immer fröhlicher lächelte Herr Heinrich. „Wer weiß ... wir zwei hätten vielleicht noch können auf gleich kommen miteinander.“
Haymos trübe Augen streiften den Propst mit einem scheuen Blick.
„Pater Desertus hat im letzten Kapitel einen Antrag gestellt, und der ist durchgegangen. Das Kloster hat einen Wildmeister ernannt, von heut’ an. Der soll über die ganze Jägerei des Klosters gesetzt sein. Er ist ein weidgerechter und strenger Jäger; wie ich ihn kenne, wird er seine Leute fest an der Schnur halten. Und mit einem, der aus Muthwill’ oder Narretei seinen Dienst aufsagt, mit solch einem wird er sich schwer befreunden! Meinst nicht auch? . . . Was hast denn? Schaust Dir das Haus dort an? Ein schmuckes Haus, gelt? In dem soll der neue Wildmeister wohnen. Ueber vier Wochen hält er Hochzeit. Schau, Haymo, dort unter der Thür . . . das ist sein Bräutlein.“
Haymo, dem die Kappe entfallen war, stand mit zitternden Händen und wankenden Knien. Jetzt erblassend, dann wieder die Wangen überflogen von brennendem Roth, riß er Mund und Augen auf und starrte nach der Thür, aus welcher Pater Desertus trat, Gittli an seiner Hand. Wie hold und schmuck war das Mädchen anzusehen! Ein rothes Röcklein umfloß in weichen Falten ihre schlanke Gestalt, aber es war nicht kurz geschnitten nach Bauernart, sondern reichte, wie bei einem Fräulein, bis auf die Fußspitzen; schneeweißes Linnen umbauschte die Schultern und Arme, und knapp spannte sich ein dunkelgrünes, mit silbernen Kettlein verschnürtes Mieder um den zarten Leib. Ihre Augen leuchteten in heißer Erregung, wie glühende Rosen lag es auf ihren Wangen, und gleich einem schwarzen Krönlein schmückten die straff geflochtenen Zöpfe ihre Stirn.
Haymo lallte unverständliche Worte. Aber da hatte ihn Gittli schon erblickt und kam auf ihn zugeflogen mit frendigem Aufschrei. Stammelnd und schluchzend hing sie an seinem Hals, während Haymo, den das über ihn herstürzende Glück um alle Besinnung brachte, noch immer mit den Händen ins Leere tappte. Gittli nahm sich nicht einmal Zeit zu einem Kuß. In zitternder Hast iöste sie sich wieder von Haymos Brust, und mit der einen Hand seinen Arm umfassend, griff sie mit der anderen nach der Hand des Paters.
„Gelt, Herr Pater, gelt, ja Ich darf ihm schon gleich alles zeigen?“
Pater Desertus nickte ihr zu mit leuchtenden Augen, und da zog sie den Stammelnden mit sich fort, lachend in Thränen, unter sprudelnden Worten: „So schau doch, Haymoli, schau! Was sagst! Schau Dir das schöne Haus nur an! Gelt, da schaust! Ja, Du ... da sollen wir hausen allbeid’ miteinander, hat der gute, liebe Pater gesagt. Und schau nur, das steinerne Bankl [567] vor der Thür … weißt, da können wir allweil sitzen und Haimgart halten auf den Abend, hat der Pater gesagt. Und er selber wird auch manchmal kommen, hat er gesagt! Du, wie der uns mögen thut, ich sag’ Dir’s, ein Vater kann seine Kinder nicht lieber haben! Und schau, Haymo, schau, in das leere Nischerl über der Thür’, da kommt ein Muttergottesbildl hinein … das thut unser Haus hüten und unser Glück! So schau nur grad’, das Anwesen da drüben, das hast ja noch gar nicht gesehen … da kommen zwei Pferd’ hinein, und vier Küh’, weißt, daß wir allweil Milch haben, grad’ was wir brauchen. Und Du …“ Sie schlug die Hände ineinander, und ihre Augen gingen über vor hellem Entzücken, „das Kucherl muß ich Dir zeigen! Ich sag’ Dir, da glänzet nur alles vor lauter Kupferzeug! Und ein Schafferl um das ander’! Und Häferln und Pfannen und Schüsserln! So komm’ doch, Haymoli, komm’ doch …“
Mit beiden Händen faßte sie seinen Arm und zog ihn zur Thür hinein.
Im dämmerigen Flur stand er still, preßte die Fäuste auf die Brust und athmete, athmete …
Noch immer begriff er nicht! Aber eines schien er doch endlich zu glauben: daß wirklich und leibhaftig sein geliebtes Mädchen vor ihm stand. Und plötzlich umschlang er sie unter heißen Küssen …
Draußen standen der Propst und Pater Desertus.
„Komm’, Dietwald,“ sagte Herr Heinrich lachend. „Das warten wir nicht ab, bis es ein Ende nimmt. Komm’, laß uns gehen! Sie sollen diesen Tag für sich allein haben. Wenn sie so weit aus ihrem seligen Rausch erwachen, um nach einem Dritten fragen zu können, dann suchen sie Dich schon.“
Noch lange hing Pater Desertus mit den Augen an der Thür, bis er sich loszureißen vermochte, um dem Propst zu folgen. Zwischen goldig leuchtenden Hecken schritten sie der Straße zu. Weiß glänzte ihnen im Sonnenschein der See entgegen.
Pater Desertus legte die Hand auf Herrn Heinrichs Arm.
„Ich will Euch ein Räthsel zu lösen geben! … Was ist wärmer als diese Sonne, lichter als dieser Tag, reiner als dieser klare See?“
„Deines Kindes Glück … und Deines Herzens Freude! Ja, Dietwald, Du hast recht gethan. Ich habe Dir meinen Rath nicht aufgedrängt. Hier mußte Dein eigenes Herz die richtige Straße finden, ganz allein. Und Du hast sie gefunden!“
„Hätt’ ich mich besinnen sollen? Nur einen Augenblick? Was wollt’ ich denn mehr als meines Kindes Glück? Jeder andere Weg hätte ihr nur Weh und Elend gebracht, hätte ihr Leben zerstört und alle Blüthen abgestreift von ihrem holden Dasein … und kein Rang und Name, nicht Glanz und Reichthum hätte sie dafür entschädigt. Ist denn das Leben noch Leben, wenn ihm die Sonne fehlt, das Glück? Hätte mich in jener finsteren Nacht, die mir alles nahm, das Schicksal vor die Wahl gestellt: willst Du bleiben, was Du bist, oder willst Du ein Bettler werden und nur das Glück Deines Herzens mit hinüber tragen in die arme Hütte … glaubt Ihr, ich hätte mich besonnen? Und hätt’ ich nun anders wählen sollen für mein Kind? Was sie um ihres Glückes willen verliert … entbehrt sie es denn? Würde sie den Geliebten ihrer Liebe werther halten, wenn er den Schild am Arm und die Helmzier über den Locken trüge? Und ich?“ Pater Desertus schüttelte lächelnd das Haupt. „Haymo ist ein freier Mann, und verwahrt er auch keinen Adelsbrief in seinem Schrank … er trägt auf seiner Stirn den Adel tüchtiger Mannheit und eines treuen, redlichen Gemüths. Ich lieb’ ihn … er ist mein Sohn!“
„Und väterlich hast Du für ihn gesorgt!“ lachte Herr Heinrich. „Wär’ der Propst von Berchtesgaden nicht Dein guter Freund und hätt’ er nicht selber seine helle Freude an diesem jungen Glück … er hätte böse Augen gemacht zu dem tiefen Griff, den Du in den Klostersäckel gethan. Und ich vermuthe, es war noch lange nicht der letzte! Aber sag’ …“ Die Stimme des Propstes wurde ernst, „Du hast auch heute nicht mit ihr gesprochen?“
„Nein, Herr … ich konnte nicht!“
„Und das Dirnlein hat genommen und genommen? Und mit keinem Gedanken ist es ihr aufgefallen: woher kommt das alles?“
„Wäre ihr Glück denn voll und ganz, wenn sie fragen könnte, warum?“
Herr Heinrich nickte, und schweigend schritten sie weiter. Immer wieder blickte Pater Desertus zurück nach dem zwischen schimmerndem Laub verschwindenden Dache.
„Oft lag mir das klärende Wort auf der Zunge,“ sagte er nach einer Weile, „aber wenn ich sah, wie dieses große kleine Herzlein so übervoll war von Liebe, dann schwieg ich wieder. Hätt’ ich sie schrecken und betäuben sollen mit Neuem, Unerwartetem? Jetzt? Kommt sie in ihrem Glück erst wieder zu Athem, dann wird sich von selbst die Stunde finden, in der sie mich als Vater erkennen und Vater nennen wird. Es dürstet wohl mein Herz nach dem süßen Laut von meines Kindes Lippen. Und doch … ich will mich gern gedulden. Vaterliebe, das heißt ja nicht ‚nehmen‘ … sondern ,geben‘. Und bin ich denn nicht schon reich geworden nach aller Armuth meines Herzens? Tag und Nacht darf ich sinnen und schaffen für meines Kindes Glück, an seiner Freude darf ich mitgenießen, darf mich erquickt und getröstet fühlen durch seine traute Nähe.“ Pater Desertus blieb stehen und faßte den Arm des Propstes. „Seht, Herr, wie freundlich das Heim meines Kindes herschimmert durch die Bäume.“
„Ein schönes Plätzchen! Komm, wir wollen rasten!“
Aus dem Fuß eines Hügels, welcher dicht an die Straße reichte, schob sich eine Felsplatte gleich einer Bank hervor. Hier ließen sie sich nieder. Kleine Schatten und Lichter zitterten auf der Erde, denn durch die halbentlaubten Bäume fand die Sonne fast freien Weg. Ein leichter Windhauch raschelte durch alles Gezweig, und langsam, wie in gaukelndem Spiel, fielen die welken Blätter; mit stillen Augen betrachtete Pater Desertus ihren lautlosen Fall.
Herr Heinrich fragte lächelnd: „Stimmt es Dich trübe, daß die Blätter fallen?“
„Nein, Herr, der Winter kommt ja nur, um den Frühling zu bringen!“
„So? Es gab aber doch eine Zeit, da Du sagtest: Der Sommer blüht nur, damit all seine Bluht vom Winter verschüttet werde unter Schnee und Eis!“
In bebender Erregung preßte Pater Desertus die Hände auf seine tiefathmende Brust. „Mein Auge ist sehend worden. Ich fühle ja die Sonne wieder, und Schatten um Schatten weicht von mir. Vor dem holden Antlitz meines Kindes löst sich jeder Jammer meines Lebens in süßen Trost, und in Verklärung schweben die Gestalten der Verlorenen um mich her.“
„Ist alles Geschehene denn anders geworden?“ fragte lächelnd Herr Heinrich.
„Nein, Herr, aber ich seh’ es mit anderen Augen. Glaubet mir, so tief wie ich hat noch kein Mensch erfahren, daß wir nicht leben können, wenn wir die Sonne nicht suchen, und daß uns zum Leben so nöthig wie Luft und Brot noch ein Drittes ist: das helle Sehen!“
Eine Thräne rann ihm in den ergrauenden Bart, er faßte die Hände des Propstes und stammelte: „Herr, nehmet meinen Namen von mir! Ich will nicht länger Desertus heißen.“
„So heiße Theophilus!“[4]
Sie saßen schweigend. Ueber Thal und Höhen leuchtete die warme Sonne des Herbstes, und die sinkenden Blätter in ihrem schimmernden Gelb waren anzusehen wie fallende Flämmlein.
Plötzlich streckte der Pater in heller Erregung den Arm. „Sehet, Herr!“
Ein weißer Falter gaukelte vorüber.
„Das ist wohl der letzte!“ sagte Herr Heinrich. „Auch er wird sterben. Aber er war mit der Sonne gut Freund und darf nun einen Tag genießen, den tausend seinesgleichen nicht erlebten!“
Sie blickten dem Falter nach. Er folgte mit seinem Flug dem Lauf der Straße, flatterte um die weißen Steine, hob sich empor zu den Wipfeln der Bäume, gaukelte zurück auf die niedere Hecke, aus deren Gezweig der Wind die silberig blitzenden Spinnfäden wehte, und bald sich verhaltend, bald wieder eilig weiter fliegend, erreichte er die große Wiese vor dem neuen Haus. Hier suchte er jedes verspätete Blümlein auf und sog aus dem welkenden Kelch noch einen Tropfen Seim. Dann flatterte er an der weißen Mauer empor, und lange, lange gaukelte er um das mit Bändern geschmückte Tannenbäumchen auf dem First …
Hand in Hand, mit brennenden Gesichtern, traten Haymo und Gittli aus der Thür.
„Ja wo sind sie denn?“ stammelte Gittli. „Schau nur, Haymo, sie sind ja nimmer da!“
Mit suchenden Augen blickten sie umher. Da näherten sich
[568][569] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [570] langsame Schritte dem Thor, und Ulei der Bildschnitzer betrat das Gehöft. Er trug auf den Armen eine hohe Figur, die von grauer Leinwand umhüllt war.
„Das soll ich abgeben, hat’s geheißen. Es gehört über die Thür hinauf,“ sagte er.
„Das Muttergottesbildl!“ erwiderte Gittli leise.
Ulei stellte die Figur auf die Steinbank und löste mit zitternden Händen das Tuch.
„Schau, Haymo, schau nur! So was Liebes und Schönes! Wie wenn’s lebig wär’ und thät uns anschauen!“
Eine leichte Röthe huschte über Uleis bleiche Züge. Das Lob hatte ihm Freude gemacht. Wortlos wandte er sich ab und verließ das Gehöft. Haymo und Gittli merkten nicht, daß er ging. Sie standen schweigend aneinander gelehnt und betrachteten das mit hellen Farben bemalte Schnitzwerk.
Der Sockel stellte eine graue Wolke dar, umringelt von einer Schlange, auf deren Kopf das Bildniß mit beiden Füßen stand. Ein blaues Kleid verhüllte mit eng gereihten, züchtigen Falten den ganzen Körper; die schlanken Fingerchen hielten einen Lilienstengel, das weiße Gesichtchen mit den blauen Augen war leicht geneigt, und gleich einem Mantel fiel das gelöste Blondhaar um die Schultern. Die Stirn schmückte ein Kränzlein blühender Schneerosen.
„Haymo, schau das Gesichtl an,“ flüsterte Gittli, „merkst denn nicht, wem es gleich schaut?“
Er nickte und stand mit feuchten Augen, in den Anblick des Bildes versunken.
Gittli faltete die Hände und sprach leise ein Gebet.
„Was meinst?“ sagte Haymo. „Wenn ich’s gleich hinaufstellen thät’! Weißt, die hütet unser Haus . . . die schon!“
Er wälzte einen hohen Pflock herbei, und während er das Bildwerk achtsam emporhob in die Mauernische, eilte Gittli davon; sie suchte und suchte, aber sie fand nur welke Blumen. Da sah sie das rankende Immergrün, das sich neben dem Hofthor um den Stamm der alten Ulme spann. Sie brach alle Ranken, und Haymo flocht dieselben um den Sockel des Bildes.
Nun standen sie wieder. Seite an Seite, eines den Arm um den Hals des anderen gelegt und blickten zu dem Bild empor.
„Gelt,“ flüsterte Haymo, „die soll die ersten Blümerln haben all’ Jahr’!“
„Und allweil die schönsten. Und wenn es weihnachten thut, steigen wir miteinander hinauf in die Röth’ . . . und da kann der Schnee gleich haustief liegen . . . wir holen ihr ein Schneerosensträußl herunter, gelt?“
Sie reichten sich die Hände.
Nach einer Weile sagte Haymo, tief aufathmend: „Komm, Schatzl, wir müssen die Herren suchen! Mein Gott, sag’ mir nur, Schatzl, wie sollen denn wir soviel Gutthat heimzahlen köunen?“
„Gelt, ja!“ lispelte Gittli. Eine bessere Antwort wußte sie nicht.
Haymo schloß die Thür und zog den Schlüssel ab. Als sie das Hofthor schon erreicht hatten, fragte Gittli. „Hast auch gut zugesperrt? Hast zweimal umgedreht?“
„Wohl wohl!“
„Geh, schauen wir lieber nochmal hin!“
Sie gingen zur Thür zurück, und eins nach dem anderen rüttelte an der Klinke.
Nun machten sie sich auf den Weg. Beim Hofthor blieben sie noch lange stehen, betrachteten das Haus, und immer wieder kehrten ihre Blicke zu dem Bild über der Thür zurück.
Haymo schüttelte in einem fort den Kopf. Plötzlich zog er das Weidmesser aus der Scheide und drückte die scharfe Spitze in den Rücken seiner Hand.
„Ja was treibst denn?“ stammelte Gittli erschrocken.
„Spüren möcht’ ich, ob ich wach’! Allweil mein’ ich, daß ich träumen thu’ und müßt’ aufwachen mit jedem Augenblick.“
„Geh’, wie Du ein’ aber ängsten kannst!“ stotterte Gittli und klammerte die Arme um seinen Hals.
Er küßte sie ... wieder und wieder; das schien ihn doch endlich zu überzeugen, daß er wache.
Langsam gingen sie zwischen den Hecken dahin. Sie mußten sich dicht aneinander schmiegen, denn der Pfad war schmal. Kein Wörtlein sprachen sie . . . doch immer wieder schauten sie sich lächelnd in die Augen, athmeten tief auf und schritten weiter.
| * | * | |||
| * |
Herr Heinrich hatte wahr prophezeit. Ueber vier Wochen hielt der neue Wildmeister Hochzeit. Pater Theophilus legte die Hände des jungen Paares ineinander; als er den Segen sprach, schwankte vor freudiger Bewegung seine Stimme, daß sie bei jedem Worte zu erlöschen drohte. Gittlis Augen, die zu ihm emporgehoben waren, schimmerten in Thränen. Seit dem vergangenen Abend wußte sie, daß es ihr Vater war, dem sie alles Glück verdankte.
Bis auf das letzte Plätzlein war die Kirche gefüllt. Zuvörderst im Herrenstuhl, neben Herrn Heinrich, kniete der Vogt, in dessen nicht gar feierlichem Antlitz eine merkwürdige Erregung zuckte. Er zwirbelte den dicken Schnauzbart und schielte immer wieder zu Herrn Heinrich auf. Die Hochzeit des Haymo mit der Schwester des Wolfrat hatte ihm ein Lichtlein aufgesteckt.
Als die Trauung vorüber war, wurde das junge Paar von Glückwünschenden umdrängt. Nur Seph’ und Wolfrat fehlten. Weshalb nur waren sie nicht gekommen?
Als einer der Letzten trat Herr Schluttemann vor das Paar. Er machte einen Bückling vor der erröthenden Braut und faßte Haymos Hand. „Also, Herr Wildmeister, viel Glück fürs Leben! Und einen guten Rath will ich Euch auch dazu geben: lügen, Herr Wildmeister, lügen müßt Ihr nimmer!“
„Herr Vogt!“ stotterte Haymo. „Wie meint Ihr das?“
„Schon gut, schon gut! Ich weiß schon, was ich weiß!“
Stolz erhobenen Hauptes stakste Herr Schluttemann davon. Er war wohl auch zum Brautmahl geladen; aber er wollte zuvor noch in der Vogtstube Nachschau halten. Als er das Kloster betrat, klangen von der Kirche herüber die Hörner der Jäger, welche das Brautpaar mit schmetterndem Weidmannsgruß empfingen.
Herr Schluttemann fand in der Wartestube nur wenige Leute vor, die er eilig abfertigte. Schon wollte er die Vogtei verlassen, da kam noch einer mit polternden Tritten herbeigerannt.
„Herr Vogt! Herr Vogt!“
Beim Klang dieser Stimme spitzte Herr Schluttemann die Ohren. „Was? Der traut sich noch herein zu mir? Er runzelte die Brauen und stemmte die Fäuste in die Hüften, als er seine Vermuthung bestätigt sah und den Rottmann Polzer erkannte.
Wolfrat blieb unter der Thür stehen und stützte sich mit dem Arm an den Pfosten, keuchend vom raschen Lauf, das Gesicht von Schweiß und Thränen überronnen, lachend und schluchzend.
„Was ist denn das schon wieder für eine Narretei?“ donnerte Herr Schluttemann. „Will man vielleicht wieder den Vogt uzen? Wart’ nur, jetzt will ich Dir aber zeigen . . .“
Weiter kam Herr Schluttemann nicht, denn Wolfrat, der die Worte des Vogtes gar nicht zu hören schien, schluchzte und lachte. „Herr Vogt! Herr Vogt! Nehmet nur gleich das Leutbuch her . . . und schreibet hinein . . . ich hab’ ein Kindl gekriegt . . . ein Dirnlein, Herr Vogt, ein Dirnlein ... blaue Aeugerln hat’s und bluhweiße Lockerln . . . und Mariele soll’s heißen . . . Polzer Mariele! Schreibet, Herr Vogt, schreibet . . . ich muß zum Pfarrer laufen . . .“
Da rannte er schon davon, lachend, schluchzend und keuchend.
Herr Schluttemann stand noch immer mit gespreizten Beinen, die Fäuste in die Hüften gestemmt. „Natürlich!“ knurrte er. „Nur allweil Kinder, allweil Kinder, daß nur ja die Lugenschüppel nicht minder werden auf der Welt! Aber wart’ nur! Du kommst mir schon wieder! Dann sollst Dir aber merken, daß ich mich nur einmal hab’ anschmieren lassen!“ Er hob die Fäuste gegen die Stubendecke. „Ooooh! Die Menschen sind doch schlechte Leut’!“ Zornig riß er an der Glocke. Der Fronbot trat ein. „Geh’ hinüber in die Küch’ und nachher zum Kellermeister, laß’ Dir einen richtigen Korb voll Freßzeug geben und einen Krug Wein . . . trag alles hinunter zum Rottmann Polzer und sag’: Das schick’ ich ihm zur Kindstauf’ . . . dem Gauner!“
Mit vollen Backen blasend ging Herr Schluttemann auf den Schrank zu, nahm das in Schweinsleder gebundene Leutbuch heraus, schlug es auf, tauchte brummend die Gänsefeder ein und schrieb:
„Den 26. des Anderherbst, a. d. 1338, dem Rottmann Wolfrat Polzer ein Dirnlein geboren, heißt Mariele.“
„Punktum!“ sagte Herr Schluttemann und spritzte die Feder aus.
Durch das offene Fenster klangen jauchzende Stimmen und die schmetternden Klänge der Jagdhörner.
[571]
Alle Rechte vorbehalten.
Der Aetna und sein jüngster Ausbruch.
Vesuv und Aetna sind jedem Schulkind als feuerspeiende Berge bekannt und jedermann weiß, was sie in ihrer Umgebung angerichtet haben oder noch anzurichten imstande sind, bis sie dahin kommen, wohin ihre zahlreichen italienischen Genossen bereits gekommen: zu verlöschen, zu erkalten.
Denn Vesuv und Aetna sind nicht die einzigen Vulkane Italiens, sie sind nur Glieder einer Kette, einer sehr langen Kette, die an der Südgrenze Toskanas beginnt und sich durch Mittelitalien, Unteritalien, Sicilien und die angrenzenden Meere bis nach Afrika hinüberzieht. Am toskanischen Subapennin, im Südwesten von Chiusi, erhebt sich zunächst der Drachytkegel des Monte Amiata, 1721 Meter hoch, somit der höchste Vulkan der italienischen Halbinsel, der, obschon erloschen, als Zeugen seiner in der Tiefe schlummernden Kräfte Gas- und warme Quellen um seinen Fuß her entspringen läßt. Vulkanisch auch ist das Gebiet von hier aus bis zu den Volskerbergen; als bedeutendstes vulkanisches Erhebungscentrum auf dieser Strecke ist der Ringwall zu nennen, welcher den See von Bolsena umschließt; der daran stoßende Montefiascone ist ein echter Krater.
Fortgesetzt wird die Kette dieser Vulkane unterhalb Roms im Albanergebirge, einem drei Stunden weiten Ringwall. Innerhalb dieses Walles steigt 954 Meter hoch der stattliche, geschichtlich berühmte Monte Cavo auf. Die Lavaströme, die von diesem Punkte ausgehen, übertreffen an Länge die aller anderen Vulkane: sie reichen bis fast vor die Thore Roms; einer davon fand sein Ende erst bei dem Grabmal der Cäcilia Metella auf der Via Appia, der andere vor der Porta S. Paolo. An das mittelitalienische Vulkangebiet schließt sich am Garigliano das campanische an: hier steht das Ringgebirge der Rocca Monfina, das einen Flächenraum von 56 Quadratkilometern bedeckt. Auch die der Rocca Monfina gegenüberliegenden Ponza-Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Männiglich bekannt ist das vulkanisch-klassische Gebiet von Campanien, dessen Mittelpunkt der Vesuv bildet, vor dem als Hochwacht der berühmte Kraterberg des Monte Epomeo auf der Insel Ischia, 792 Meter hoch, steht, während in den phlegräischen Gefilden am Golfe von Bajä seine feurigen Vasallen sich scharen: 27 Krater, deren jüngster der erst vor 360 Jahren aus dem Boden gewachaene Monte Nuovo ist.
Das italienische Endglied unserer Vulkankette ist, über die Gruppe der im Feuer gebildeten Liparischen Inseln hinweg – kleine und kleinste Krater und unterseeische vulkanische Erhebungsversuche – der gewaltige Aetna, in dem die unterirdischen titanischen Mächte ihr hervorragendstes Werk vollbracht haben: er ist der höchste Berg Italiens, der größte Vulkan Europas und einer der höchste auf der ganzen Erde. Von allen Seiten frei, so daß ihn das Auge vom Schiffe aus mit einem Blicke erfassen kann, steigt er zu einer Höhe von 3313 Metern auf und zwar auf eigenen Füßen, auf einem Grunde stehend, den er sich durch Aufschüttung seiner eigenen Materialien erbaut hat; denn ein Vulkan ist nicht ein Berg, der Feuer, sondern ein Feuer, das einen Berg ausspeit, wie es bei der Aetnaeruption von 1886 und bei der jüngsten zu sehen war, wo wie von gigantischen Maulwürfen gehoben, neue Kraterberge aufstiegen. Zahllos sind schon die Erhebungen aus alten Zeiten: wie Ameisenhaufen erscheinen uns die Nebenkrater, welche die Seiten des Berges bedecken, darunter über 200 getaufte, d. h. mit Namen bezeichnete.
Der Aetna hat in seiner Riesenhaftigkeit nur einen Nebenbuhler: den Kljutschew auf der Halbinsel Kamtschatka, der 1500 Meter höher ragt als er, während der Vesuv, ein Pygmäe gegen den sicilianischen Genossen, mit seinen 1282 Metern nur wenig über ein Drittel des Aetnamaßes hinaussteigt. So thront auch das k. Observatorium des Aetna mit der „Casa Etnea“ hoch über allen Erdenwohnungen Europas: es liegt 2942 Meter über dem Meere, während das Hospiz des St. Gotthard schon bei 2075 Metern zurückbleibt; das k. Observatorium am Vesuv liegt nur 676 Meter hoch.
Aber die Hänge des Aetna haben eine sehr schwache Neigung, nur 7-8°, der steile, rasch aus dem Meere aufsteigende Vesuv imponiert darum manchem mehr. Die Lavaströme dieses Berges überschreiten nicht 13 Kilometer, die des Aetna erreichen eine Länge von 56 Kilometern und sind oft von gewaltiger Breite und Höhe. Und dann – das Aetnagebiet, wie gewaltig! Es faßt achtmal das Fürstenthnm Liechtenstein und deckt bequem den Boden von Reuß älterer und jüngerer Linie zusammengenommen.
Noch etwas anderes verleiht dem Aetna die Großartigkeit, seinem Wesen eine wirkliche Eigenart: es ist die große Zahl jener schon erwähnten Kegel zweiter und dritter Ordnung, die wir über seine Hänge ausgesäet finden und die nichts anderes sind als erloschene Vulkane, Neben- oder parasitische Krater, seine Kinder, die er in verschiedenen prähistorischen, historischen und allerjüngsten Zeiten und so auch jetzt wieder aus seinem Schoße geboren. Die Entstehung derselben ist ungefähr so zu denken, daß die im Innern des Berges aufsteigende Lava nicht mehr die Kraft hatte, die Höhe des Hauptkraters zu erreichen, und nunmehr einen gewaltigen Druck auf die Wände ihres Kamins, die Flanken des Berges, ausübte, bis diese barsten und um die derart entstandenen Sprenglöcher sich neue Auswurfkegel bildeten.
Verschiedee dieser Nebenkrater sind schon wieder bebaut, viele hat vorläufig der goldblühende Ginster bedeckt; andere liegen entweder oberhalb der kulturfähigen Zone oder sind noch zu neu und darum schwarz und nackt. Es giebt ganz bedeutende Höhen darunter; die bedeutendsten sind auf dem Gebiet von Belpasso und Nicolosi, auf dem sich auch der jüngste Ausbruch vollzog: der Monte Vituri, 1772 Meter über M.; Monte Nero 1778 Meter; Monte Serrapizzuta 1700 Meter, Monte Boccarelle di Fuoco 2033 Meter; Monte Castellazzo 2200 Meter; Monte Montagnola 2842 Meter; dann Monte Nocillo, Monte Nicolo, Monte Peluso, Monte S. Lea; alle finden sich auf der Linie, die vom Hauptkrater im Norden nach Nicolosi im Süden läuft, auf der denn auch die Hauptausbrüche stattgefunden haben.
Das ganze weite Land um den Aetna her, der Campus Aeataeus, dessen ungeheuere Obstfülle schon Ovid preist, ist die fruchtreichste Gegend nicht nur Siciliens, sondern ganz Italiens. Alle Gewächse, welche die gesammte südliche Mittelmeerzone charakterisieren, die köstlichen Südfrüchte in hundert Spielarten, Reben, die den feurigsten Wein liefern, Dattelpalmen, Opuntienkaktus und Agaven, japanische Mispeln, Mandeln, Oliven, Myrten, Feigen- und Johannisbrotbäume, alle gedeihen sie hier auf diesem vulkanischen Boden aufs herrlichste. Alles Land besteht aus Weinbergen und Obstgärten, Weizen- und Baumwollenfeldern.
Bis hoch hinan an den Berg, bis über 1300 Meter zieht sich die „Regione coltivata“, die bebaute Region, der noch alle Fruchtarteu angehören, die aber hauptsächlich von der Rebe [572] erobert ward. 36 000 Hektar des Aetnabodens gehören der Rebe, und immer höher dringt sie in die zerbröckelte Lava und in die Flugasche hinein.
Der Boden ist unerschöpflich, seine Bewohner aber sind zäh und von eisernem Fleiße. Die Aetnabevölkerung wird gegenwärtig auf etwa 330 000 Seelen berechnet, die sich auf neununddreißig Gemeinden in fünfundsechzig Wohnorten vertheilen. Und so giebt es denn in der Welt keinen Berg, um den, im Verhältniß zu seiner Oberfläche, eine so dichte Bevölkerung gefunden wird.
Und sie bleibt trotz der viele Jahrhunderte alten Erfahrungen, die sie mit dem Dämon der Tiefe, der länderfressenden Lava gemacht hat und noch viele Jahrhunderte machen wird.
Die Aetnaausbrüche!
Der erste geschichtlich nachweisbare fand 476 v. Chr., der letzte vom 20. Mai bis 2. Juni des Jahres 1886 statt. In jedem Jahrhundert werden mehrere verzeichnet, so beispielsweise im 14. aus den Jahren 1329, 1333, 1381, dann im 15. aus den Jahren 1408, 1444, 1446, 1447. Von 1447 bis 1536 machte er eine große Pause, um sich zu sammeln; dann öffnete sich die Mittagsseite des Berges, und er gebar zwölf neue Krater, zwölf Ungethüme gleich dem Vater. Der fürchterlichste Ausbruch aber war der vom Jahre 1669. Seine Schrecken sind durch mündliche Ueberlieferung auf das heutige Geschlecht überkommen, seine Spuren werden nach vielen Jahrhunderten noch unverwischt sein. Der vernichtende Lavastrom entsprang dem Boden, auf dem heute die Monti Rossi stehen, er drang in einer Breite von vier Kilometern über die Ortschaften Belpasso, Mascalucia, Gravina, Nicolosi, S. Giovanni di Galermo herein, bis hinab in die Felder und Gärten von Catania, dessen Südwestseite er gänzlich zerstörte.
Ein Frescobild aus demselben Jahre im Dome von Catania versucht, diesen schrecklichsten aller Ausbrüche darzustellen. Die Einwohnerschaft flüchtete.
Die Jahre 1702, 1727, 1732, 1735, 1747, 1755, 1766, 1780, 1783, 1787, 1792 sind wiederum Eruptionsjahre.
Und in unserem Jahrhundert fanden Ausbrüche statt 1811 und 1812, 1832, 1838, 1843, 1852 und 1865, welch letzterer mit sieben Thätigkeitsherden und einem vierzehn Kilometer langen Lavastrom, der fast zehn Millionen Kubikmeter Lavamasse absetzte, auftrat. 1866 bildeten sich sechzehn neue kleine Krater. Der Ausbruch von 1874 hatte nach der Meinung aller Aetnakenner nur den Boden für spätere Eruptionen vorbereitet, und da die von 1879 und die von 1883 auch nicht zur vollen Entwicklung kamen, so mußte Professor Silvestri, der Direktor des Aetnaobservatoriums, als Unglücksprophet auftreten und verkünden, daß die bedeutendere Explosion noch ausstehe.
Diese fand vom 20. Mai bis 2. Juni 1886 statt. Der Auswurf war beträchtlich: in zwei Tagen hatte die Lava 21/2 Quadratkilometer bedeckt, sie rückte gegen 18 Meter in der Stunde vor, überdeckte und zerstörte zahlreiche Wein- und Fruchtgärten; Nicolosi mußte geräumt werden … aber am 4. Juni nachts stand der Strom, kalt, starr, schwarz, mit hochgehobener Stirn, 300 Meter über dem Orte.
Der jetzige Ausbruch ward eingeleitet durch ziemlich heftige Erdstöße, die sich am 9. Juli in den Gemeinden Zaffarana, Nicolosi, Giarre, Mascali bemerkbar machten und die erschreckten Einwohner aus den Häusern trieben. Diese Erdstöße waren jedoch nicht die ersten Anzeichen vom Erwachen des Aetna. Heftige Erdbeben hatten das Vorgebirge Gargano auf der Ostküste der italienischen Halbinsel vom 20. April bis 22. Jubi d. J. heimgesucht und waren dann auf der von hier gerade nach dem Aetna führenden Linie durch Apulien gezogen, wo sie sämmtliche Seismographen (Erschütterungsmesser) der apulischen Observatorien in fortgesetzter Bewegung erhielten, bis sie am 7. Juli mit heftigen Erdstößen zu Canosa am alten Vulkan Vultur für die Halbinsel abschlossen, um auf Sicilien sich fortzusetzen.
[573] Am 9. Juli zählte man von Mitternacht bis 6 Uhr abends elf Erdstöße allein in Catania, und der Hauptkrater des Berges, von den Leuten hier Mongibello genannnt, sandte eine Riesenwolke von Rauch und Asche hoch in den klaren Himmel hinein, die sich blitzend und grollend über Catania herüberwälzte. Der Hauptkrater jedoch hatte wie der zürnende Jupiter nur die Locken geschüttelt, die eigentliche Zerstörungsarbeit überließ er den Titanen zu seinen Füßen. Unter entsetzlichem Donnern und Beben der Erdrinde öffneten sich hinter dem Monte Nero, am Südhange des Berges, nur wenig nördlich von der Ausgangsquelle der Lava von 1886, fünf neue Feuerschlünde, deren Lava in gabelförmig getheiltem Strome sich sofort heftig in der Richtung von Belpasso, Nicolosi und Pedara ergoß. Der westliche Arm überspringt das Thal von Rinazzo, der östliche erreicht bald die Höhe des Monte Albano; beide umgehen die Monti Nero, Gemmelli, Grosso und drohen unterhalb dieser sich zu vereinigen. Vom 9. auf den 10. hat der feurige Strom bereits zehn Kilometer zurückgelegt und befindet sich nur noch 6 Kilometer von Nicolosi. Glücklicherweise fließt dieser Oststrom bald bedeutend langsamer, denn er ist auf die Lavaberge von 1886 gerathen und muß dieses Hinderniß überwinden. Die Bevölkerung von Nicolosi, in höchster Aufregung, ruft in einem Hochamt alle Heiligen an, knieend auf dem Platze vor dem Dome, das Innere aus Furcht vor einem plötzlichen Erdbeben meidend. Das arme gläubige Volk steckt neben den von der Lava am meisten bedrohten Gärten und Weinbergen an langen Stangen Heiligenbilder aus. Schon aber sind die Kastanienwaldungen des Herzogs von Ferrandina niedergebrannt und mehrere Vignen, in denen die Trauben sich schon gefärbt hatten, verwüstet.
Die Feuerschlünde werfen indeß nicht bloß Lava, sondern unter fortgesetztem donnernden Gebrüll, das an das Dröhnen schweren Belagerungsgeschützes erinnert, auch gewaltige schwarze Blöcke, Lapilli, Sand und Asche aus, oft bis zur Höhe von mehreren hundert Metern. Zur Nacht ist das höllische Flammenspiel überwältigend, entsetzlich erhaben. Monte Nero und Monte Grosso erscheinen wie glühend, der Monte Gemmelli schwimmt inmitten eines Feuersees, der Himmel ist wie von blutigem Nordlichtschein bis in den Horizont hinein geröthet. Tausende von Zuschauern aus Catania und den umliegenden Ortschaften säumen die Hänge der ungefährdeten Höhen, erschüttert von der mächtigen Größe der entfesselten Gewalten, denen keine Macht der Erde einen Damm entgegensetzen kann. Die Erde bebt, neue Feuermassen schießen in die Nacht empor, dazwischen knattert’s und knistert’s wie Kleingewehr- und Mitrailleusenfeuer in den Wäldern und Weinbergen, und in den Dörfern fließen die Thränen und packen die so plötzlich Verarmten ihr Bündel. Aengstlich mißt man, meterweise, die Fortschritte der Lava. Heute verlangsamt sie ihren Lauf und die Hoffnung jubelt; morgen aber holt sie das Versäumte nach und die Verzweiflung packt die Herzen aufs neue. ...
Das war das schauerlich erhabene Schauspiel, welches der unheimliche Berg in den heißen Julitagen des Jahres 1892 darbot. Und noch in dem Augenblick, da diese Zeilen zum Drucke gehen, weiß man nicht sicher, welches das Ende sein wird. Wohl schien sich zu Ende des Monats die Kraft des Ausbruchs zu erschöpfen, aber immer noch warfen die Krater von Zeit zu Zeit Steine und Lava aus und vulkanischer Sand- und Aschenregen ging wiederholt bis Catania nieder. Hoffen wir, daß, bis diese Schilderung in die Hände der Leser gelangt, alle Gefahr verschwunden sei und die unglücklichen Bewohner wieder aufathmen können nach den schweren Wochen der Angst und des Schreckens! Woldemar Kaden.
Alle Rechte vorbehalten.
Theodor Billroth.
In wenig Wochen werden es fünfundzwanzig Jahre, daß der Preuße Theodor Billroth die Professur der Chirurgie und die Leitung der altberühmten Klinik des Allgemeinen Krankenhauses in der österreichischen Hauptstadt Wien erhielt und in kürzester Zeit sich die Herzen seiner neuen Landsleute gewann, geehrt durch die Gnade und Gunst seines Kaisers und verehrt von Hoch und Niedrig in den Kronländern der Habsburgischen Monarchie.
Christian Albert Theodor Billroth ist als Sohn eines Predigers auf der Insel Rügen am 26. April 1829 geboren und hat in den Jahren 1848 bis 1852 zuerst in Greifswald, dann auf den Universitäten zu Göttingen und Berlin den medizinischen Studien obgelegen. Mit seiner Dissertation über die Ursachen der Störungen in den Lungen nach Durchschneidung beider zehnten Hirnnerven bekundete er sein Geschick sowohl in experimentellen als in mikroskopischen Arbeiten und die Fähigkeit, schwere und wichtige physiologische Probleme klar und sicher anzufassen. Wenig Dissertationen, zumal in lateinischer Sprache geschriebenen, ist es beschieden gewesen, so oft in den Lehrbüchern der Physiologie zitiert zu werden wie dieser Erstlingsarbeit des angehenden Chirurgen.
Was Billroth zum chirurgischen Fache führte, wissen wir nicht; aber in der Zeit, da er seine Studien beendet hatte, war vor allen deutschen Chirurgen Langenbeck in Berlin zur Erkenntniß von der Bedeutung der histologischen Forschungen für die Fortschritte des chirurgischen Wissens und Könnens gekommen. Er zog den Jüngling, welcher in Johannes Müllers und Virchows Schule sich bewährt hatte, an sich und betraute ihn mit der Stellung eines Assistenten an seiner Klinik, eine Stellung, die Billroth sieben lange Jahre eingenommen hat. Es waren in erster Stelle Beiträge zur pathologischen Histologie, über die Entwicklung der Blutgefäße, über den Bau der Schleimpolypen u. s. w., die den Assistenten beschäftigten und zu deren mühsamer, zeitraubender Bearbeitung er die Ruhe der Nacht und jede freie Stunde opfern mußte.
Es sind nicht selten damals, wie er selbst erzählt, vier bis sechs Wochen vergangen, ehe er aus dem schlecht gebauten, in einer engen Straße an der stagnierenden Spree gelegenen Spital der damaligen Berliner chirurgischen Klinik hinauskam und dann auch nur, um eine Viertelstunde lang im Thiergarten spazieren zu gehen. In der That, wer die zahlreichen Arbeiten überblickt, die der junge Forscher in den Jahren 1854 bis 1860 in der Deutschen Klinik, in Müllers Archiv für Anatomie und Physiologie und in Virchows Archiv für pathologische Anatomie, sowie in umfangreichen Monographien erscheinen ließ, kann sich nicht wundern, daß bald die Aufmerksamkeit der medizinischen Welt sich dem neuen Schüler Langenbecks zuwandte und derselbe 1860 auf den Lehrstuhl der Chirurgie in Zürich gerufen wurde.
In zweifacher Hinsicht hat er hier seinen Ruf gerechtfertigt und seinen Ruhm entwickelt.
Zunächst als klinischer Lehrer, der es verstand, in wenig Jahren Zürich zu einem Anziehungs- und Sammelpunkt für diejenigen jungen Aerzte zu machen, die nach beendeten Studien ihrer weiteren Ausbildung durch den Besuch neuer in- und ausländischer Universitäten dienen wollten. Es war, um einen Vergleich Billroths zu wählen, die Wirkung seiner Person wie die des Rattenfängers von Hameln: „Wohin der Student mit Begeisterung geht, da lernt er auch mit Begeisterung.“
Mehr aber noch wirkte Billroth durch die Herausgabe eines Werkes, das in der Art, wie er es geplant und durchgeführt hat, etwas völlig Neues gewesen ist: seine „Allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie in fünfzig Vorlesungen“, die 1863 zuerst erschienen ist und es bis heute auf zwanzig Auflagen gebracht hat. Während man früher unter allgemeiner Chirurgie bloß die Aufzählung der allgemein gebrauchten Instrumente, die Anleitung zu ihrer Gebrauchsweise und die Beschreibung der gewöhnlichsten elementaren Operationen verstand, gab Billroth dem Begriff eine ganz andere Bedeutung und Ausdehnung, ja er schuf gewissermaßen mit dieser seiner Arbeit eine neue chirurgische Disciplin. Den Aufschwung, welchen die pathologische Anatomie allen Zweigen der praktischen Medizin bereit war zu bringen, machte dieses Buch der Chirurgie dienstbar. Indem der Verfasser allemal von klinischen Bedürfnissen in dem konkreten Falle ausgeht, zeigt er am besten, welche anatomischen, physiologischen und histologischen Betrachtungen zum Verständniß des den Praktiker beschäftigenden Prozesses unentbehrlich und nothwendig sind. Die Krankheiten werden nicht nach einem bestimmten System getrennt oder zusammengefaßt, sondern so zu einander in Beziehung gebracht, wie sie sich im kranken Menschen darstellen, und überall wird doch das Verhältniß der einzelnen Krankheit zum Ganzen festgehalten und im Sinne der Alten gelehrt, daß nur die Vereinigung der Medizin und Chirurgie den vollkommenen Arzt bilde und der Arzt, dem die Kenntniß des einen dieser Zweige abgeht, einem Vogel mit einem Flügel gleiche.
Noch eine zweite Arbeit ist aus dieser Züricher Zeit epochemachend geworden, es sind das die „Beobachtungsstudien über Wundfieber und accidentelle Wundkrankheiten“ aus dem Jahre 1862. Sie lieferte zuerst im Gegensatz zu der früheren Auffassung, nach welcher das Wundfieber die Antwort des Organismus auf seine Reizung durch die Verwundung, d. h. die allgemeine Reaktion auf einen lokalisierten Eingriff oder ein örtliches Leiden war, den Beweis, daß weder die Art der verletzten Theile noch die Ausdehnung der Verletzung bestimmend für das Auftreten des Fiebers und maßgebend für seine Höhe sind.
Damit war die Brücke geschlagen zu der modernen Auffassung des Wundfiebers, als hervorgerufen und bedingt nicht durch den Akt der Verwundung als solchen, sondern durch Schädlichkeiten, die nachträglich von außen in die Wunde [fallen] und dringen. Die erste Forschung nach diesen spezifischen Schädlichkeiten gehörte wieder Billroth, als er in einer späteren Arbeit den Versuch machte, die Fieberursache und den Zusammenhang dieser Ursache mit den Fiebererscheinungen in Erfahrung zu bringen, und dazu in weitester Ausdehnung das Thierexperiment herbeizog. Dadurch hat er die Grundlage zu der schließlich von Lister eröffneten antiseptischen Aera der Chirurgie gelegt. Der Wunsch, den er am Schlusse seiner letzterwähnten Arbeit dem Leser gegenüber ausdrückt, sie mochte lebensfähig und keimfähig sich erweisen, ist so aufs reichste in Erfüllung gegangen. Er selbst hat an einem anderen Orte und für eine ganz andere seiner Schöpfungen Geibels Gedicht von dem alten Förster zitiert, der bei den Reisern, die er pflanzt, der Kronen gedenkt, zu denen sie einst, den Wald entlang rauschend, erwachsen werden. Zu solchen Kronen sind Billroths fleißige und emsige Temperaturmessungen an den Verwundeten jetzt schon längst herangewachsen, denn 25 Jahre sind es, seit er 1867 Zürich verließ, um den so viel größeren Wirkungskreis in Wien zu gewinnen.
Billroths Wirken, Billroths Leben in Wien ist in einem Sinne sicher ein köstliches gewesen, indem es Mühe und Arbeit nicht bloß auf dem wissenschaftlichen und praktischen Gebiet der Chirurgie war, sondern nach verschiedenen Richtungen über dasselbe in gleich energischem Fleiße und unermüdlicher Sorge hinausgriff.
Das Riesenmaterial seiner Klinik hat er in einer großen Zahl von klinischen Berichten und Sammelforschungen dadurch vorzugsweise in den Dienst der Wissenschaft zu stellen gesucht, daß er die Einzelbeobachtungen buchte, ordnete und zusammentrug, um sie statistisch verwerthen zu können. Indem er eine strenge und wahrhafte Kritik an diese Zusammenstellungen legte und alle seine Erfahrungen, ohne Rücksicht auf den Erfolg, mittheilte, suchte er nicht bloß die augenblicklichen, sondern auch die schließlichen und bleibenden Resultate seiner Operationen so wahr als klar zu ermitteln.
Deswegen schreibt er in der Einleitung zu einem der ersten seiner klinischen Berichte:
„Die Wege, sich über die eigenen Erfahrungen klar zu werden, sind nicht schwer zu finden. Von jedem Kranken muß mit pedantischer Strenge eine Krankengeschichte geführt werden. Diese Journale müssen in systematischer Ordnung bewahrt werden. Sollen nach Abfluß eines oder mehrerer Jahre die [575] erworbenen Erfahrungen zusammengestellt werden, so müssen über alle Kranke, welche nicht völlig geheilt das Hospital verließen (und die Zahl dieser Individuen ist in jedem Spital sehr groß) Nachrichten eingezogen werden, wie der schließliche Verlauf der Krankheit war, ob die betreffenden Individuen geheilt sind, vollkommen oder mit Zurückbleiben von Funktionsstörungen, ob und woran sie gestorben sind, wie lange der Verlauf der ganzen Krankheit dauerte u. s. w. Kann man das schließliche Resultat z. B. der Behandlung einer chronischen Hüftgelenksentzündung nicht angeben, so bleiben die errungenen Erfahrungen trotz der genauesten Krankengeschichte, sehr unvollkommen, ja ebenso lückenhaft, als wenn man darüber nur in Büchern gelesen hätte.“
Von diesen Grundsätzen getragen sind Billroths ausführliche Berichte, die unter dem Titel „Gesammtbericht über die chirurgischen Kliniken in Zürich und Wien 1860 bis 1876“ erschienen, sowie die auf seine Anregung entstandene ausführliche und wichtige Schrift seines Schülers Winiwarter, jetzt Professor der Chirurgie in Lüttich, über die Statistik der Krebse.
Was Billroths Schule in Wien aber besonders gekennzeichnet hat, das sind die vielen und großen neuen Operationen, an die sich der Meister zuerst gewagt hat, so die Fortnahme des erkrankten Kehlkopfs, das Ausschneiden (Resektion) von erkrankten Stücken des Magens, die Ausschließung des kranken Magens von dem Geschäfte der Verdauung durch die Einnähung unterhalb gelegener Darmabschnitte in den Magen, die sogenannten Gastroenterostomien.
Auf dem internationalen Aerztekongreß in Berlin berichtete Billroth selbst über die Ergebnisse von 124 vom November 1878 bis Juni 1890 in seiner Klinik und Privatpraxis ausgeführten Resektionen am Magen und Darmkanal, Gastroenterostomien und Narbenlösungen wegen chronischer Krankheitsprozesse. Er schloß mit den Worten:
„Die Schwierigkeit einer frühen Diagnose und die Gefahr des operativen Eingriffs werden keine unheilbaren Gebrechen unserer Kunst bleiben. Ich zweifle nicht daran, daß bei fortgesetztem eifrigen Studium eine frühere Präcisierung der Diagnose möglich werden wird und daß wir die Gefahren dieser Operationen durch Vervollkommnung der Methoden und der Technik noch um ein Bedeutendes zu verringern imstande sein werden. Wenn wir dennoch vielleicht nicht so schnell, als wir wünschen, zur höchsten Höhe unserer Bestrebungen gelangen, so rufe ich Ihnen allen den Wahlspruch meines großen Meisters Bernhard von Langenbeck zu: ‚Nunquam retrorsum!‘“[5]
Keiner der Chirurgen unserer Zeit, nicht bloß der deutschen, sondern auch der englischen und französischen, ist so sehr wie Billroth Mittelpunkt einer chirurgischen Gelehrtenschule geworden. Zwei seiner ausgezeichnetsten Schüler bekleiden im Deutschen Reich das Amt eines ordentlichen Professors der Chirurgie und Direktors einer chirurgischen Klinik: Geheimer Hofrath Czerny in Heidelberg und Geheimer Medizinalrath Mikulicz in Breslau, ebensoviele lehren in gleicher Stelluttg in Oesterreich, Professor Gussenbauer in Prag und Professor Wölfler in Graz, in Belgien wirkt an der Universität Lüttich Winiwarter, in Serbien Giorgewicz, ganz abgesehen von den Wiener Docenten und Primärärzten, wie von Hacker, Gersuny, Steiner, von Eiselsberg u. a.
Nicht die Staatsinstitutionen, und seien sie für die Erzielung eines tüchtigen Nachwuchses akademischer Lehrer auch die besten, schaffen eine Gelehrtenschule, sondern die bedeutenden Männer bilden sie. Sache des Staates ist es daher, diese zu finden, wie Oesterreich für die medizinische Fakultät Wiens das in hervorragender Weise verstanden hat, indem es seine Van Swieten, Brücke, Brambilla, Billroth aus aller Herren Ländern zu gewinnen trachtete.
Welchen Eigenschaften Billroth seinen hervorragenden Einfluß auf die Jugend verdankt, ist nicht schwer zu sagen. Er gehört zu denjenigen Naturen, die alles, was an sie tritt, und jedes Neue, was ihnen ihre Wissenschaft bringt, sich schnell und ganz zu eigen machen, um es in besonderer und durchaus individueller Weise sofort weiter zu verarbeiten, auszubilden und zu entwickeln.
„Die besten Gedanken“, schreibt er einmal, „finde ich bei anderen Schriftstellern immer zwischen den Zeilen; was ich lese, interessiert mich fast nur deshalb, weil der Stoff selbst oder die Art, wie er behandelt ist, in mir neue Gedanken hervorbringt.“ So produziert er ohne weiteres aus dem, was er eben recipiert hat, und das schafft die Frische in der Lehre, die den Sechziger noch jugendlich erscheinen läßt in der Begeisterung für seine Lehrthätigkeit. Wenn er vorträgt, oder wenn er diskutiert, ist er voll Geist und Leben, und seine innerliche Erregung überträgt sich dann auf den Hörer und Schüler, befruchtet, erhebt und begeistert auch ihn.
Wer seine Schüler von Stufe zu Stufe, immer höher und zu immer größerer Vollkommenheit zu führen vermag, muß in schöpferischer Kraft ihnen vorangehen – er muß, wie Billroth, nicht nur das gesammte Wissen seines Faches beherrschen, sondern auch ein Meister im Können und Erfinden sein. Daß er das war und ist, bezeugt die Schule, die er geschaffen hat. Wie er es verstanden hat in seinen Vorlesungen sich in die Denkungsart und den jeweiligen Stand der Kenntnisse und des Wissens seiner Zuhörer zu versetzen, um, an das ihnen Bekannte anknüpfend, ihren Gedankenkreis zu erweitern, so ist auch von ihm auf seine Schüler die Art des Denkens, Empfindens, Handelns unmerklich, aber bleibend übergegangen.
Das Verhältniß zu seinen Schülern charakterisieren am bestem die Ansprachen, welche an seinem sechzigsten Geburtstag ihm zwei der bedeutendsten derselben, Gussenbauer und Czerny, widmeten.
„Sie haben“, heißt es dort, „in uns wissenschaftliches Denken, welches die Naturobjekte nur um ihrer selbst willen, ohne Rücksicht auf praktische Tendenzen betrachtet, geweckt und durch musterhaftes Beispiel gefördert. Streng in der Selbstkritik, haben Sie mit freundlichem Wohlwollen auch unsere schüchternsten Versuche, am großen Werke der modernen Chirurgie mitzuarbeiten, begleitet, rathend und mithelfend ergänzt, wo enger Blick und geringe Erfahrung nicht ausreichten, um durch Kleines das große Ganze zu bereichern. Sie haben uns Einblick gewährt, wenn Sie nach unermüdlichem Studium Ihre erstem Komzeptionen, dem erleuchteten Künstler gleich, in lebendigem Worte oder in unvergänglicher Schrift für die Wissenschaft formvollendet gestalteten. So haben Sie uns sehend und wissend gemacht, bevor Sie uns herangezogen zum schweren Beruf des praktischen Chirurgen.“
Ein Meister von Meistern, ein schöpferischer Forscher und ein außerordentlich produktiver Schriftsteller – so steht Billroth während der fünfundzwanzig Jahre seiner Wiener Lehrthätigkeit da. In den weitesten Kreisen der Gebildeten verbreitet sind namentlich zwei seiner Schriften, seine „Chirurgischen Briefe aus den Feldlazarethen in Weißenburg und Mannheim 1870“ und sein „Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften an den Universitäten der deutschen Nation“ – eine kulturgeschichtliche Studie. Seine leichte, fließende und überaus anregende Art zu schreiben leuchtet aus ihnen auf jeder Seite hervor – ebenso wie die jugendliche Lebhaftigkeit im Empfinden und Denken des Verfassers. In die ideale hehre Stimmung der Julitage des unvergeßlichen Jahres 1870 wird jeder, der so glücklich gewesen ist, sie mitzufühlen, versetzt, so oft er die Vorrede zu den Briefen aufschlägt, die Billroth „bei dem Lichte jener Flammen mit blutiger Hand auf den Schlachtfeldern schrieb“ – als es ihn nicht länger in Wien duldete, sondern er fort bis in die vordersten Reihen derer eilte, die zur Wacht am Rhein in dessen Pfalz sich gesammelt hatten. Die den Eindrücken unmittelbar folgende Schilderung wird das Buch als einen werthvollen Beitrag zur Geschichte des großen deutschen Krieges Kind und Kindeskindern erhalten.
In einer ganz anderen Richtung werthvoll für jeden, welcher deutsche Universitätsverhältnisse beurtheilem und für die Förderung des medizinischen Unterrichts und der medizinischen Institute an ihnen thätig sein will, ist das zweite der oben erwähnten Bücher: über das Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften. Hier ist zum ersten Male in großer Vollständigkeit an die Geschichte der Entwicklung unserer medizinischen Fakultäten die Darstellung der jetzigen deutschen Methoden des Lehrens geschlossen worden. Vorbildung, Prüfung und Lernfreiheit des Stndierenden sind ebenso kritisch dargestellt, wie die Zusammensetzung, Ergänzung und Lehrfreiheit der Professorenkollegien besprochen sind – zunächst an den Universitäten mit deutscher Zunge, dann aber auch, des Vergleiches wegen, in den [576] ausländischen Fachschulen. Wer das Werk durchblättert, wird auf jeder Seite der Originalität des Verfassers begegnen – zumal in den Kapiteln, welche von der Sorge für einen tüchtigen, akademischen Nachwuchs handeln. „Ja, immer gleich begabte, gleich erfolgreich wirkende Kinder zu erzeugen, dazu hat die Physiologie die Mittel und Wege noch nicht gezeigt, ebensowenig, wie die hervorragendsten Pädagogen bedeutende Menschen nach bestimmten Plänen heranzuziehen vermögen.“
Wenn man als Kriterium für einen akademischen Lehrer seine universelle Bildung, seinen Geist und Witz ansieht, so können wir mit Billroth von Billroth schreiben: „Beschäftigen wir uns mit den starken Magneten, denen alles von nah und fern zufliegt, so darf man behaupten, daß die großen Naturforscher und Aerzte immer etwas Schwärmerisches, Phantastisches, zum Universellen Hindrängendes, daß sie meist auch einen Hang zum Künstlerischen hatten, oft nicht selten zugleich Dichter, Maler, Musiker waren, und daß sie in ihrer ganzen Erscheinung, so verschieden sie auch sein mochten, für die Jugend etwas unüberwindlich Anziehendes, Priesterliches, Dämonisches hatten.“
Billroth ist ein begeisterter Jünger der edlen Musica. Brahms rechnet er zu seinen besten Freunden, und in seinen Salons in der Residenzstadt, sowie seinem herrlichen Landhaus am Wolfgangsee weilen gern und oft die hervorragendsten Meister in dem Reiche der Töne.
„In dem kunstsinnigen Wien,“ schreibt Czerny, „ist der Norddeutsche Billroth eine der populärsten Persönlichkeiten geworden durch den Reiz seines genialen, für alles Edle begeisterten Wesens, durch die liebevolle Sorgfalt, welche er seinen Klienten, gleichgültig ob Hoch oder Niedrig, widmet, und durch die patriotische Hingebung, welche er stets seiner neuen Heimath [be]wiesen hat.“
Was Billroth bekannte, als er mit dem heißesten nationalen Empfinden in den Krieg von 1870 zog, daß niemals das Sakrament der Humanität in ärztlicher Pflicht dem verwundeten Feinde gegenüber von ihm vergessen werden würde, hat er auch den Tausenden, die seine Schüler gewesen sind, eingeflößt, die lauterste Humanität am Krankenbette. Er hat sie täglich durch mannigfaltiges Beispiel begreifen gelehrt, daß nur der humane Mensch ein guter Arzt sein kann.
Ein schönes Denkmal dieser seiner Bestrebungen für das Wohl und die Pflege der Kranken ist die Stiftung des Rudolfinerhauses in Unterdöbling bei Wien. Dasselbe soll der Ausbildung tüchtig und gründlich in ihrem Fache geschulter Wärterinnen dienen. Die hohe Bedeutung der Krankenpflege kann nicht eingehender und besser geschildert werden, als Billroth das in seinem Buche „Die Krankenpflege im Hause und im Hospital“ gethan hat. Die Nothwendigkeit einer Pflegerinnenschule wird hier in das richtige Licht gestellt und treffend hervorgehoben, daß eine solche in einer großen Stadt mit vorwiegend großen Hospitälern nur zur gedeihlichen Entwicklung kommen kann, wenn sie mit einem eigens dazu bestimmten Krankenhause verbunden ist. Mit seltener Energie und unermüdlichem Eifer hat Billroth ein solches in dem Rudolfinerhause für die Frauen und Mädchen geschaffen, welche die Krankenpflege zu ihrem Lebensberufe gewählt haben. Schon wenige Jahre nach Eröffnung desselben konnte er schreiben: „Die gute Pflege, welche den in der Anstalt aufgenommenen Kranken zu theil wird, ist einer der Umstände, die den Ruf des Rudolfinerhauses in immer weitere Kreise tragen, den Zudrang Hilfesuchender vermehren und so wieder zum Gedeihen der Anstalt beitragen.“
Es hat nicht fehlen können, daß Billroths Leistungen die Bewunderung der Zeitgenossen und eine Häufung von Ehren aller Art ihm erwarben. Sein Kaiser ernannte ihn zum Mitglied des österreichischen Herrenhauses und fast alle Fürsten Europas haben sich bemüht, seine Brust mit Orden zu schmücken.
Wohl uns und ihm, daß er noch mitten in seiner Arbeitskraft und seiner Thätigkeit steht, daß überall dort, wo wissenschaftliche Chirurgie und humane Krankenpflege getrieben wird, der Name Billroth obenan steht, und auf der zweiten Seite wieder Billroth und so fort immer wieder Billroth.
Zu Ende mit seinen Schöpfungen und Strebungen ist er noch lange nicht. Im Augenblicke sucht er den Wiener Aerzten ein Vereinshaus zu gründen und zu bauen. Für ihn „gibt’s ka Ruh’“, wie der Wiener sagt.
Er kommt aus dem Zuchthaus! Wer weiß es nicht, welch ein fürchterlicher Bann auf dem Haupte dessen lastet, von dem diese Worte gelten?
Gemieden, ausgestoßen, geächtet – losgerissen von Freundschaft und Verwandtschaft – meist mit kargen Mitteln steht er da in der Welt, die auch ihm fremd geworden. Er schaut sich um nach einem Rettungsanker. Er will arbeiten. Aber wer giebt ihm zu arbeiten? Wo sind die wenigen Vorurtheilslosen, die es wagen, mit dem entlassenen Sträfling einen Versuch zu machen? Er geht daran, Umfrage zu halten. „Wo standen Sie zuletzt in Arbeit?“ – die Frage kehrt überall wieder – und ein schamvolles Schweigen ist die beredte Antwort. Achselzuckend bedauert der vorsichtige Arbeitgeber.
Wir brauchen das Bild nicht weiter auszuführen. Genug, daß das Ende meist eben das eine ist – die Rückkehr hinter jene finsteren Kerkermauern, die dem Elenden fast als eine Zuflucht erscheinen müssen; genug, daß selbst aus dem reuigen Verbrecher schließlich ein schlechter Mensch wird, in dem auch das letzte Fünkchen Liebe zum Guten erlischt, um einer rasenden Lust am Bösen das Feld zu räumen.
Das sind die Erscheinungen, welche die „Vereine zur Fürsorge für entlassene Strafgefangene“ ins Leben gerufen haben; ausgehend von der „Philadelphia society for assisting distressed prisoners“, haben sie auch in Europa allenthalben Fuß gefaßt. Ihr Bestreben ist, die Entlassenen vor augenblicklicher Noth zu schützen, dann aber hauptsächlich, ihnen Arbeit, ihnen Gelegenheit zu schaffen, sich in den Augen ihrer Mitmenschen wieder ehrlich zu machen. Selbstverständlich bedarf es dazu großer Mittel, und leider fließen diese bei uns nicht eben reichlich.
Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Schweden, England, Frankreich, namentlich Nordamerika, wo derartigen Vereinen aus öffentlichen Kassen und von Privatleuten freigebige Spenden in steigendem Maße zu theil werden, denkt man in Deutschland noch viel zu wenig daran, welche Bedeutung es für das Gemeinwesen hat, wenn solche verlorenen Elemente der Bevölkerung wiedergewonnen, zu fleißigen nützlichen Gliedern der Gesellschaft werden.
Hier und da, das soll nicht geleugnet werden, sind ja üble Erfahrungen gemacht worden mit Anstellung von Strafentlassenen, ja mancher von ihnen scheint unverbesserlich. Dem gegenüber steht aber die Thatsache, daß unter ihnen nicht wenige sind, denen eine außergewöhnliche Thatkraft innewohnt, und die, nachdem es gelungen ist, sie zu einem geordneten Leben zurückzuführen, durch besondere Tüchtigkeit und persönliche Anhänglichkeit für das ihnen unter erschwerenden Umständen geschenkte Vertrauen zu danken bemüht sind. Sie fühlen offenbar, daß ihnen eines jener echten Liebeswerke widerfahren ist, die sich nach beiden Seiten als Wohlthat erweisen.
Wären nur die Ziele und Erfolge solcher Fürsorgevereine allgemeiner bekannt, so würden gewiß deren noch weit mehr gestiftet sein und die vorhandenen kräftiger unterstützt werden! Fast überall wurzeln aber noch gewisse Vorurtheile, deren Ausrottung dringend noth thut. Gilt es, Arme, Kranke, Gebrechliche, durch Naturereignisse Geschädigte zu unterstützen, so findet sich Mitleid in weiten Kreisen oder es kann doch leicht geweckt werden; Schenkungen, Vermächtnisse fließen reichlich. Wird aber um Hilfe für sittlich Versunkene geworben – welche doch noch viel elender und gefährdeter sind – so stößt man zumeist auf verschlossene Herzen und Hände. Viele meinen, da sei doch schwerlich zu helfen, auf alle Fälle das etwa Nothwendige nur Sache der Behörden. Manche reden sich wohl gar ein, daß sie an Unwürdige Gaben vergeuden, die weit besser auf unschuldig Hilfsbedürftige gewandt würden. Sie wissen nicht, daß jene Gesellschaften moralische Hebung der Gefangenen, Milderung der Noth von Entlassenen und deren Angehörigen sich zum Ziel gesetzt haben – und, wohl zu bemerken, beides keineswegs vergebens.
Nicht die Schärfe des Gesetzes abstumpfen wollen sie, sondern nur möglichst hindern, daß dieses härter treffe, als es in der Absicht der Gesetzgebung und im Interesse des Gemeinwohls liegt.
Sonnblickverein in Wien. Wie bekannt, unterhält die „Oesterreichische Gesellschaft für Meteorologie“ die höchste Wetterwarte Europas. Es besteht nämlich seit 1886 auf dem Gipfel des 3100 Meter hohen Sonnblick in den Hohen Tauern ein massiver Thurm, in dem sich nicht nur eine meteorologische Beobachtungsstation erster Klasse, sondern auch ein „Gelehrtenstübel“ befindet, das schon wiederholt Männern der Wissenschaft zu längerem Aufenthalt diente. So weilte z. B. hier im Februar 1888 Universitätsprofessor Dr. Pernter aus Wien drei Wochen lang, und die Herren Geitel und Elster aus Wolfenbüttel, bekannt durch ihre Untersuchungen über atmosphärische Elektricität, kehren seit 1890 allsommerlich auf der hohen Warte ein, um daselbst ihre wichtigen Untersuchungen fortzusetzen. An den Beobachtungsthurm ist das Zittelhaus des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins angebaut, das den Touristen Sommer und Winter offen steht und die höchste, das ganze Jahr hindurch bewirthschaftete alpine Unterkunft darstellt. Die Wetterwarte und das Schutzhaus in diesem für die Freunde des Hochgebirges und besonders die Wintertouristen so günstigen Zustande zu erhalten, bot bis zum Winter 1889/1890 keine Schwierigkeit. Denn bis dahin war sowohl das am Fuße des Sonnblicks befindliche Werkhaus des Rauriser Goldbergwerks, als auch das noch 800 Meter höher unmittelbar am Gletscher gelegene Knappenhaus das ganze Jahr hindurch bewohnt. Seither ist jedoch das
[577][578] Goldbergwerk in den Besitz einer belgischen Gesellschaft übergegangen, die den Betrieb einstellte; und als am 4. Januar 1891 auch der frühere Besitzer des Werks, J. Rojacher, starb, war auf einmal der ganze früher so lebhafte Thalwinkel verödet.
Der seit 1887 auf dem Gipfel hausende Knappe Peter Lechner befand sich jetzt in einer üblen Lage. Niemand war da, die nöthigen großen Vorräthe von Brennholz aus dem Thale über den Gletscher zum Gipfel zu schaffen, niemand auch, der die ins Thal führende Telephonleitung ausgebessert hätte, wenn sie durch Schneestürme oder Blitzschlag beschädigt worden war. Endlich war gerade in letzterem Falle, wenn Lechner ein Unglück zustieß, Rettung fast ausgeschlossen. Denn nicht nur ist es für den einzelnen schwer, vom Gipfel herab nach Kolm Saigurn zu gelangen, sondern diese letzte Thalstation ist auch noch im Winter oft durch Lawinen und riesige Schneemassen von den unteren Thalstationen abgesperrt. Infolgedessen mußte die „Oesterreichische Gesellschaft für Meteorologie“ sowohl am Gipfel des Sonnblick als auch in Kolm Saigurn je einen Gehilfen für Peter Lechner und etliche Leute für den Holztransport anstellen. Da diese Neueinrichtungen aber einen Mehraufwand von 1500 Gulden jährlich erheischten, der die verfügbaren Mittel der Gesellschaft überschreitet, hat sie soeben einen eigenen „Sonnblickverein“ gegründet. Der Verein wird alljährlich einen kurzen gemeinverständlichen Bericht über alle den Sonnblick betreffenden Ereignisse und Forschungen herausgeben: Freunde der Hochalpen und der Meteorologie dürften daher gern vernehmen, daß der Beitritt nur an eine jährliche Leistung von zwei Gulden ö. W. geknüpft ist. R. E. Petermann.
Eine gemüthliche Gesellschaft. (Mit Abbildung.) Wie weit es Kunst und Ausdauer in der Zähmung und Abrichtung wilder Bestien bringen können, mag der Leser aus unserem Bildchen ersehen. Es ist eine Vorstellung des „Thiercirkus“, den sich Meister Carl Hagenbeck aus Hamburg zusammendressiert hat. Gefürchtete Bestien, Eisbär, Panther, Tiger und Kragenbären, haben sich zur Pyramide gruppiert, einen Kragenbär mit zwei Hunden rechts und links mag man gleichsam als Thor denken, vor dem zwei mächtige Löwinnen Wache halten. Die Thiere, sonst untereinander die grimmigsten Feinde, scheinen unter der Wirkung der menschlichen Zucht ihre eigenste Natur ausgetauscht zu haben, fügsam gliedern sie sich an der ihnen angewiesenen Stelle in den kunstvollen Bau – eine gemüthliche Gesellschaft, die einem neuzeitlichen Ritter Delorges sein Wagniß erheblich erleichtern würde.
Das Repetiergewehr – eine alte Geschichte! Im allgemeinen wird das vorgenannte Mordinstrument als die eigenste Erfindung unserer Zeit betrachtet, von welcher die Alten gar keine Ahnung gehabt hätten. Dem ist aber durchaus nicht so; im Gegentheile – unseren Vorfahren leuchteten die Vortheile des Schnellfeuerns ebensogut ein, wie sie heute der ganzen Welt klar sind, und nur der Mangel ausreichender technischer und wissenschaftlicher Hilfsmittel verhinderte in früheren Jahrhunderten eine ähnliche Ausbildung der Feuerwaffen wie heutzutage. Es ist eine ganze Reihe von Versuchen theils durch noch vorhandene Originale, theils durch Modelle, Zeichnungen und Beschreibungen aus alter Zeit bekannt, welche das Schnellfeuern ermöglichen sollten. Und merkwürdigerweise ist fast jeder der Grundbestandtheile, welche die neueren Erfinder der Schnellfeuerwaffen verwendeten, in den vergangenen Jahrhunderten bereits bekannt gewesen. Zu allgemeiner Einführung und rücksichtsloser Anwendung haben es diese Waffen damals aber nie gebracht; diese ist erst unserer Zeit vorbehalten gewesen.
Die Versuche zur Herstellung von Stücken zum Geschwindschießen lassen sich nicht weniger als ein halbes Jahrtausend zurückverfolgen. Schon eine in der Münchener Hof- und Staatsbibliothek befindliche Bilderhandschrift aus den Jahren 1380 bis 1400 enthält verschiedene Zeichnungen von Geschützen, welche mehrere Büchsen auf einem Gestelle zum Zwecke raschen Schießens vereinigen; da sich diese Rohre zum Theil um eine gemeinsame Achse drehen, so ist hier bereits das Vorbild des Revolvers gegeben. Eine ähnliche Handschrift in Göttingen vom Jahre 1405 und ein Band der Ambraser Sammlung etwa aus dem Jahre 1410 zeigen ebenfalls eine Reihe von Geschützen zum Schnellfeuern mit verschiedener Konstruktion. Den ältesten noch vorhandenen Originalhinterlader, mit beweglicher Kammer für das Pulver, welche rückwärts eingelegt und verkeilt wurde, besitzt das Artilleriemuseum zu Paris. Er scheint dem Schlusse des 14. Jahrhunderts anzugehören. Wohl der älteste erhaltene deutsche Hinterlader ist eine etwa aus den Jahren 1420 bis 1430 stammende gußeiserne Büchse mit beweglicher Pulverkammer, welche in der Nähe von Aachen ausgegraben wurde und im Besitze des nunmehr verstorbenen Herrn von Quast auf Radensleben war. In der Waffensammlung des Germanischen Museums zu Nürnberg finden sich aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ebenfalls zwei schmiedeeiserne Hinterladergeschütze, von welchen eines in Danzig beim Ausbaggern gefunden wurde, das andere aus der freiherrlich v. Minutolischen Sammlung (Schlesien) in das Museum gelangte. Vortreffliche Abbildungen von Hinterladergeschützen, ähnlich diesen beiden, finden sich auf einem der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehörenden kostbaren Kupferstich von Israel van Meckenen, welcher die Ermordung des Holofernes durch Judith darstellt und auf welchem der Künstler die Geschütze, mit denen die Stadt Bethulia beschossen wird, genau so wiedergiebt, wie er sie bei irgend einer Belagerung seiner Zeit in Gebrauch gesehen hat. Das Schnellfeuer mit den Hinterladern wurde namentlich dadurch ermöglicht, daß zu je einem Geschütze eine Anzahl von Kammern vorhanden war, die man vorher laden und dann rasch nacheinander verwenden konnte.
Eine dem Mitrailleusenfeuer der Neuzeit ähnliche Wirkung erzielte man dadurch, daß man eine Reihe von Rohren nebeneinander anbrachte, die man zu gleicher Zeit abbrennen konnte; oder man ging noch weiter und stellte drei solche Reihen zu einem dreieckigen Prisma zusammen, welches sich um eine Achse drehte, so daß dann die drei Reihen schnell hinter einander losgeschossen werden konnten. Bis diese drei Seiten wieder geladen und verwendungsfähig waren, dauerte es allerdings dann eine lange Zeit.
Diesen Beispielen von Hinterladern, Revolvern und Mitrailleusen aus dem 15. Jahrhundert reihen sich in den verschiedenen Waffensammlungen, namentlich in der des Germanischen Museums, solche aus allen folgenden Jahrhunderten an. Obgleich sich indessen aus der späteren Zeit natürlich viel mehr Feuerwaffen erhalten haben, als aus der früheren, so finden sich darunter doch verhältnißmäßig wenige der geschilderten Art. Es scheint, daß man im 16. Jahrhundert, nachdem man im 15. zwischen dem Vorder- und Hinterlader geschwankt hatte, sich ganz entschieden auf die Seite des ersteren stellte, und daß Hinterlader nur selten mehr zur praktischen Verwendung gelangten, sondern höchstens noch angefertigt wurden, um den Witz des Zeugmeisters namentlich den Laien gegenüber glänzen zu lassen. Zu Anfang unseres Jahrhunderts waltete noch dasselbe Verhältniß ob; ein im Germanischen Museum befindliches, für Napoleon I. hergestelltes Hinterladergewehr bezeugt, daß auch dieser große Feldherr sich mit der Frage, ob Hinterlader oder Vorderlader, befaßte, aber doch an letzterem festhielt.
Ein Repetiergewehr – Hinterlader – kannten im 17. Jahrhundert zwei Nürnberger Bürger, Bernhard Oßwaldt und Jakob Putz, und Kaiser Leopold I. ertheilte ihnen im Jahre 1674 ein Privilegium darauf. Dieses Geschwindstück konnte man mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Kugeln laden, je nachdem man es für wünschenswerth erachtete, und die Geschosse dann nacheinander losschießen. „Dahero zum Exempel, wenn 20 Mann mit der alten Art Musketen auf 3 Salva mit 60 Schuß Pulver 60 Stück Kugeln brauchen, so kann hingegen mit dieser neuen Art ein Mann allein eben in solcher geschwindter Zeit, als die 3 Salva verricht werden, zehen Schuß prästieren, und jedesmal in den zehen Schüssen zu 6 Kugeln auch 60 Kugeln verschießen.“ Die Privilegiumsinhaber wie der Kaiser versprachen sich von dieser Erfindung große Vortheile für die „werthe Christenheit“ im Kampfe gegen den Erbfeind, die Türken. Die Geschichte weiß aber von Erfolgen, die mit Hilfe dieser neuerfundenen Waffe erzielt worden wären, nichts zu berichten! H. B.
[579] Das Marmorpalais bei Potsdam. (Mit Abbildung.) Man muß zugestehen, daß Natur und Kunst in Potsdam etwas geschaffen haben, was nach mancher Richtung hin seinesgleichen sucht. Prächtige Gärten und Schlösser, Springbrunnen und Terrassen, Alleen und beschnittene Hecken, heimliche, mit Statuen geschmückte Laubgänge und freie herrliche Blicke über See und Wald! Friedrich der Große war es, der hier eine eigene Welt zu bauen begann, und die späteren Könige haben sein Werk fortgesetzt. Aus der Fülle des Schönen in Potsdam führen wir heute unseren Lesern das Marmorpalais vor Augen. Durchwandert man die villenbesetzte Umgebung der Stadt in nördlicher Richtung, so gelangt man durch hübsche Gartenanlagen zu dem Palais, das, zwischen Bäumen versteckt, den Blicken fast entgeht. Ein schöner stiller Fleck, dieses Schloß am Ufer des Heiligen Sees!
Friedrich Wilhelm II. legte den Grundstein, Friedrich Wilhelm IV. vollendete den Bau, der, weitläufig hingestreckt, mit s[ei]ner kuppelgezierten zweistöckigen Mittelfront und den zwei einstöckigen Arkadenflügeln mehr gefällig als imposant wirkt. Im Sommer blühen im Schloßhof Orangenbäume, und ihr Grün hebt sich reizvoll ab gegen den mächtigen, dort aufgestellten Prometheus von E. Wolff. Man glaubt sich in eine kleine Zauberwelt versetzt, wenn man hier einsam umherwandelt und der Duft der Blumen aus den Gärten herüberbringt. Kein Wunder, daß dieser Ort einen Lieblingsaufenthalt der Kaiserin bildet. Hier gab sie auch dem Kronprinzen, den Prinzen Eitelfritz, Adalbert und Oskar das Leben, und im nördlichen Arkadenflügel haben ihre Söhne die ersten Sommer zugebracht. Mit seinen herrlichen Fernblicken über den Park und die Fluthen des Heiligen Sees bis hin zu den malerischen Ufern des Jungfernsees ist dieses Schloß ein glückliches Idyll, fern dem lauten Treiben des Alltags. – g.
Die Droschkenparade am Berliner Polizeipräsidium. (Zu dem Bilde S. 565.) Wie in anderen Städten, so ist es auch in Berlin Gesetz, daß die öffentlichen Miethwagen, die Droschken, sich von Zeit zu Zeit vor der hohen Polizei zu zeigen und sammt ihrem Besitzer und ihrer Bespannung auf ihre vorschriftsmäßige Beschaffenheit prüfen zu lassen haben. Da entwickelt sich dann vor dem neuen Polizeipalast am Alexanderplatz, in der Straße „An der Stadtbahn“, ein eigenartiges Getriebe. In langer Reihe sind die Droschken erster und zweiter „Güte“ entlang den Bogen der Stadtbahn aufgefahren, Stück für Stück nimmt der untersuchende Polizeioffizier vor und vertieft sich eingehend in die Verhältnisse von Wagen, Pferd und Kutscher. Die Polster des Inneren, die Achsen und Räder, Nummer, Konzession, Futter- und Kräftestand der edlen Rosse, alles bildet einen Gegenstand behördlicher Kontrolle, und erst wenn alles in Ordnung befunden wurde, erhält der Wagen seinen Jahresstempel und ist damit für würdig erklärt, wieder auf ein Jahr die staunenden Fremden von einem Wunder der Reichshauptstadt zum anderen zu tragen – und eine solche Ehre darf wohl mit einiger Schererei bezahlt werden!
Siegfried und Mime. (Zu dem Bilde S. 553.) Da steht er vor uns, der edle jugendliche Held, Siegfried der Drachentöter, in der Hand das siegreiche Schwert; hinter ihm liegt Fafner, der Drache, erschlagen, der Wächter des Nibelungenhortes mit dem gewaltigen Schweife, dem schuppigen Rücken, dem Rachen, der jetzt nicht mehr drohend die Zähne weist. Wie er auch voll Wuth sich aufgebäumt – er widerstand nicht dem Heldenmuth des Jünglings und seinem Schwerte. Wotan selbst hatte dieses Schwert in einer Esche Stamm gestoßen. Dem sollt’ es zu eigen gehören, der es aus dem Stamme herauszöge. Doch keiner der stärksten Helden vermochte dies; nur dem kühnen Siegmund, Siegfrieds Vater, gelang’s – und er führte tapfer das Schwert im Streite, bis es an Wotans Speer zersprang. Die beiden Stücke aber schweißte Siegfried zusammen, während sein Pflegevater, der Zwerg und Waffenschmied Mime, sich vergeblich damit bemüht hatte.
Jetzt, nach Siegfrieds Triumph, gelüstet’s den Zwerg, des Sieges Preis für sich zu erbeuten, den Nibelungenring und -hort sich zu erobern. Er hat einen Trank gebraut, der die Sinne des Jünglings in Nacht und Nebel versenken, ihn betäuben und bewußtlos machen soll: dann will
Mime ihm das Haupt abschlagen, damit er vor seiner Rache sicher sei, wenn er die Beute für sich gewonnen. Mit widerlicher Zudringlichkeit reicht er dem Helden das Trinkhorn, in das er vorher aus einem Gefäß das verderbliche Gebräu gegossen. Siegfried aber hat bereits das Schwert gefaßt und in einer Anwandlung von heftigem Ekel streckt er Mime damit zu Boden. †
Leben in Hitze und Frost. Der menschliche Organismus ist befähigt, hohe Kälte- und Wärmegrade zu ertragen. Das beweisen einerseits die in Polarländern lebenden Völker und die Nomaden der Wüste, andererseits die vielen europäischen Reisenden, welche, das gemäßigte Klima verlassend, Polarländer und Wüsten bereist haben, ohne an ihrer Gesundheit Schaden zu nehmen. Aber diese Widerstandsfähigkeit hat ihre Grenzen. Wird das Blut und werden die inneren Organe des Körpers bis zu einem gewissem Grade abgekühlt und überhitzt, so tritt der Tod ein. Im allgemeinen gilt die Regel, daß das Leben erlischt, wenn die Bluttemperatur des Menschen auf +25° C. herabgedrückt ist; nur in Ausnahmefällen haben sich Menschen erholt, deren Temperatur noch tiefer heruntergegangen war. Jedenfalls muß die Abkühlung des Blutes auf +20° C. als die äußerste Grenze angesehen werden.
Was nun eine übermäßige Erwärmung anbelangt, so gerinnt das Blut schon bei einer Eigenwärme von 42,6° C., während die Muskeln bei +49° C. durch Gerinnung absterben. Die richtige Temperatur des Menschen beträgt etwa +37° C., und um sie möglichst auf dieser Höhe zu erhalten, ist der Körper mit einer Reihe von Schutzmitteln ausgestattet, durch welche die Einwirkungen der Kälte und Hitze von außen gemäßigt werden. Ein Schutzmittel gegen übermäßige Wärme ist beispielsweise die Hautausdünstung und Schweißbildung. Sie erklärt uns, daß der Mensch in römischen oder irischen Bädern in dem sogenannten Tepidarium eine Hitze von +50° C. und im Caldarium eine solche von +60° C. aushalten, daß er sich wie Berger und de la Roche für einige Minuten einer trockenen Wärme von +80 bis 87° C., ja wie Bladgen und Fordyce einer solchen von über +100° C. aussetzen kann. Die Verdunstung, die an der Körperoberfläche stattfindet, verhindert eine Zeit lang die Durchwärmung des Körpers. Wäre die Luft mit Dampf gesättigt, so würde sie die Haut augenblicklich verbrühen. Darum ist uns auch Luft so lästig, die zugleich heiß und feucht, also mit Dampf geschwängert ist, und es steht fest, daß Thiere, welche der Einwirkung einer feuchten, nur bis +40° C. erwärmten Luft ausgesetzt werden, binnen wenigen Stunden absterben.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen auf diesem Gebiete wurden neuerdings in klarer Weise von Prof. Hermann von Meyer für weitere Kreise zusammengestellt. Die Abhandlung ist erschienen unter dem Titel „Die thierische Eigenwärme und deren Erhaltung“ in der „Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge“ (Hamburger Verlagsanstalt), welche von R. Virchow und W. Wattenbach herausgegeben werden.
In den Stuttgarter Anlagen. (Zu dem Bilde S. 577.) Zu dem Schönsten der an Schönheit reichen Hauptstadt Schwabens gehören die königlichen „Anlagen“, ein ausgedehnter herrlicher Park, der vom Residenzschloß bis zum Neckar bei Cannstatt reicht. Dem allgemeinen Verkehr in entgegenkommendster Weise geöffnet, bieten diese Anlagen besonders im Sommer ein überaus belebtes, farbenprächtiges Bild, und nirgends findet sich mehr Gelegenheit als hier, den alten Ruf Stuttgarts, die hübschesten Mädchen weit und breit zu besitzen, aufs eingehendste nach seiner Berechtigung zu untersuchen. Wer diesem Rufe ein mißtrauisches Gemüth entgegenbringt und bloß vor Thatsachen sich beugen will, der darf nur den breiten Mittelweg der Promenade wählen, der zugleich reizende Ausblicke auf das königliche Schloß gestattet, auf leuchtende Statuen, die sich wie ein lichter Traum aus dem dunklen Grün der Bäume und Büsche heben. Dort wird auch der größte Zweifler, besiegt durch soviel muntere Frische und soviel Schwäbisch von anmuthigen Lippen, die Waffen strecken müssen, und sollte ihm wider Erwarten der ungeahnte Eindruck allzusehr zu Herzen gehen, dann findet er abseits auch stillere Wege, um in lauschiger Einsamkeit sein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen.
Ein Handbuch der deutschen Geschichte. Die Geschichte unseres deutschen Volkes und Landes darf sich nicht über Vernachlässigung beklagen. Auf den verschiedensten Punkten sind die Forscher an der Arbeit, Licht und Verständniß zu verbreiten, neue Quellenschätze an den Tag zu fördern, zur Benutzung vorzubereiten und die Ergebnisse geordnet und gesichtet dem Leser darzubieten. Im Mittelpunkt der litterarischen Erscheinungen in dieser [580] Richtung steht die groß angelegte „Bibliothek deutscher Geschichte“, welche H. v. Zwiedineck-Südenhorst in Verbindung mit einer Anzahl hervorragender Gelehrter herausgiebt. Aber, so vorzügliche Darsteller die Mitarbeiter dieses Werkes auch zumeist sind, es ist doch schon vermöge seines Umfangs und seines Preises auf engere Kreise beschränkt, und bei der Sorgfalt, die darauf verwendet wird, dürfte seine Vollendung auch noch nicht so bald zu erwarten sein.
Inzwischen ist ein Buch erschienen, welches angesichts der geschilderten Sachlage sehr am Platze ist, ein Buch, welches in knapper gedrängter Darstellung das Wesentliche unserer Geschichte nach dem neuesten Stande der Forschung verzeichnet, dem Wißbegierigen aber, der über einen einzelnen Zeitraum sich näher unterrichten will, Schritt für Schritt die genaueren und eingehenderen Werke nachweist, damit er sich dort weiteren Rath hole. Es ist das „Handbuch der deutschen Geschichte“, herausgegeben – ebenfalls in Verbindung mit einer Anzahl namhafter Fachmänner – von Bruno Gebhardt (Stuttgart, Union). Wir denken uns dieses Werk insbesondere von Werth in der Hand des Lehrers. Es giebt ihm für seinen Vortrag das feste Gerüste und bietet ihm in den Litteraturangaben die Möglichkeit, nach Geschmack und Bedürfniß dieses Gerüste mit den Ranken lebendiger Einzelschilderung zu umwinden. In Lehrer- und Schülerbibliotheken sollte es darum nicht fehlen. Aber auch sonst wird es im gebildeten Bürgerhaus ein willkommener Führer sein durch unsere vaterländische Geschichte.
Die Bienenzucht in Deutschland. Die Arbeit des kleinen Bienenstaats liefert einen größeren volkswirthschaftlichen Ertrag, als man in der Regel anzunehmen geneigt ist. Als im Jahre 1883 dem preußischen Abgeordnetenhaus ein Gesetzentwurf über das Halten von Bienen vorgelegt wurde, der später allerdings abgelehnt worden ist, kamen auch die Erträgnisse der Bienenzucht zur Sprache. Sie belaufen sich in Preußen allein auf jährlich 17 Millionen Mark, während das Jagderträgniß nur auf 12 Millionen veranschlagt wird. Im Deutschen Reiche standen 1890 ungefähr zwei Millionen Bienenstöcke, und wenn für jeden ein durchschnittlicher Jahresertrag von 15 Mark angenommen wird, so liefert der Bienenschatz im Deutschen Reiche jährlich nicht weniger als 30 Millionen Mark. Uebrigens genügt der im Reiche erzeugte Honig nicht einmal dem Bedürfniß, und es wird jährlich für etwa sechs Millionen eingeführt. Respekt also vor den kleinen Bienen, deren Arbeiterstaat in Bezug auf seinen Ertrag mit großen Industrien wetteifern kann und die ganze Beute der Jagdlust in Schatten stellt. †
In den Niederlanden und in Frankreich wird das Damespiel auf einem 100feldrigen Brett gespielt, auf dessen ersten 4 Felderreihen die beiden Gegner je 20 Steine aufstellen.
Die Regeln sind dieselben, wie die in der üblichsten deutschen Spielart gültigen, nur mit dem Unterschiede, daß ein Spieler, der am Zuge ist, wenn er Gelegenheit hat, in verschiedener Art zu schlagen, diejenige wählen muß, in der die meisten Stücke geschlagen werden. Als Beispiel möge nebenstehende Aufgabe dienen.
Für die Bezeichnung der Züge empfiehlt sich die im Schachspiel gebräuchliche. Die senkrechten Felderreihen werden durch Buchstaben, die waagerechten durch Zahlen besetzt, so daß jedes Feld durch einen Buchstaben und eine Zahl benannt wird.
Annagrammaufgabe.
1. Liter. 2. Vater. 3. Dohle.
4. Kanin. 5. Horsa. 6. Raute.
7. Hagar. 8. Treue. 9. Hader.
In jedem der obigen Wörter ist ein Buchstabe zu ändern und dann durch Umstellen der Laute ein neues Wort zu bilden. Die zu suchenden Wörter haben – in anderer Folge – folgende Bedeutung: 1. Stadt in Kroatien, 2. griechische Insel, 3. Begründer der rationellen Landwirthschaft, 4. türkische Insel, 5. Berg in Afrika, 6. deutscher Dichter (Freund Klopstocks und Lessings), 7. holländische Festung, 8. römischer Lyriker, 9. deutscher Kulturhistoriker. – Werden nach richtiger Lösung die gefundenen Wörter in der ursprünglichen Reihenfolge buchstabenweise in die senkrechten Reihen obiger Figur eingetragen, so erscheint an der Stelle der Ziffern der Titel einer Erzählung von H. Schmid. A. St.
Doppelräthsel.
Ans obigen 21 Buchstaben sind sieben dreistellige Wörter von folgender Bedeutung zu bilden: 1. Stadt in Südeuropa, 2. Frauengestalt aus dem Nibelungenlied, 3. Getränk, 4. Waffe der alten Deutschen, 5. Fluß im Westen Deutschlands, 6. chemisches Element, 7. Natur- und Kunstprodukt. Aus jedem der gefundenen Wörter ist dadurch ein neues Wort zu bilden, daß je zwei der folgenden 14 Buchstaben an den Anfang derselben gestellt werden: a e e f g h m n n r s t t t. Werden die fünflautigen Wörter buchstabenweise untereinander geschrieben, so nennt die zweite senkrechte Reihe eine Stadt in Persien.
Arithmetische Aufgabe.
Der Geburtstag eines deutschen Dichters liegt im vorigen Jahrhundert und ist durch folgende Angaben zu berechnen. Die Monatszahl ist 218 Mal in der Jahreszahl enthalten und die Datumszahl (d. i. der Tag im Monat) ist um 1 größer als das Dreifache der Monatszahl.
Welches deutschen Dichters Geburtstag ist gemeint und wann war derselbe?
Verwandlungsaufgabe.
Durch fortgesetztes Hinzufügen je eines Buchstabens und Umstellen der übrigen Buchstaben sollen, von dem Vokal E ausgehend, die in den vier Flügeln dieser Figur stehenden Wörter „Bulgare“, „Belgier“, Spanier“ und „Friesen“ gebildet werden. Die noch fehlenden Zwischenstufen bestehen sämmtlich aus Hauptwörtern. Beispiel: R, ER, REH, Hera, Recha, Drache, Drachme. Die vierlautigen Zwischenstufen bedeuten: 1. einen biblischen Namen, 2. einen Gott der alten Griechen, 3. ein Metall, 4. eine Person aus Schillers „Wallenstein“. A. St.
In dem unterzeichneten Verlag ist erschienen und durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen:
Von Professor Dr. Carl Ernst Bock. Siebente Auflage, neu bearbeitet von Dr. Max von Zimmermann..
Eine kurze Anleitung zur Kenntniß des menschlichen Körpers und seiner Pflege im gesunden und kranken Zustand, wie sie „Bock’s Kleine Gesundheitslehre“ bietet, ist für Jedermann unentbehrlich, der auf die Erhaltung des ersten und wichtigsten Gutes, die Gesundheit, Werth legt.
„Bock's Kleine Gesundheitslehre“ ist in den meisten Buchhandlungen zu haben. Wo der Bezug auf Hindernisse stößt, bestelle man unter Beifügung von 1 Mark und 20 Pf. (für Porto) in Briefmarken direkt bei der
- ↑ Ein Bergknappe, der die geförderten Erze auf einem kleinen Wagen (Hund) hinwegschafft.
- ↑ Jede Schicht eines Arbeiters wurde in zwei aneinander gelegten Stäben durch eine Kerbe verzeichnet; den einen Stab behielt der Aufseher, den anderen der Arbeiter.
- ↑ Aufseher.
- ↑ Theophilus – der Gott Liebende.
- ↑ Niemals zurück!