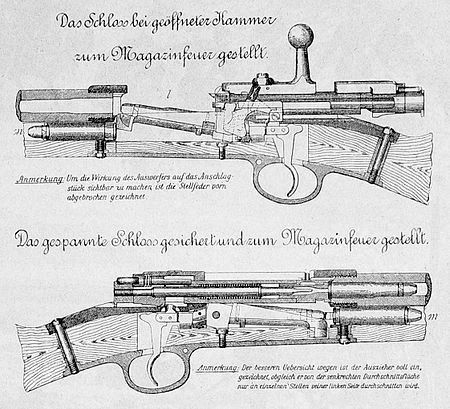Die Gartenlaube (1887)/Heft 22
[353]
| No. 22. | 1887. | |
Illustrirtes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Wöchentlich 2 bis 2½ Bogen. – In Wochennummern vierteljährlich 1 Mark 60 Pfennig oder jährlich in 14 Heften à 50 Pf. oder 28 Halbheften à 25 Pf.
Götzendienst.
Von da ab fühlte Eff, daß er dem Namen verfallen war, daß der lächerliche Götze über den Frieden seiner Zukunft und über ihr gemeinsames Glück zu entscheiden hätte.
Des Namens selbst geschah keine Erwähnung. Frau Belzig hielt an sich; sie wollte die Adoption langsam heranreifen lassen, bis es Zeit wäre, sie zu pflücken. Die häßliche Grafenaffaire hatte sie gewarnt – nicht ein zweites Mal solch’ ein Fiasko!
Aber der Name war da. Er hing in der Luft, er lauerte überall. Eff war alarmirt; aus den unscheinbarsten Worten und Dingen glaubte er das Klingeln der Schellenkappe herauszuhören.
Frau Belzig’s Liebenswürdigkeit ihrem Schwiegersohn gegenüber schien keine Grenzen mehr zu kennen. Sie überschüttete ihn fast zum Ersticken damit. Lauter hübsche kleine und große Aufmerksamkeiten und glänzende Ueberraschungen. So fand er den mit Fahrplänen tapezierten „Wartesaal“ seiner Junggesellenwohnung eines Tages mit Teppichen, Vasen und Blumen salonmäßig ausgeputzt; ein kostbares englisches Vollblut war plötzlich in seinen Stall hineingezaubert zur großäugigen Verwunderung seines alten braven soliden Ostpreußen – „Aber mein lieber Walther, es ist doch nicht der Rede werth!“ beruhigte ihn Frau Belzig; „meinem Mann und mir macht es Spaß; Sie werden uns die Freude doch nicht verderben!“ – Aber seltsam, ärgerlich, wieder gespenstisch: – jedesmal, wenn er das Vollblut bestieg, kam ihm der Gedanke an den Namen hergeflogen. Der Klang desselben tönte ihm aus dem Hufschlag entgegen: man will ihn mit all’ den Liebenswürdigkeiten verpflichten; wehrlos will man ihn damit machen! Aber zum Teufel, wo ist er denn, dieser Name? Her damit! Daß er sich doch endlich zeigt und daß man doch Stellung gegen ihn nehmen kann! So oder so!
Natürlich hatte Frau Belzig nichts unversucht gelassen, um auch Adolf Eff in den Wirkungsbereich ihrer Attentate zu ziehen. Aber der Erfinder entzog sich diesen Versuchungen mit einer diplomatischen Zurückhaltung. Wollte er sich für einen Hauptkoup aufsparen, den er mit seinen völlig ausgereiften Projekten eines schönen Tages auf den Arnheim des „Unzerreißbaren“ auszuführen gedachte? Insgeheim verwünschte er den „gräflichen Windhund“ (er gebrauchte viel schlimmere Ausdrücke), der diesen Arnheim so hatte bluten lassen. Jetzt war wohl nicht der Augenblick, diese Kasse, die soeben erst ihre Fünfzigtausend an das Hirngespinst eines Namens verschleudert, um das andere Hirngespinst einer Erfindung in Anspruch zu nehmen. Vielleicht war auch ein wenig die verschüchterte Zimperlichkeit seiner Frau schuld an der Zurückhaltung. Die kleine
[354] Frau, die sonst so tapfer der Noth in die Augen sah, war ein paar Mal tief unglücklich von den Belzig’s zurückgekehrt, sie gelobte, nicht mehr hinzugehen; sie könne die Luft dort nicht ertragen, nicht den Gegensatz der glücklichen Behäbigkeit und der eigenen elenden Zigeunerwirthschaft. Sie wollte zu Hause sitzen und weinen. Nicht, daß sie die paar Tausend ihres Vermögens bejammerte, die sie aus der zehnfachen Theilung des kleinen väterlichen Gutes mit in die Ehe gebracht und die mit den Projekten aufgeflogen waren; nicht, daß sie sich über die bittersten Stunden des Elends beklagte, wo sie buchstäblich hungerten – nicht das! Aber sie begann nun ernstlich an dem Genie ihres Mannes zu zweifeln, das sie bisher mit solcher Unerschütterlichkeit angebetet; sie hatte nun, so sehr sie sich dagegen wehrte, mit dem wachsenden Bewußtsein zu kämpfen, daß sie ihr junges Leben an einen Phantasten verloren. Sie saß den Tag über in der dumpfen Hofstube bei irgend einer nutzlosen Handarbeit, während ihr Gatte mit seiner Papierrolle immer nach neuen Aussichten umherlief oder am Zeichentische neue Pläne für die unersättlichen Patentämter fabricirte.
Walther hatte sich erboten, was in seinen einstweilen nur geringen Kräften stände, zur Besserung ihrer Lage beizutragen. Sie sollten das Loch ihrer Wohnung mit einem helleren und komfortableren Unterschlupf vertauschen. Sie wären ihm und seiner Verwandtschaft mit den Belzig’s dies schuldig! Später – und er deutete auf seine Heirath hin – würde sich schon Alles machen.
Bei Adolf pflegte sich dann eine Art grimmigen Humors Luft zu machen; er kehrte offen seinen Bettlerstolz heraus und rühmte sich seines Elends – der Petroleumlampe, die bei ihnen am hellen Tage brennen mußte, des erbärmlichen Kredits, der nun plötzlich gänzlich versagt hatte.
Die Sorge um den Bruder und seine Familie begann Walther mehr und mehr zu verstören. Man mußte es ihm bei den Belzigs anmerken; ein paar Andeutungen entschlüpften ihm – vielleicht hätte es nur ein Wort gekostet und es wäre Rath geschafft worden. Aber es widerstrebte ihm, das Wort auszusprechen. Er vertröstete sich auf seine Heirath, dann wollte er Jenem schon zu helfen wissen.
Nur vor Melitta vermochte er nicht Alles zu verheimlichen. „Aber warum hast Du es Papa nicht schon längst gesagt?“ rief das gute Kind. „Ihm muß doch geholfen werden!“
„Ich will nicht! Nein, das nicht! Du versprichst mir, Litta, daß Du kein Wort sagen wirst!“
Natürlich, dem Versprechen zum Trotz, waren beide Belzigs zwei Stunden später unterrichtet. Frau Belzig bestand darauf, daß sofort geholfen würde. Sie hatte solche Angst vor einer neuen Katastrophe – und man wüßte nicht, wie solch ein Projektmacher sie Alle kompromittiren könnte.
Nach einigen Tagen hatte der seufzende, aber doch schon seiner Brunnenkur wegen gehorsame Belzig einen Ausweg gefunden. Er nahm Eff in eine Fensternische.
„Ich höre, Ihr Herr Bruder sucht nach einer Gelegenheit, sich zu etabliren. Man rühmt mir ihn als eine außerordentlich tüchtige Kraft (Herr Belzig schluckte ein wenig an dem Satz, aber er brachte die liebenswürdige Lüge doch heraus). Ich hätte ’was für ihn – lassen Sie mich ausreden! Es steht in Moabit eine Fabrik zum Verkauf. Ein Protégé von mir sucht einen Kompagnon. Wie wäre es, wenn Ihr Bruder einspränge? Ich habe eine Kleinigkeit zu placiren, und ich würde mich natürlich nur in aller Stille betheiligen. Sie wie Ihr Bruder thäten mir einen großen Gefallen. Die Fabrik geht, wir werden sie schon hoch bringen! – Christbaumartikel, Lametta, Kerzenhalter, Sterne, selbst Christkindchen – ein erfinderischer Kopf wie Ihr Bruder ist da gerade am Platz.“
Walther jubelte fast auf vor Freude. Sofort griff er danach. Welch gute Menschen! Er sah nur die Güte und hatte keinen Arg, daß hinter dieser irgend ein Motiv steckte, das auf Weiteres, ja auf einem Umwege nach dem Namen hinzielte. Er eilte nach der Jägerstraße.
Als er die Treppe hinaufstieg, schallte ihm schon die helle Kinderstimme seines kleinen Neffen entgegen, der droben im Korridor des dritten Stockes auf einem Spazierstock hin und her galoppirte. Ein prächtiges Bürschchen mit den fröhlichsten Augen, das mit seinen strotzenden Bäckchen gar nichts von einem eingesickerten Kredit im Milchkeller zu wissen schien. Es freute sich unbändig über die Tüte, die ihm sein Onkel mitgebracht, und galoppirte mit Jubelgeschrei in die Stube.
Frau Eff saß beim röthlichen Schein einer Lampe und stickte. Die kleine Stube empfing vom Tage wirklich nicht mehr Licht als ein Keller. Die Hälfte des einzigen Fensters war einer durch eine Tapetenwand abgetrennten Nebenstube zugetheilt, und die andere Hälfte blieb durch die schmutziggraue Wand eines Vorbaues verdeckt.
„Wie geht’s, meine liebe Schwägerin?“
Wie die kleine Frau aufsprang! Es war ihr jedesmal, als brächte der Schwager mit seiner freundlichen Miene etwas von der Tageshelle in das Verließ. Sie entschuldigte wie üblich die Unordnung des Raumes und strich sich über das mattblonde Haar.
„Wie geht’s?“
Sie hob die dünnen Schultern in dem viel zu weiten Morgenrock.
„Nun, man könnte anfangen aufzuathmen,“ seufzte sie – aber sie zuckte von Neuem mit den Schultern. „Er hat eine Stelle als Zeichner in einem technischen Bureau angenommen, für heute und morgen – länger hält er es doch nicht aus. Die Projekte, die unseligen Projekte! Bitte, nehmen Sie Platz.“
Er fuhr, ohne sich zu setzen, mit der freudigen Ueberraschung heraus.
Die kleine Frau war ganz bestürzt vor Freude. Die hellen Thränen stürzten ihr aus den Augen, und sie hielt Eff’s Hand mit ihren beiden krampfhaft umklammert, als könnte ihr das unerwartete Glück mit dieser Hand entschlüpfen. „Wie ist es möglich! Nicht möglich …“ stammelte sie.
Da nahten Adolf’s hastige Schritte im Flur. Er warf beim Eintreten die Papierrolle auf den Tisch, daß sie hohl erklang. „Du hier?“ sagte er ohne weiteren Gruß zu Walther.
Und zu seiner Frau gewandt, deren Thränen er gewahrte: „Was hast Du nur wieder? Es ist doch nicht zu ändern!“
Er warf den Hut neben die Rolle. „Ich habe natürlich die Sache wieder aufgegeben. Eine Holzhackerarbeit, und man kommt sich ganz dumm dabei vor!“
Sie überhörte es. „Denk’ Dir, Adolf – welch eine Ueberraschung! Man bietet Dir eine Fabrik an! Welch ein Glück! Der liebe Gott läßt uns doch nicht im Stich!“
„Man muß sich selber nicht im Stich lassen,“ brummte er mit spöttischen Falten um die vom zerzausten Schnurrbart überhangenen Lippen.
„Aber, Adolf verstehst Du denn nicht?“ jammerte sie. „So höre doch!“
Er that noch ein paar Schritte und blieb dann stehen, auf Walther’s Mittheilung hinhörend, doch ohne den Sprecher anzusehen.
„Eine Fabrik – eine Fabrik – i wo!“
Es kam ihm gar nicht zu märchenhaft vor, und er that ein paar ganz nüchterne, geschäftsmäßige Fragen über diese vom Himmel gefallene Fabrik, die ihm Walther nur zur Hälfte beantworten konnte.
„Die Hauptsache ist aber doch, daß Du Dich freust, Adolf!“ rief dieser ungeduldig. „Die Hauptsache ist doch, daß Ihr aus Eurem Elend herauskommt!“
„Lametta – Kerzenhalter – Christkindchen –“ murmelte Adolf, wieder das Zimmer mit großen Schritten messend. „Hm!“
Die Beiden sahen ihn mit wachsendem Staunen an.
Plötzlich hielt der Erfinder vor ihnen, und mit einem geradezu unheimlichen Grinsen seiner gelblichen Zähne platzte er heraus:
„Und mein Aspirator? Mein Aspirator? Was wird aus dem? Wie?“
Er reckte sich in die Höhe und kam sich ungeheuer groß vor in diesem Augenblick. Er schien sich an ihrer Starrheit zu weiden.
Dann lief er wieder die vier Schritte vom Sofa bis zur Thür und zurück.
„Ein Dreier das Schäfchen!“ äffte er höhnisch. „Das fehlte noch! – Ein Dreier das Schäfchen!“
„Mensch!“ donnerte ihn Walther an. „Du bist dem Verhungern nahe, man offerirt Dir eine Fabrik und Du hängst Dich an Deinen Blasebalg …“
[355] „Ich habe Dir schon wiederholt gesagt, Walther, daß ich derlei Redensarten …“
„Du hast Dich nun zu entscheiden,“ unterbrach ihn Walther mit schärfster Stimme; „willst Du, oder willst Du nicht – willst Du nicht, so …“
Frau Eff saß mit offenem Munde wie versteinert. Sie stierte voll Entsetzen den Hin- und Herwandelnden an.
Walther vollendete für sich: „So wird man Dich in eine Anstalt einsperren!“
„Warum soll ich nicht? – Warum soll ich nicht?“ antwortete Adolf zögernd. Das Grinsen auf seinem Antlitz verschwand. Er meinte es ja nicht so schlimm – sie hätten ihn doch kennen müssen, den Bramarbas, der in diesem Erfinder steckte.
„Nicht übel,“ lenkte er ein, aber doch immer noch die Schultern mitleidig zuckend. „Ich könnte ja nebenher meinen Aspirator … übrigens lassen sich allerlei hübsche kleine Dinge in der Branche konstruiren.“
Die Manie des Erfinders hatte sich schon sofort auf die neue Beute gestürzt, und es schossen in seinem Gehirn bereits allerlei krause Plänchen umher: ein sich selbst drehender Christbaum, ein selbstsingendes Christkindchen, ein sich selbst anzündender Baum und Anderes.
Das Staunen der Beiden verlor sich allmählich in einem Lachen über das spaßhafte Kaleidoskop seiner Erfindungen, das er vor ihnen glitzern ließ; er wollte schon den Weihnachtsbaum des nächstjährigen Festes zu einem staunenswerthen Wunderding umgestalten!
Natürlich war er nicht so schlimm, wie er sich gab. Und die Freude über Belzig’s Offerte kam auch bei ihm zum aufrichtigen Durchbruch. Aber zuletzt verdarb er doch wieder die frohe Stimmung.
„Apropos,“ sagte er, seine sehnige, nervös ausgearbeitete Hand auf des Hauptmanns Schulter legend, „wir werden uns doch den Belzigs gegenüber revanchiren müssen, nicht? Wir müssen ihnen einmal wieder einen Gefallen thun! Ich höre durch Perkisch (Walther runzelte die Stirn bei dem Namen), daß man ihnen einen ungeheuren Gefallen thun könnte –“
„Und was!?“ rief Walther verwundert.
„Du thust wie ein Waisenknabe. Merkst Du denn nicht? Die Sache ist doch sehr einfach! Du könntest sie nicht glücklicher machen, als wenn Du Dich adoptiren ließest. Du weißt, von wem.“
Walther warf die Hand mit einem Ruck von seiner Schulter.
„Ich bitte mir aus, Adolf, daß Du solche Scherze lässest!“ brauste er auf.
„Nun, nun, was wäre dabei? Unser Name ist doch so sehr hübsch nicht … mir ist er längst gut genug – auch wird ihn mein Eff-Aspirator herausreißen – aber Du …“
„Laß das!“ drohte Walther.
Adolf aber ließ nicht nach:
„Ich meine, Du könntest wohl einen hübscheren Namen gebrauchen. Wir wären Dir nicht böse; Tante höchstens, für die es keinen schöneren Klang auf der Welt giebt, als unsern Namen. Geschmackssache! Ich meine, Du könntest nichts Gescheiteres thun, als umsatteln. Uebrigens machst Du sie Alle dort glücklich damit. Du kennst die Weiber noch nicht. Glaubst Du, daß man Dir Ruhe lassen wird, so lange der Name zu haben ist?“
„Ein- für allemal, laß den Unsinn!“
Und Walther gab sich ungeheure Mühe, recht aufgebracht zu scheinen. Er log sich selbst vor, daß er es sei, als er die Treppe hinunterstieg. Doch aus dem Klirren seiner Sporen klang schon wieder die ehrwürdige Jahreszahl 1295.
Olga von Gamlingen hatte am Morgen im Komptoir die Nichtablieferung einer fälligen Kolorirung entschuldigen lassen: ihr Vater sei seit gestern erkrankt.
Herr Belzig war beim Dejeuner mit einem Kopf voll Geschäftssorgen erschienen, und so kam es, daß er die Nachricht von der Erkrankung erst beim zweiten Gange in die Unterhaltung hineinwarf.
„Krank?, O!“ rief Frau Belzig kurz auffahrend. Das war wohl nur erst der Ausdruck eines rein äußerlichen, zerstreuten Bedauerns, den uns die stereotype Wohlerzogenheit auf die Lippen drängt.
Melitta fiel gleichfalls mit einem „O!“ ein. Eff, der mit zu Tisch war, horchte theilnehmend auf.
„Woher weißt Du? – Es ist doch nicht schlimm?“ fragte Frau Belzig gleich hinterher. Dies konnte eher schon einen Klang aus dem Herzen, ein Stück wirklicher Theilnahme bedeuten.
„Die Kleine ließ es heute Morgen im Komptoir vermelden; seit gestern hat er sich gelegt.“
Frau Belzig lehnte Gabel und Messer mit einem leichten Nachdruck gegen den Rand des Tellers.
„Wie Du bist, Belzig! Heute Morgen? – Und seit gestern ist er krank! – Warum hast Du uns das nicht eher mittheilen können?“
Sie ließ die Hände auffällig vom Tische herab in den Schoß sinken, um ihr Erstaunen über seine Nachlässigkeit zu bekräftigen. Dies war der volle Alarm: wenn der Freiherr stirbt, so haben wir, die wir auf seinen Namen lauern, die wir bereits darauf Beschlag gelegt zu haben glauben, einfach das Nachsehen!
„Ich werde hingehen und mich erkundigen,“ beschwichtigte Melitta mit einer gewissen Hast. „Ich wollte Walther ein Stück bis nach dem Königsplatz begleiten; ich werde statt dessen hingehen. Es wird wohl nicht so schlimm sein!“
Frau Belzig schien das nicht gehört zu haben. „Friedrich!“ rief sie aufgeregt.
Friedrich, der hinter ihr gestanden, glitt mit einem tonlosen „Gnädige Frau!“ an ihre Seite.
„Lassen Sie gleich nach Tische anspannen! – Ich werde selbst nachsehen; man darf das arme Ding, die Olga, doch nicht im Stiche lassen!“
Gleich aber faßte sie sich, daß die Andern nichts von ihrer geheimen Sorge merkten: „Olga ist zwar sonst ein resolutes Ding …“
„Ich dachte, Du hättest heute Deine Bazarsitzung,“ warf Herr Belzig ohne jede Absicht ein.
„Ah so!“ Sie hatte das vergessen. „Nun, es ist ja nur ein Moment! Ich mache nur den Umweg!“
„Ich begleite Dich, Mama!“
„Wie Du willst, mein Kind. Wenn Sie ihr Urlaub geben, Walther! Nun, ich dächte aber, ein Spaziergang thäte Dir besser. Ich werde allein fahren.“
Noch ein heuchlerisches Lächeln der Zärtlichkeit schenkte sie dem Paar; dann richtete sie mit einem sichtlichen Zwange das Gespräch auf ein anderes, gleichgültiges Thema.
Doch die Nachricht von der Erkrankung des Freiherrn schlich wie ein Schatten durch das Gespräch. Herr Belzig war ein wenig verdutzt geworden: welch’ ein Wesen seine Frau aus der einfachen Erkrankung zu machen im Stande wäre; nun, er pflegte über solche Dinge nicht tiefer nachzudenken, und sein zerstreutes Kopfschütteln, welches das Unbegreifliche eben unbegreiflich ließ, glitt über den Fall hinweg.
Aber Frau Belzig’s Tochter? – Melitta fiel es schwer, die Unbefangenheit aufrecht zu halten. Sie hatte sich so erschreckt über sich selbst – nicht einmal über die Krankheit! Wie ein Blitz hatte es ihre Seele gestreift. Da ist ein Leben in Gefahr, das Leben eines Freundes, des besten sympathischsten Menschen, und man bekommt eine Gier, ihn am Mantel festzuhalten, daß er nicht entwischt – nicht des Menschen wegen, nein, des Mantels wegen! Es schauderte sie: Heiliger Gott! wie ist das häßlich! Bin ich denn solch ein Ungeheuer?
Und Frau Belzig’s Schwiegersohn? Mit einer betäubenden Deutlichkeit waren gewisse Gedanken vor ihm aufgezuckt: – wenn das eintrifft, wenn der Freiherr stirbt – dann ist ja jene Sache am einfachsten erledigt; dann hört der Alp auf; dann giebt es keine Versuchung mehr; dann brauche ich nicht Ja! und nicht Nein! zu sagen; dann geschieht meinem Namen kein Unrecht; dann habe ich später nichts zu bereuen; dann mache ich mich nicht lächerlich; dann ist auf einmal der Schatten, der sich zwischen mich und sie stellt, verweht – ja, es ist die einfachste Erledigung …
Frau Belzig war nach ein paar Stunden zurückgekehrt. Sie hatte die Komitésitzung aufgegeben. Das wollte viel sagen; denn sie hätte dort einen Nachmittag über in der Gesellschaft von einigen Excellenzen, einigen wirklichen und unwirklichen Geheimräthinnen und ein paar Damen aus der höheren aristokratischen Luftschicht, die sogar an den Hof heranreichte, über das Wohl [356] von einem Dutzend frischbekehrter Heidenseelen zu berathen gehabt. Aber der Krankheitsfall drängte alles Andere bei Seite.
Es ginge schlecht, sehr schlecht! Es wäre Alles zu befürchten! Sie vergaß im ersten Augenblick ihre Aufregung zu verbergen. Als wenn es sich um eins der Ihren gehandelt, so mächtig war sie erregt.
Es wäre irgend etwas hier in der Brust nicht in Ordnung; aber man müßte erst den Medicinalrath hören. Sie hatte fast zwei Stunden damit verbracht, den Freiherrn mit seinem „ze … ze … ze …“, das jetzt so matt klang, zu bereden, daß ihr Medicinalrath herbeigezogen würde. Der Kranke wollte nichts davon wissen, seinen biederen alten Oberstabsarzt, einen a. D. wie er, der sich so aufopfernd die Mühe gab, die vier Treppen hinanzukriechen, mit seiner wankenden Hand nach dem Puls zu fühlen und ein Recept nach dem anderen hinzukritzeln durch einen dieser hochtrabenden modernen Besserwisser mit ihren erschreckenden Honoraren ins zweite Glied zu rücken. Dann war sie selbst nach der Behrenstraße zu ihrem Medicinalrath geeilt und hatte in dem fürstlich ausgestatteten Wartezimmer fast eine halbe Stunde gewartet, um persönlich den kostbaren Mann um die große Gnade eines sofortigen Besuches bei dem Kranken anzuflehen.
Darauf zu den Diakonissinnen! Hier hatte sie Glück gehabt: Schwester Jemina war eben von einem Sterbebett zurückgekehrt, wo sie vier Tage und Nächte ununterbrochen gewacht. Schwester Jemina, eine Komtesse R., war in allen aristokratischen Krankenstuben besonders beliebt, eine zarte Gestalt mit wachsgelbem Teint und verblaßten Augen, von puppenhafter Sauberkeit; sie schlief nie und sprach nichts; den Gegenständen, die sie berührte, schien sie vollkommene Klang- und Geräuschlosigkeit anzuzaubern.
Der Medicinalrath hatte Nachricht über den Zustand des Kranken versprochen, doch die Nachricht kam nicht. Frau Belzig hielt es nicht mehr aus: diese Angst um den Namen, den ihr der Tod mit höhnischem Grinsen zu entreißen drohte, und die qualvolle Heuchelei, die Angst zu verbergen! Heimlich, noch spät am Abend, da sie Gesellschaft hatten, sandte sie Friedrich nach der Derfflingerstraße. Der Kranke schliefe, berichtete der zurückkehrende Diener, die Schwester Diakonissin wäre da – der Assistent des Herrn Medicinalraths hätte vor einer Stunde seinen Besuch gemacht – das Fräulein arbeitete.
„Vor einer Stunde erst? Nicht möglich! – und nicht der Herr Medicinalrath selbst?“
Frau Belzig war sehr aufgebracht über die Unzuverlässigkeit des Medicinalraths. Aber es ist nichts dagegen zu machen, man darf es mit dem hohen Herrn nicht verderben, und man muß sich geduldig in sein Belieben fügen. Uebrigens, wenn es wirklich noth thut, ist er als Retter ja doch zur Stelle!
Und ihre Gedanken verließen nicht mehr den vierten Stock in der Derfflingerstraße, während sie lachte und plauderte und mit anscheinender Begeisterung dem Spiel eines bekannten Pianisten lauschte, der zu Gast war.
Vor dem „Goldenen Stiefel“ in der Derfflingerstraße hielt ein eleganter Doktorwagen – der Medicinalrath! Gott sei Dank!
Frau Belzig war in dem nassen Schneeschlamme, jetzt um die elfte Morgenstunde, zu Fuß hingeeilt, daheim brauchten sie nichts von dem Gang zu wissen.
Auf der Treppe begegnete ihr der Assistent.
„Wie geht’s denn dort oben, Herr Doktor?“ ries sie hochathmend dem herabeilenden Arzt entgegen.
„Ah Sie, gnädige Frau!“ warf er in seiner breiten ostpreußischen Aussprache hin. Er hatte sie offenbar noch nicht erkannt, nur dieses sonoren Alts erinnerte er sich, auch blieb es bei dem halbausgeführten Versuch, den tief im Nacken des rauhen schwarzen Kopfes sitzenden künstlermäßigen Rundhut zu lüften.
„Sie sind verwandt mit Herrn Gamlingen?“
Er gehörte dem scharfen Fortschritt an und suchte etwas darin, das „von“ und das „Baron“ und dergleichen mittelalterlichen Firlefanz einfach von dem Namen des Patienten zu streichen; später, wenn er etablirt wäre, würde er auch die Titel herausschneiden!
Ohne die Antwort abzuwarten, ließ er zwei wunderschöne, volltönende lateinische Namen durch den Treppenflur erschallen, hob die breiten flachen Schultern und senkte das Stachelgesicht fast wagerecht auf die eine Schulter. „Man muß abwarten – Herr Gamlingen ist kein Jüngling mehr!“
So stand es! Das war deutlich genug! Der Kranke war also nicht zu retten! – Also der Name fort – verloren, vernichtet! Es war zu spät!
Sie fühlte eine plötzliche Schwäche in den Knieen, als sie weiter hinaufstieg, und sie mußte auf dem Absatz des dritten Stockes anhalten. Eine gewaltige Blutwelle fluthete ihr zum Kopf, sie fühlte das Erniedrigende ihres Beginnens.
Wie ein flüchtiger Traum stand die Geschichte eines Processes vor ihr, die sie vor vielen Jahren gelesen. Eine Erbschleicherei, wie ein Weib das Sterbelager eines alten Mannes viele Tage und Nächte belagert, um ein paar elender Banknoten willen … Ist sie nicht selbst eine solche Verbrecherin? Zwar nur ein Name, ein Hauch – ein Nichts – aber dies Nichts wiegt für sie den Inhalt eines Geldschrankes auf! – Ist sie nicht gekommen, um diesen Namen zu – erschleichen? Das ist das richtige Wort! Eine ungeheure Scham befiel sie. Sie legte eben die Hand auf die abgegriffene Geländerlehne, um weiter zu steigen; doch die Hand zuckte zurück: ich darf nicht hinauf! ich will nicht so dort erscheinen!
Und eine Furcht ergriff sie vor den großen blauen Kinderaugen Olga’s und vor den stillen verblaßten Dulderaugen Schwester Jemina’s, als wenn diese sofort erkennen würden, weßwegen sie käme.
Sie wollte umwenden und wieder hinabsteigen, man würde ihr Kommen und Gehen nicht bemerkt haben – da tönte das Klirren von Sporen die Treppe herauf. Ihr Schwiegersohn! – Welch eine Ueberraschung!
Nun, sehr einfach. er wollte, ehe er sich in den Dienst begab, den kleinen Umweg nicht scheuen, um sich nach dem Befinden des Oberstlieutenants zu erkundigen und seiner Schwiegermama am Mittag zu berichten. Eine Liebenswürdigkeit, die bei ihm fast selbstverständlich war und gar nichts Auffallendes hatte.
Aber wie sie seine hohe Gestalt ruckweise auf den Stufen vor sich aufsteigen sah, durchfuhr sie ein schneller Gedanke: kommt – kommt er auch deßwegen?!
Doch nur ein Blick in sein offenes Antlitz, nur der Klang seiner sympathischen Stimme, und gleich scheuchte sie den Gedanken fort.
„Haben Sie Nachricht? – Kommen Sie oder gehen Sie, liebe Schwiegermama?“
„Ich wollte eben hinauf, mich zu erkundigen,“ stammelte sie, noch ganz überrascht. „Der Arzt, den ich eben traf scheint durchaus nicht zufrieden.“
Der Hauptmann war stehen geblieben und sah sie bestürzt an. Es war wirklich nur der ehrlichste, aufrichtigste Ausdruck inniger Theilnahme, nichts weiter!
Aber gerade dieser Ausdruck war es, der von Neuem den Dämon in ihr erweckte. wenn es dennoch nicht zu spät wäre! Wenn der Zufall dieses Zusammentreffens ein Fingerzeig wäre, daß dennoch Alles versucht werden müßte, den Namen zu retten! Was ließ sich vielleicht nicht durch Mitleid und Theilnahme und die Gunst der Stunde erreichen …
Und sie stiegen gemeinsam die Treppe hinan.
Wie war doch Alles geschehen?
Er hatte nicht mit eintreten und nur an der Thür nachfragen wollen, wie es stehe, aber seine Schwiegermutter bat ihn, „einen Moment“ zu warten, sie käme selbst gleich wieder mit.
Der Kranke lag in der großen Stube. Man hatte ihn auf Geheiß des Doktors aus dem dumpfen Alkoven nach dem luftigen Raum herübergebettet. Während Frau Belzig dort eintrat, um selbst nach dem Kranken zu sehen, war Eff in der Nebenstube am Fenster stehen geblieben und schaute in das Schneegestöber hinaus.
Er hörte von der nahen Küche her Olga’s trippelnden Schritt und die vorsichtige Hantirung mit den Geschirren. Aus der halbgeöffneten Thür des Krankenzimmers kamen unregelmäßig an- und abschwellende Athemzüge, dazu ein unterbrochenes Flüstern.
Frau Belzig’s kräftige Stimme hatte Mühe, sich mit dem Zwang des Flüstertones abzufinden. Walther unterschied einzelne Worte, es war von Olga die Rede. Gewiß eine Andeutung, daß der Kranke sich des Kindes wegen keine Sorgen machen solle. Wieder wurde es still – dann war es Walther, als käme sein eigener Name von dort hergehuscht.
[357]
[358] Sein Name! Was bedeutet sein Name dort? Er hatte zuerst nicht den geringsten Verdacht, daß es das wäre und daß es sich darum handelte!
Plötzlich stand Frau Belzig neben ihm; ihre Augen funkelten aus dem aufgeregten Gesicht.
„Lieber Walther,“ – und sie stockte.
„Nun?“
Sie zuckte zusammen. Wollte er ihr Muth machen mit diesem „Nun,“ ihr die schwierige Aufgabe erleichtern? Er kam ihr entgegen – sie brauchte ja nicht so vorsichtig zu sein!
Und all die geplanten Umwege, auf denen sie an ihr Ziel heranschleichen wollte, kurz abschneidend, ergriff sie seine Hand mit ihren beiden und drückte sie krampfhaft: „Jetzt ist es – jetzt ist es Zeit …“
Als wenn sie voraussetzte, daß Alles vorher mit klaren Worten verabredet worden wäre und daß er nun die Art und Weise der Ausführung eines gemeinsamen Planes durchaus selbstverständlich fände.
Er kehrte langsam das Gesicht von dem Schneegestöber ab nach ihr hin. Wieder ein Stöhnen von drinnen. „Kommen Sie …“ flehte sie mit angstvollen Augen.
Und kein Nein! und kein Widerstand! Er folgte.
Der Freiherr lag an der Längswand des Zimmers gebettet, unter den friedericianischen Bildern und unter dem Prachtstück des Stammbaumes. Eine gewisse poetische Laune hatte es gefügt, daß sich der letzte Gamlingen zu Füßen des stolzen Geschlechterbaumes zur letzten Ruhe streckte.
Das Antlitz des Kranken war fieberisch geröthet; aus den halbgeöffneten Lippen stieß der mühsam arbeitende Athem der leidenden Brust hervor.
Walther hörte, als er neben dem Bette stand und dann durch einen Wink von Frau Belzig veranlaßt wurde, sich auf dem einen Stuhl niederzulassen, während sie auf dem anderen Platz nahm: „Lieber, guter Freund –“ hörte er sie auf den Kranken einreden, „es ist gut! Sie können ganz ruhig sein; es wird Alles geordnet werden! Da ist er – er willigt mit Freuden ein –“
Nichts davon! Wer willigt ein? Wer läßt es geschehen, daß man ihm den alten ehrlichen Namen seiner Väter wegnimmt und einen andern dafür giebt, den er nicht begehrt? Aber kann man denn aufspringen und Nein sagen – jetzt in Gegenwart des Schwerkranken?
Doch Frau Belzig hatte keine Zeit zu verlieren! „Gern willigt er ein!“ rief sie mit schrillem Ton. „Er wird Ihnen ein treuer und braver Sohn sein – nicht wahr?“
Das „nicht wahr?!“ schien auf sie Beide hingewandt. Als wollte sie Beide damit aufwecken, jenen aus seinen Fieberträumen, diesen aus seiner unerklärlichen Betäubung.
Es war immer noch Zeit aufzuspringen und Nein! zu sagen oder irgendwie durch eine Geste, durch ein hinhaltendes Wort auszuweichen. Da sah Walther, wie die matte Hand des Kranken mit dem abgegriffenen Wappenring sich über die Bettdecke in Bewegung setzte und näher und näher tastete, mit ruckweiser Anstrengung, eine andere Hand suchend: die Hand dessen, der damit zu geloben bereit wäre, daß er den Namen des untergehenden Geschlechtes stolz und hoch wie eine Standarte im Kampfe des Lebens tragen würde. Die Lippen des Freiherrn bebten leise, und Walther fühlte sich plötzlich wehrlos diesem Beben, dieser tastenden Hand gegenüber. Noch eine letzte Spur des Widerstandes – in einem Wirbelwind stürmten allerlei Gedanken an ihm vorüber: was man dazu sagen würde, wenn es geschähe? – die ausweichend höflichen, versteckt ironischen Gesichter der Kameraden, sein gutes ängstliches Mütterchen – ob er nicht vor sich selber an Achtung einbüßen würde? Dann aber ein neuer Wirbelwind, der jenem ersten folgte: die kindliche Freude Melitta’s an dem hübschen Spielzeug. Wie glücklich sie der Besitz desselben machen, wie der Name sie kleiden würde! Wie er sie liebt, ach wie er sie liebt! und wie er Alles zu thun bereit sein könnte, ihr diese Liebe zu bezeugen! Und dann die unwiderstehlichen Zauberworte: Karrière und Avancement – es bedurfte nur noch des einen großen, angstvoll flehenden Blickes seiner Schwiegermutter nach der auf der Bettdecke umhertastenden Hand, um die letzte Spur des Zögerns entzwei zu schneiden. Da schob er seine Hand der andern entgegen.
Es war geschehen! Er fühlte die fieberheiße pochende Hand seines Adoptivvaters schwer auf der seinen ruhen.
Am Nachmittag fand die Verhandlung über die Adoption statt, die von Frau Belzig beschleunigt worden war: sie traute dem Tod, dem großen Eskamoteur, und seinen überraschenden Kunstgriffen nicht.
Ein seltsames Testament – und der Anwalt konnte im ersten Augenblick, da er den Gegenstand der Verhandlung erfuhr, eine kurze Verwunderung nicht unterdrücken. Nun, ein guter Name trägt Zinsen wie ein anderes Kapital, und man nimmt auch derlei Schätze nicht gern mit ins Grab. Der Officier dort hat Recht; mit seinem erschreckend einfachen Namen wird er nichts anfangen können – ans Werk also!
Die starke prustende Gestalt des Anwalts, unter der das zimperliche Salonstühlchen beim Niedersitzen ächzte, nahm dicht an dem zum Bette gerückten Tische Platz. Er begann in trockener Geschäftsmäßigkeit die Sache zu erledigen. Alle Vorbedingungen waren bereits auf ihre Richtigkeit geprüft; das Nichtvorhandensein leiblicher Nachkommen war festgestellt. Olga hatte eine Stunde gebraucht, um die Abschrift jenes Schiffrapportes in den Papieren des Vaters ausfindig zu machen, wonach Heinrich von Gamlingen, der Aelteste, auf der Ueberfahrt verstorben und seegemäß bestattet worden war. Hatte der Verstorbene denn keine leiblichen Nachkommen, die seinen Namen beerbten? Die Rubrik „Familienstand“ wies einen flüchtigen Federstrich auf, der „Vakat“ bedeutete, wie auch ein ähnliches Vakatzeichen die Frage nach dem Beruf mit einer gewissen Nichtachtung für die wohl nicht glänzende Erscheinung des Verstorbenen beantwortete.
Eine Tortur, den Kranken dort liegen zu sehen mit seinem fieberrothen Gesicht, das vom schnell hauchenden Athem leicht bewegt wurde. Die eine Hand vollführte kleine, regelmäßig ausholende eigensinnige Streichbewegungen über die Decke hin, als wollte sie irgend etwas Lästiges, das in seiner Phantasie da war und nicht weichen wollte, beseitigen. Hatte er denn ein Bewußtsein des wichtigen Aktes? Vorhin hatte er noch Zeichen seiner Theilnahme gegeben. Aber er wollte vielleicht schlafen – er bedurfte der Ruhe; man sollte ihm doch die letzte Wohlthat dieses Schlafes gönnen!
Walther hatte vor Beginn der Verhandlung Einspruch erhoben: man möchte es doch aufschieben!
„Aufschieben? Ich bitte Sie –!“ fuhr Frau Belzig entrüstet auf. „Bis wann … bis wann wollen Sie denn …“
Sie erschrak selbst über die Brutalität dieser Worte. Und in den weichen Ton zurückfallend, verbesserte sie sich: „Wir werden ihn doch jetzt nicht im Stiche lassen? – Sie haben es ihm doch zugesagt! Er ist so glücklich.“
Das Protokoll wurde mit vollster Gemächlichkeit aufgenommen. Walther saß und sah die Feder über das Papier dahinschleichen. Ist denn die Pein nicht bald zu Ende? – und er horchte auf den breitgedehnten Athem des Schreibenden, der mit seinem Keuchen das Zimmer beherrschte und hinter dem der dünne Hauch des Kranken fast verschwand. Olga stand am Fenster, das Gesicht gegen den aufgelehnten Arm gebeugt. Frau Belzig saß auf der anderen Seite des Notars. Auch ihre Augen schienen das Kritzeln der Feder beschleunigen zu wollen. Mit fieberischer Ungeduld wechselten ihre Blicke zwischen der Feder und dem Antlitz des Kranken.
Hier und da schwebte Schwester Jemina’s Schattengestalt durch die Stille. Das war die andere Tortur. Als wenn Walther sich vor ihren großen, grabesstummen Augen fürchtete, die kein Weinen und kein Lachen, keine Verwunderung und keine Leidenschaft zu kennen schienen. Sie ist eine geborene Komtesse, aber sie hat sich freiwillig ihres glänzenden Namens entkleidet, um sich als Handlangerin in den schweren Dienst des Samariterthums zu stellen. Und wir Erbärmlichen, die wir gekommen sind, einem Sterbenden mit gierigen Händen solch schillernden Fetzen, den jene fortgeworfen hat, zu entwinden!
Endlich war das Protokoll zu Ende. Mechanisch, mit gedämpfter Stimme las es der Notar; bei dem Objekt selbst hob sich seine Stimme klarer, und er buchstabirte mit aufhorchender Vorsicht die einzelnen Silben, als handelte es sich um die kostbaren Ziffern eines Vermögens. Dann versank er wieder in den gedämpften Ton. Plötzlich öffnete der Kranke die Augen, seine Lippen wisperten etwas. Dann kam deutlich ein Name hervor.
„Herr von Stachvogel …“ sagte er, wandte das Köpfchen langsam nach der Stube und schien mit den zwinkernden Augen Jemand zu suchen.
[359] Alles horchte auf. Was soll das?
Nur Walther verstand es. Stachvogel, der jetzige Inhaber der n-ten Division, war doch eine kurze Zeit lang der Adjutant des Oberstlieutenants gewesen, ein Adjutant, auf den man sich in allem Schriftlichen verlassen konnte, wie der alte Herr erzählte. Also handelt es sich nach dem Fieberwahn des Sterbenden um einen schwierigen Bericht, welchen ihm Stachvogel soeben vorgetragen.
„Papa, lieber Papa!“ flehte Olga.
„Lieber, guter Freund, was ist Ihnen? – Hören Sie denn nicht?“ jammerte Frau Belzig.
„O, er weiß sehr wohl, um was es sich handelt!“ nickte er.
Da wird ihm auf einer Unterlage ein Stück Papier zugeschoben – Jemand drückt ihm eine Feder in die Hand, und ein anderer Jemand stützt ihm den Kopf. Eine kurze Weile starrt er die Schrift auf dem Papier an. Wieder nickt er: Aha, er soll das unterschreiben! Die Feder entfällt ihm – abermals wird sie ihm schreibrecht in die Finger gedrückt. Da fliegt ein Lächeln über sein Antlitz – ein bedauerndes, zweifelndes Lächeln: das da soll er unterschreiben? Nein, das kann und darf er nicht! – Und langsam, langsam wiegt er ein paarmal verneinend den Kopf hin und her. Dann mit einer Anstrengung wendet er sich nach der Stube hin an den Jemand, den er vorhin gesucht und der wohl jetzt da sein muß.
„Ze … ze … ze … aber die Brigade …“ stammelt er, während auf seinem Antlitz das Lächeln einem Ausdruck bedenklicher Wichtigkeit weicht, „aber was wird die Brigade sagen? … Herr von Stachvogel, was wird die Brigade …“
Herrgott! was will er? Was hat er mit der Brigade, jetzt in dieser Stunde?
Es ist der fällige Bericht an die Brigade. Stachvogel, sein Adjutant, hat wieder einmal einen zu schneidigen Bericht losgelassen, der bei der vorgesetzten Brigade Anstoß erregen wird. Stachvogel ist zu scharf und er, sein Vorgesetzter, der den Bericht mit seiner Unterschrift decken soll, muß die Schneid’ ausbaden. Er zögert noch zu unterschreiben, wie er es „damals“ öfter gethan. Aber Stachvogel läßt nicht nach, mit stummer Beharrlichkeit, die Spur einer feinen Ironie um die Lippen unterdrückend, wartet er immer noch.
Der Oberstlientenant kann nicht anders, er kann den Druck dieser Beharrlichkeit nicht vertragen. Es hilft kein Sträuben – er muß schließlich doch unterschreiben! Stachvogel will es so – wohlan!
Walther war aufgestanden, mit einer abwehrenden Bewegung trat er an das Bett: er ist nicht bei Sinnen – er phantasirt! man darf ihn das wichtige Dokument nicht unterschreiben lassen – jetzt nicht! – Es wäre ein Verbrechen! – hat er mit seinem winkenden „Nein“ nicht deutlich genug gesagt, daß er nicht unterschreiben will?
Der Rechtsanwalt nimmt aus einer runden Lackdose, die offen neben dem Tintenfasse steht, eine sehr geräuschvolle Prise; und das leichte Heben seiner Schultern, mit dem er Walther’s erregten Blick abwehrt, scheint zu sagen: was geht es mich an! Unterschreibt er, so ist es gut – unterschreibt er nicht, so ist es auch gut! Die Form ist die Hauptsache. Bah, es handelt sich ja doch nur um einen Namen – welch ein Wesen Ihr davon macht!
Plötzlich hat der Kranke die Feder fester gefaßt und ein fein kreischender Ton gleitet über das Papier. Sein Name! Da ist er! Er hat unterschrieben! Ganz fest und sicher sieht der Namenszug aus: „Sehen Sie, Herr von Stachvogel, ich hab’ doch Kourage und nehme es dennoch mit der Brigade auf!“
Dann schmiegt sich das Köpfchen wie Schutz suchend in das Kissen und wendet sich langsam mit emporgezogenen Schultern nach der Wand hin – eine duckende Bewegung, als gälte es des Wischers gewärtig zu sein, den die Brigade auf den allzu schneidigen Bericht austheilen wird.
„Nun?!“
Frau Belzig’s Ruf weckte Walther aus dem betäubenden Starren. Da ist das Protokoll, er soll seinen Namen unter den anderen setzen. Warum zögert er?
Nein, es geht nicht! Er darf nicht … sein Gewissen sträubt sich dagegen! Der andere Name ist nicht mit klarem Bewußtsein dort hingesetzt worden. Die Unterschrift gilt nicht! Wir begehen einen Raub an diesem Namen …
Wie ist es dennoch geschehen?
In der Thür zeigte sich das Dunkel einer Gestalt. Walther wähnte zuerst, es sei Schwester Jemina, vor deren grabesstummen Augen er solche Scheu empfand. Dennoch wandte er den Blick dahin – Melitta, seine Braut! Ein kurzes Ah! der Ueberraschung, ja der Erlösung entfuhr ihm. Wieder war die Sonnenhelle da, die sich über die Bahn seiner Karrière breitete, wieder fand er sich geblendet von dieser Helle. „Ihretwegen!“ rief es in ihm. Da nahm er die Feder und mit einem herausfordernden Trotz warf er seinen Namen hin.
Herr von Stachvogel erschien nicht mehr an dem Lager des Sterbenden, und die Brigade ließ ihm drei Tage lang Ruhe. Er litt geduldig und sagte nichts, nicht einmal sein altes, trauliches „Ze … ze … ze …“ kam über seine Lippen. Am Morgen des vierten Tages stellte sich der Wahn nochmals ein. Olga fragte ihn, da er gerade aus einem langen Schlummer erwachte, wie es ginge? Zuerst wollte er ohne Antwort das Köpfchen nach der Wand hindrehen, aber das Frühroth hatte die Spiegelscheibe des Stammbaumes mit einem gewaltigen Purpur übergossen, und er schreckte zurück vor diesen Flammen.
„Die Brigade – was wird die Brigade …“ flüsterte er. Und ein seltsames, kindlich hilfloses Lächeln umspielte seine Lippen, welches die Frage immer und immer zu wiederholen schien und das auch nicht von der Wachsblässe seiner erstarrten Züge wich, als er nun längst allen irdischen Wischern und aller Brigadefurcht enthoben war und mit dem Bericht seines Lebens vor einem höheren Kommando stand.
Sie werden doch nicht in eine solche Stachelkugel beißen wollen?“ fragte mich voll Staunens einer meiner Freunde, eine echte Landratte von Maler, der bisher kaum die Tannnenwälder des Jura verlassen hatte, als er mich auf dem Fischmarkte von Marseille mit einer Händlerin feilschen sah, die einen großen Korb voll braungrüner oder violetter Kugeln vor sich hatte, welche über und über mit glänzenden, scharfspitzigen Stacheln besetzt waren. „Ach nein! Sie kaufen die Dinger wohl für Ihr Museum?“
„Durchaus nicht! Hinein beißen will ich nicht, aber verspeisen wollen wir einige! Oeffnen Sie ein Dutzend, wenn’s gefällig!“
Die Händlerin umwickelte die linke Hand mit einem groben Sacktuche, packte einen See-Igel von der Größe eines Borsdorfer Apfels, hieb ihn mit einem kurzen, breiten Messer wagerecht durch, kratzte den Darm, der größtentheils durch seine Schwere abriß, aus dem Obertheile der Schale heraus, spülte diese Hälfte in einem Kübel mit Seewasser ab und überreichte sie mir schmunzelnd mit den Worten:
„Il est à point!"
Auf der Höhlung der Schalenhälfte zeigte sich eine Rosette von fünf traubigen Säckchen, die eine schöne orangegelbe Farbe hatten. Ich schlürfte behaglich die Säckchen, welche sich leicht loslösten, hinab und bot meinem Freunde die zweite Schale an, welche die Händlerin unterdessen in gleicher Weise zugerichtet hatte. Er wandte sich schaudernd ab.
„Versuchen Sie doch! Es ist eine marine Omelette. Die Rosette besteht aus den fünf Eitrauben des See-Igels und diese stecknadelkopfgroßen Eierchen schmecken vorzüglich! Sie werden mir sagen, ob Sie See-Igel oder Austern vorziehen — die Leckermäuler von Marseille sind darüber noch nicht einig!“
Guter Himmel! Meine malende Landratte kannte weder Austern noch Miesmuscheln oder Clovisses, die ebenfalls ausgestellt waren — wie hätte sie eine Vergleichung zwischen diesen verschiedenen Genüssen anstellen können, die ohne Ausnahme für sie „Ekelzeug“ waren?
Der gemeine See-Igel, der Oursin der Franzosen, dem die moderne Wissenschaft einen langathmigen Namen (Strongylocentrotus oder Toxopneustes) gegeben hat, während Linné ihn einfach Echinus lividus nannte, ist aber wirklich ein angenehm erfrischender Bissen zwischen Oktober und Mai, in der Zeit, wo seine Fortpflanzungsorgane vollständig entwickelt sind. Er hält sich am liebsten auf Felsengrund in Höhlen und Klüften des Gesteines auf, im Mittelmeere meist nur wenige Fuß unter dem gewöhnlichen Niveau, in den Meeren mit Ebbe und Fluth sogar über der Grenze der tiefen Ebben, während deren Dauer er sich in Tümpel und Rinnsale unter den Tangen verkriecht, wo man oft Hunderte einsammeln kann. Im Mittelmeere holt man die See-Igel mit einem langen Rohrstengel hervor, der am Ende so gespalten ist, daß er eine drei- bis vierzinkige Zange bildet. Mit einem solchen Rohrstabe bewaffnet, gleiten die Fischer in kleinem Boote auf dem ruhigen Wasser in unmittelbarer Nähe der Küsten und auf den Untiefen umher und spähen nach See-Igeln, Muscheln und Schnecken, die theils als Nahrung, theils als Köder verwendet werden.
[360] Diese uralte, von den Vätern überkommene Fangmethode sollte den Fischern von Marseille in der jüngsten Zeit sehr beeinträchtigt werden. Im Januar vorigen Jahres trat ein Taucher in Konkurrenz, der in einem Scaphander, d. h. Taucherapparat, auf dem Boden des Meeres bis zu zehn Klaftern Tiefe umherspazierte, und die zwischen den Algen und in den Felsenritzen verborgenen See-Igel scheffelweise zusammenlas und zu Markte brachte. Großer Skandal unter den Fischern, die sich in ihren Rechten verkürzt wähnen. Sie klagen bei der Seeverwaltung. Der Oberkommissar derselben findet keinen den Gegenstand betreffenden Paragraphen in seinen Instruktionen und referirt an seine vorgesetzte Behörde, den Seepräfekten in Toulon. Dieser kratzt sich hinter den Ohren, und da er nicht weiß, was er antworten soll, antwortet er gar nicht. Unterdessen werden die Fischer bärbeißig und der Obmann der Fischerzunft verbietet kurzweg das See-Igelfischen mittelst des Scaphanders. Darin sieht der Oberkommissär einen Eingriff in seine Rechte und bedeutet dem Obmann, er habe nichts zu verbieten, nur dem Seepräfekten stehe die Entscheidung zu. Jetzt werden auch die Konsumenten aufsässig, die bei der Wohlfeilheit und Häufigkeit der See-Igel zu größter Befriedigung ihres Gaumens unzählige Seezungen mit See-Igelsauce gefrühstückt hatten, welches Gericht bis dahin nur bei ganz außerordentlichen Festschmäusen konnte aufgetischt werden. Die Gäste des Café des Phocéens und anderer, durch die Bereitung des „bouille-à-baisse“ genannten Fischgerichtes berühmter Restaurants werden bei dem Seepräfekten vorstellig und bitten ihn, die Freiheit der Industrie und den Fortschritt, welchen die Republik verlangt, den engen Anschauungen der Fischer gegenüber, die alle verkappte Monarchisten seien, kräftig zu schützen. So lag die Sache im Frühjahre vorigen Jahres. Wie sie ausgetragen wurde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat sie von dem Marineminister in Paris entschieden werden müssen.
Von der ganzen, so außerordentlich zahlreich im Meere und nur im Meere vertretenen Klasse der Stachelhäuter oder Echinodermen, zu denen die See-Igel, Seesterne, Schlangensterne etc. gehören, wird, so viel ich weiß, nur diese einzige Art in Europa und auch hier nur unmittelbar an den Küsten gegessen. Eine weitere Versendung findet nicht statt, und ebenso gewiß ist es, daß andere Arten von See-Igeln nicht verspeist und nur für Naturforscher und Museen gesammelt oder höchstens in kalkarmen Gegenden zu Mörtel gebrannt und zur Besserung des Bodens benutzt werden. Es giebt im Mittelmeere weit größere Arten, eine wie eine Faust groß von blauer Farbe mit weißen Endspitzen der Stacheln, eine andere, die in größeren Tiefen lebt, eine orangegelbe Farbe hat und die Größe eines Kinderkopfes erreicht; man rührt sie nicht an und behauptet, sie seien leer, wie der gemeine See-Igel außer der Fortpflanzungszeit.
Im Osten aber, in den indischen Meeren, um China und Japan herum, erlangen die Stachelhäuter eine außerordentliche Bedeutung für Gewerbe und Handel, die nicht minder groß ist, als diejenige der Auster im Westen. Unter allen den Vorzügen, welche man den Karolineninseln theils angerühmt, theils angedichtet hat, scheint mir ein wesentlicher vergessen worden zu sein: die Trepangfischerei. Karolinen- und Palautrepang gehört zu den feinsten Sorten, welche die Chinesen fast mit Gold aufwiegen.
Die Touristen, welche in den Buchten des Mittelmeeres Bootsfahrten zum Vergnügen machen, pflegen sich meist den blauen Himmel, die blauen Berge und das blaue Meer anzusehen, lenken aber selten ihre Blicke auf den Grund, über welchem sie auf dem durchsichtigen Wasser schweben. Bei glatter See würden sie in der Tiefe von einigen Klaftern manches Interessante sehen – Wiesen und selbst Wälder in Miniatur und dazwischen oft Flächen feinen Sandes, auf welchem hier und da ein rother Seestern langsam umherkriecht, so langsam, daß man seine Ortsveränderung erst nach einiger Zeit abschätzen kann. Meist sieht man auch einige schwarze, warzige, etwa einen Fuß lange Würste, die Exkrementen täuschend ähnlich sehen. Fischer und Naturforscher kennen diese scheinbar bewegungslosen Würste wohl; Erstere bezeichnen sie mit einem sehr unanständigen Namen, Letztere nennen sie Holothurien oder Seewalzen. Läßt man das Thier, denn es ist wirklich eines, mit einem Hamen heraufholen und ruhig in einem Kübel mit Seewasser liegen, so streckt es vielleicht an dem einen Ende, dem vorderen, einen Kranz von fünf hübschen, blattartig eingeschnittenen und verzweigten Fangarmen aus, läßt auch wohl längs des Leibes kleine, in fünf Längsreihen gestellte Saugfüßchen hervortreten und öffnet am hinteren Ende einen weiten, innen glänzend weißen Trichter, durch welchen ein lebhafter Wasserstrahl hin und her spielt. Unter tausend Exemplaren findet sich auch wohl eines, dessen Inneres von einem Fischchen (Fierasfer) bewohnt ist, das von Zeit zu Zeit seinen Kopf aus der Hinteröffnung hervorstreckt und mit großen Augen um sich schaut, bevor es sich wieder zurückzieht.
Das ist Alles, was man sehen kann, wenn die Dinge gut ablaufen. Gewöhnlich aber folgt bald nach dem Fange eine heftige Scene. Aus der weitgeöffneten hinteren Trichtermündung quillt und brodelt, unter lebhaften Zusammenziehungen der Wurst, allerlei schleimiges Zeug hervor, Därme, Röhren, baumartig verzweigte Gebilde, die sich drehen, winden und krümmen wie Würmer und einen vielleicht sechsfach größeren Raum einnehmen, als die jetzt zusammengefallene Wurst hatte. Diese hat thatsächlich alle ihre Eingeweide, Darmkanal, Gefäße, sogenannte Lungen durch die hintere Kloakenöffnung entleert und ausgetrieben; es ist nur die leere Haut mit einem inneren Kalkringe am Vorderende und den daran haftenden Organen zurückgeblieben. Für den Naturforscher, der die Anatomie des Thieres studiren möchte, ist das freilich eine sehr ärgerliche Angewohnheit; der Holothurie selbst schadet sie nicht viel; denn wenn man den ausgeleerten Hautschlauch in ein gut besorgtes Aquarium setzt, so erholt er sich bald und alle inneren Organe, Darm, Lunge etc. wachsen aufs Neue nach und funktioniren nach einigen Wochen, als ob nichts vorgefallen wäre. Der leere Hautschlauch ist übrigens sehr derb, fest wie Leder, und enthält zerstreute, kleine Kalkgebilde, so daß er beim Durchschneiden unter dem Messer knirscht.
Die gewöhnlichen Holothurien führen sich in dieser Weise auf; es giebt aber welche, kleinere, von weißer oder gelblicher Farbe, die in größeren Tiefen leben, eine durchaus lederartige, feste und zugleich dünne Haut haben, die ihre Eingeweide behalten, selbst wenn sie in Weingeist geworfen werden. Und wieder andere finden sich im Mittelmeer sowohl wie in anderen Meeren, die eine platte Bauchseite mit drei Längsreihen von Saugfüßchen, und eine gewölbte Rückenfläche zeigen und eine dicke, aber schwammige und weiche Haut besitzen, die bei einigen in der Südsee vorkommenden Arten so weich ist, daß sie fast unmittelbar an der Luft zerfließt. Die Arten dieser Gattung, welche den wissenschaftlichen Namen Stichopus trägt, speien ihre Eingeweide nur in seltenen Fällen aus und sind zur Bereitung des Trepang am meisten geschätzt. Sie müssen aber aus ziemlicher Tiefe hervorgeholt und mit besonderen Umständlichkeiten behandelt werden.
Mir liegt ein japanisches, illustrirtes Handbuch der Fischerei vor. Eine der in Linienmanier sehr charakteristisch ausgeführten Holzschnitttafeln zeigt die Fischerei auf Trepang. Einige Barken, mit großen viereckigen Segeln, arbeiten auf hoher See mit einem kreisförmig ausgeworfenen Treibnetze. In unmittelbarer Nähe der Küste sind einige lange Ruderboote ohne Masten, jedes mit drei Mann besetzt, lebhaft beschäftigt. Ein Mann steht am Hinterruder, die anderen fischen mit runden Hamen, die an ungemein langen Stielen befestigt sind. Von Zeit zu Zeit schütten sie aus einem kleinen, einem Fäßchen ähnlichen Gefäße etwas Oel auf das Wasser, um auf den Grund sehen zu können. In jedem Boote stehen einige runde, bauchige Flechtkörbe mit etwas engerer Mündung, in welche die gefangenen Holothurien aus den Hamen entleert werden. Diese Fischer gehen an den seichten Stellen längs der Küste den gemeineren Sorten nach, während die Hochseefischer mit dem Netze den Stichopusarten nachstellen.
Auf der folgenden Tafel werden die Holothurien an das Land gebracht, in flachen Hürden abgewaschen, sogar mit dem Messer abgeschabt und gereinigt und dann in runden, großen Kesseln, die unter einem luftigen Schuppen ausgemauert sind, bei lebhaftem Feuer gesotten. Der Koch schöpft sie mit einem Hamen aus dem brodelnden Wasser in Körbe, die hinausgetragen und auf viereckige Hürden geleert werden, wo die Arbeiter sie ordnen und sogar von Zeit zu Zeit mit einem Rechen umwenden, wie Heu, das getrocknet werden soll. Die Dinger müssen anfangs sehr heiß sein; denn der Kerl, welcher die Körbe vom Kessel zu den Hürden trägt, macht ein jammervolles Gesicht und stellt die Beine ganz vertrackt, offenbar, damit ihm die heiße, abtropfende Flüssigkeit die nackten Kniee nicht verbrenne. Schließlich werden dann die wohlgetrockneten Trepange in Kisten zwischen Bambusstäbe verpackt, die leiterartig mit einander verknüpft sind.
So wird, nach Ansicht der Zeichungen, denn den Text kann ich nicht lesen, in Japan eine offenbar gemeine Trepangsorte zubereitet. Auf den Palau-Inseln ist die Bereitung schon eine weit umständlichere. Die Holothurien werden in großen eisernen Schalen abgesotten, dann mit Zusatz von süßem Wasser verdämpft, getrocknet, und diese Operationen werden oft drei- bis viermal wiederholt, bevor man sie in offenen Schuppen monatelang räuchert. Je luftiger die Räucherung, desto besser – ganz wie bei den westfälischen Schinken. Die Stichopus müssen noch sorgfältiger behandelt werden; man nimmt sie aus dem Netze, indem man die Schüsseln, in welchen sie sogleich im Seewasser abgekocht werden, im Wasser unterschiebt; sie dürfen nicht an die Luft kommen. Nach dieser Abkochung im Salzwasser werden sie noch in süßem Wasser gekocht, gedämpft, getrocknet und geräuchert wie die andern. Vor dem Verkaufe werden die einzelnen Sorten ausgelesen.
Der Trepang wird an allen Inseln des indischen Archipels, bis zu den Molukken und Philippinen hin, bei Neuguinea und Japan gefischt, meist nach den Stapelplätzen des chinesischen Zwischenhandels, nach Manila, Singapore und Batavia gebracht und von dort aus durch die ansässigen chinesischen Kaufleute nach China weiter vertrieben. Die verschiedenen Sorten sind auch sehr verschieden geschätzt; die feinsten stehen zehnfach höher im Preise, als die gewöhnlichen.
Und das Resultat? Zuerst eine mühsame Zubereitung in der Küche. Die Holothurie ist total verschrumpft, mit Staub und Schmutz bedeckt. Man reinigt sie trocken, schabt die äußere Hautschicht ab, in der die Kalkstücke sitzen, weicht sie, wie Stockfisch, mehrere Tage in öfter erneutem, süßem Wasser auf, schlitzt die graue, aufgequollene Wurst auf, reinigt sie sorgfältig von innen und hat nun einen Stoff, der einigermaßen weichem Kautschuk ähnlich sieht, aber bei fortgesetztem Kochen zu einer Art Gallerte aufweicht. Um diesen Proceß zu erleichtern, wird die Haut in kleine Würfel zerschnitten.
Ich habe solche Stücke gekostet, die ein befreundeter Kapitän mir vorsetzte, und es ist mir gegangen wie Semper; ich habe ihnen gar keinen Geschmack abgewinnen können. Ein indifferenter Leim, ähnlich wie die Hausenblase, die man zu Gallerten verwendet, ehe sie gewürzt ist. Das thun die Chinesen denn auch im Uebermaße und sie bereiten Suppen, Ragouts und Chaux-froids zu, gegen die ein indischer Currie oder ein arabischer Kuskussu nur Kinderspiele unschuldiger Art sein sollen.
Die Chinesen schreiben dieser genuß- und geschmacklosen Gallerte außerordentlich energische Wirkungen zu; sie verzehren den Trepang aber immer nur in Zubereitungen, für deren Genuß in Indien abgehärtete Zungen und Gaumen gehören.
Dem mag aber sein wie ihm wolle: soviel steht doch fest, daß Millionen Dollars alljährlich im Trepanggeschäft umgesetzt werden, und daß vielleicht mit verbesserten Methoden des Fanges, der Aufbereitung und Räucherung mehr zu verdienen wäre, als mit der langweiligen Kopra, die bis jetzt fast das einzige nach Europa verschiffte Ausfuhrprodukt der bestrittenen Inseln ist, welche der Papst Spanien endgültig zugesprochen hat.
[361]
Fortschritte und Erfindungen der Neuzeit.
Viele von unseren Leserinnen, welche die Frauenbäder Elster, Franzensbad und Marienbad besucht haben, durcheilten auch im Fluge das sächsische Vogtland. Die wenigsten von ihnen hatten jedoch Gelegenheit gefunden, dort die Stätten einer Industrie aufzusuchen, welche für die Frauen besonders interessant ist, jene großen Fabriken, in welchen die Stickmaschine ihre Triumphe feiert. Diese gewaltige Konkurrentin der geschickten Frauenhand ist dort bereits seit Jahrzehnten eingebürgert. So oft ich jedoch in früheren Jahren ihre Massenarbeit beobachtet, mischte sich in die Bewunderung des erfinderischen Geistes der Menschheit das Bedauern, daß diese Wohlthaten nicht der so überaus wichtigen Hausindustrie, der still und ruhig in ihrem Hause stickenden und nähenden Frau zu Gute kamen. Die kleinen Tambourir-Stickmaschinen und Stickapparate konnten leider mit der Fabrikstickerei nicht konkurriren.
Eine Wendung zum Bessern ist inzwischen auf diesem Gebiete eingetreten, namentlich seitdem man auf den Gedanken verfiel, die Nähmaschine mit dem Stickapparat zu verbinden. Ueber die einzelnen Etappen dieses Fortschritts, über die kleinen Triumphe der Technik haben wir schon wiederholt in diesem Blatte berichtet. Heute sind wir in der erfreulichen Lage, auf eine Erfindung hinweisen zu können, die in ihrer Wirkung uns förmlich überrascht, auf einen Stickapparat, welcher in jedem Haushalt aufgestellt werden kann und die feinsten Stickereien liefert, wie sie bisher kaum eine der bekannten Stickmaschinen herzustellen vermochte.
Auf die Einzelheiten in der Konstruktion des kleinen Apparates wollen wir nicht eingehen, denn dieselben würden unsere Leserinnen ermüden. Ihnen kommt es ja in erster Linie darauf an, Näheres über die Handhabung und den Nutzen desselben zu erfahren.
Der Apparat läßt sich an allen Doppelsteppstich-Nähmaschinen, mit Ausnahme der nach dem Wheeler und Wilson’schen System gebauten, anbringen. Er besteht, wie dies unsere Abbildung zeigt, aus einem System von Schienen, mit welchem der Stickrahmen verbunden ist. An diesen Schienen ist ein aus verschiebbaren Linealen zusammengesetztes Hebelwerk befestigt, welches an seinem äußersten Ende mit einem Stift versehen ist. Dieses Hebelwerk führt in der Technik den gelehrten Namen Pantograph. Christoph Scheiner, welcher dasselbe schon um das Jahr 1650 erfunden, bezeichnete es mit dem guten deutschen Namen „Storchschnabel“. Dieser Storchschnabel dient zur Verkleinerung von Zeichnungen und vermittelt auch in dem vorliegenden Apparate denselben Zweck. Ein Blick auf die Abbildung wird uns das sofort klar machen. Wir haben vor uns eine Vorlage, ein sehr groß gezeichnetes A; würden wir nun die Nadel der Nähmaschine durch eine fein zugespitzte Bleifeder ersetzen, so könnten wir die Zeichnung mit Hilfe des Pantographen in verkleinertem Maßstabe auf das unter der Nadel im Stickrahmen ausgespannte Zeug übertragen. Wir brauchten nur mit dem Stift, den die Hand hält, auf den Kontouren der Zeichnung hin und her zu fahren: das Hebelwerk würde alsdann den Stickrahmen entsprechend den Bewegungen des Stiftes verschieben und die Zeichnung würde auf dem Zeug verkleinert erscheinen. Aehnlich verfahren wir auch beim Sticken mit unserem Apparat. Die Maschine ist eingefädelt; wir legen die Vorlage vor uns und setzen auf ihr den Stift von einem Punkt auf den anderen, als ob wir die einzelnen Stiche auf der großen Vorlage ausführen wollten. Die Nähmaschine wird inzwischen selbstverständlich in Bewegung gesetzt und die Stickerei erscheint in sechsfach verkleinertem Maßstabe auf dem ausgespannten Zeuge.
Das ist, wie wir sehen, eine durchaus leichte Arbeit, die im Vergleich mit dem bis jetzt üblichen Sticken noch manche Vortheile aufzuweisen hat.
Das bisher nöthig gewesene umständliche Vorzeichnen oder Schabloniren auf den zu bestickenden Stoff ist nunmehr nicht mehr nöthig; es genügt eine einzige Vorlage als Stickmuster, um die Stickerei auf dem Stoff beliebig oft auszuführen.
Da ferner beim Arbeiten nicht die Stickerei selbst, sondern nur die bedeutend größere Vorlage mit den Augen verfolgt wird, so ist es einleuchtend, daß der bisher so schädliche Einfluß der Handstickerei auf die Augen nun ganz aufgehoben wird.
Was die Leistung des neuen Stickapparates anbelangt, so ist die mit ihm hergestellte Stickerei viel haltbarer als die durch den bekannten Tambourirstich gelieferte und fällt auf beiden Seiten gleichmäßig schön aus. Der Stickapparat kann endlich unter Benutzung einer karrirten Vorlage auch noch zum tadellosen Stopfen von Löchern der Wäsche benutzt werden.
Und der Preis des Stickapparates? Er ist für die meisten Haushaltungen erschwinglich, denn nach einer Mittheilung der Firma Houchet u. Komp. in Leipzig, welche die Fabrikation desselben übernommen hat und ihn an Fabrikanten und Nähmaschinenhändler abgiebt, wird derselbe im Detailverkauf etwa 30 Mark betragen. An der Nähmaschine muß vor dem Anbringen des Apparates eine kleine Aenderung vorgenommen werden. Jede Nähmaschinenhandlung wird jedoch im Stande sein, dieselbe auszuführen, und die Nähmaschine bleibt ungeachtet dieser Aenderung intakt, so daß sie nach dem Abstellen des Stickapparates sofort zum Nähen in gewohnter Weise gebraucht werden kann.
Lithographirte Vorlagen zum Sticken mit diesem Apparat: Buchstaben, Monogramme, Kronen, Blumen, Arabesken, Figuren etc. sind schon in großer Auswahl fertig zu haben, aber außerdem können die Frauen auch andere zu diesem Zweck geeignete Bilder benutzen, wie Photographien, Holzschnitte etc., den kunstsinnigen Damen aber bleibt für die von ihnen selbst gezeichneten Entwürfe nach wie vor der weiteste Spielraum offen.
Auch wir Männer dürfen den Apparat willkommen heißen, denn
wenn wir künftig die zierlichen, uns verehrten Stickereien ansehen,
so werden wir uns nicht mehr zu ärgern brauchen über die vielen
verlorenen Stunden und Tage und über das Verderben der schönen
Aeuglein, die Stich für Stich den Faden verfolgten. Die Geschenke
werden uns gewiß ebenso theuer sein wie zuvor, denn wir sind höflich
genug, nicht zu viel Anstrengung von den Damen zu verlangen. Wir
gönnen ihnen von Herzen die Segnungen der modernen Kultur. Für
die Faust des Schmiedes schwingt schon längst der Dampf tausend
wuchtige Hämmer, auch die Frauenhand wird immer mehr und mehr
durch die Maschine entlastet. Das ist ja auch eine der erwünschten
Wandlungen, welche bewirkt werden durch die Fortschritte und Erfindungen
der Neuzeit. C. Falkenhorst.
Die Einsame.
Der nächste Tag und auch der darauf folgende gingen im gewohnten
Gleichmaß hin. In der Fensternische saßen sich wie
immer Tante und Nichte gegenüber, und die langen Holznadeln
der ersteren klapperten unaufhörlich gegen einander, während
Kordula, tief über die kunstvolle Blattstichstickerei gebückt, emsig
arbeitete. Nur selten einmal hob sie die Augen, um einen Blick
durchs Fenster zu werfen, sie kannte ja längst jede Hand voll
Erde da unten, und die Leute, die hin und wieder über den
schnurgeraden Kiesweg eilten, konnten ihr durchaus kein Interesse
abgewinnen.
„Wie lange noch und der Baum wird neue Blätter tragen,“ brach wieder einmal die alte Frau das tiefe Schweigen, in welches sie nur zu oft versanken. „An dem Rauschen der Gossen höre ich, daß es mit Schnee und Eis für diesmal vorbei ist.“ Und lauschend wandte sie ihr Antlitz dem Fenster zu, an welches der Wind unaufhörlich dicke Tropfen warf.
Müde hob das junge Mädchen den Kopf, und die halbverschleierten Augen glitten fast widerwillig zu den rauchdunklen kahlen Aesten der alten Linde hinaus. „Du hast Recht, Tante, die Knospen schwellen mit jedem Tage dicker an. Wie seltsam doch, daß der schöne Baum Jahr für Jahr in diesem luftlosen Raum immer wieder keimt und sproßt,“ setzte sie nachdenklich hinzu, für einen Augenblick die Hände müßig in den Schoß senkend.
„Kind, die Natur hat keine Launen, sondern thut redlich ihre Pflicht. Sie bleibt uns nichts schuldig, wie das Leben.“
„Pflicht, Pflicht!“ lachte Kordula spöttisch, „der arme einsame Baum wird nicht gefragt, ob er weiter vegetiren will oder nicht, er muß einfach leben!“ Dann schwiegen Beide wieder; nur das eintönige Geräusch des stürzenden Regens klang durch die Stille, bis dieser durch ein kräftiges Pochen an die Thür ein Ende gemacht wurde.
[362] Sogleich erhob sich die Stickerin. „Immer herein, Melly,“ rief sie der Freundin entgegen, die sich bereits in gewohnter Lebhaftigkeit im Vorflur des nassen Mantels entledigte.
„Und bei solchem Wetter komme ich, nach Ihnen zu sehen, liebste Frau von Velsen – ist das nicht lobenswerth?“ plauderte die junge schöne Frau im Eintreten und rückte sich rasch einen Stuhl neben den der Greisin. „Nein, wie frisch Sie wieder aussehen!“ unterbrach sie sich. „Ihr liebes Gesichtchen im Rahmen der blüthenweißen Haube mag ich gar zu gern! Ich wünschte nur, mich auch einmal so vortrefflich konserviren zu können!“ Dann lehnte sie sich selbstzufrieden zurück, um verstohlen der Freundin zuzuwinken.
„Sie kommen gewiß wieder mit irgend einer Einladung für Kordula, Frau von Wolfersdorff,“ wehrte die alte Dame kühl ab, „und wollen mich dafür in möglichst gute Laune versetzen, nicht wahr? Nun, ich bin Ihnen ja dankbar, das wissen Sie wohl,“ warf sie, ihre schroffe Art zu begütigen, freundlicher ein, „doch es taugt nicht für Kora. Das Geschick hat sie einmal bestimmt, abseits des Weges zu gehen, und jedes Fest macht ihr nur von Neuem klar, wie es ist und wie es hätte sein können!“
In ihrer ungestümen Art faßte die junge Frau die beiden Hände der Greisin. „Errathen!“ lachte sie, „errathen – aber Ihre Bedenken lasse ich allesammt nicht gelten! Kordula muß doch, ums Himmels willen, etwas erleben, damit sie späterhin sich an etwas erinnern kann,“ sprudelte sie unbedacht hervor, „und ihr Dasein in diesen vier Wänden eignet sich wirklich nicht dazu.“
Frau von Velsen schwieg. Glückliche Menschen sind rücksichtslos, das hatte sie in ihrem Leben zu oft erfahren müssen, da aber die kleine Frau es in ihrer Art gut meinte, grollte sie ihr nicht. „Was haben Sie denn wieder mit dem Mädchen vor?“ forschte sie dann gelassen – mit der größten Sorgfalt eine neue Reihe an ihrer Arbeit beginnend.
„Ein Maskenball im Kasino, denken Sie nur!“ beeilte sich Melly erfreut zu antworten. „Kordula wünschte sich schon lange, ein derartiges Fest mitzumachen, und ich werde so lange betteln, gnädige Frau, bis Sie uns Kora auch diesmal anvertrauen!“
Das bisher blasse Gesicht des Mädchens röthete sich leise. Unter der Maske würde sie sich wie andere Leute fühlen können, und erwartungsvoll blickte sie nach der Tante hin.
Diese indessen wiegte mißbilligend den Kopf hin und her. „Meine beste Frau von Wolfersdorff, ein Maskenkostüm ist ein theueres Vergnügen – wir sind nicht in der Lage, unnöthige Ausgaben machen zu können.“
„Das sollen Sie auch nicht, gnädige Frau! Unter den früher von mir benützten Quadrillenanzügen findet sich ganz gewiß etwas Passendes für Kora!“
Diese bückte sich rasch zu ihrer Arbeit nieder. „Ich danke für Deine Güte, ich würde mich nie in geliehenen Kleidern behaglich fühlen! Aber ich denke, Tante,“ wandte sie sich im ungewohnten Ton einer Bitte an letztere, „ein Domino würde sich leicht herstellen lassen. Bitte, erlaube mir, Melly zu begleiten!“
Frau von Velsen sann schweigend nach. „Mein braunseidner Rock mit seiner altmodischen Weite ließe sich dazu verwenden. Was meinen Sie, kleine Frau?“ wandte sie sich jetzt, schon halb gewonnen, Melly zu, welche ein wenig schmollend die Arme unter der zierlichen Büste verschränkt hatte. „Nun, meinetwegen denn,“ gab sie gleich darauf ihren Entschluß kund, „mag sie mit Ihnen gehen. Wann findet denn diese Maskerade statt?“
Melly, schnell versöhnt, nannte den kommenden Sonnabend, dann beschrieb sie den aufmerksamen Zuhörerinnen die Maske, welche sie für sich ausgesonnen, plauderte noch von diesem und jenem, rühmte zu guter Letzt die wonnige erfrischende Ruhe dieses Stübchens, wirbelte dann wie der Lenzwind von dannen, und nur ein feiner Maiglöckchenduft erinnerte die Zurückgebliebenen an die kurze Unterbrechung ihres Stilllebens.
Doch nein, die leichte, nervöse Unruhe der jungen Frau schien jetzt über Kordula gekommen zu sein. Sobald die Tante sich frühzeitig, wie immer, zur Ruhe begeben hatte, trat sie zu dem eichenen Schrank in der Ecke, um schon heut an die Fertigstellung des Dominos zu gehen. Wie dünn und abgetragen dieses Seidenkleid war! Muthlos ließ sie die Arme sinken, daß es ihren Händen entglitt. Als sie sich niederbeugte, es aufzuheben, stieß sie hart gegen die alte Truhe am Boden, die Tante Renate’s Schatz barg, und plötzlich flog es wie ein Zittern durch ihre Glieder. Da drinnen lag ein Stoff, der im Schimmer eines Ballsaales in märchenhafter Pracht erglänzen mußte, der seine Trägerin vor Allen herausheben würde! Und ehe sie sich noch recht besonnen, drehte sie schon den Schlüssel herum, der stets im Schlosse steckte, schlug den Deckel zurück und griff nach dem schweren Brokatkleid.
Die lange Schneppentaille war der Mode einer längst vergangenen Zeit entsprechend geformt, eben so der faltenreiche Rock mit dem gelblichen Spitzengekräusel. Gepuderte Haare, mit ein paar Blumen oder Federn geschmückt, mußten ein Kostüm vollenden, wie sie es kostbarer oder schöner nicht zu wünschen gewagt hätte. Doch die Tante gab es zu diesem Zweck nimmermehr her, das wußte sie nur zu gut, und traurig begann sie, es wieder in das Behältniß zurückzulegen, während doch jede Arabeske des Brokats ihr in die Augen lachte. Ihre Finger zögerten – da stand sie wieder einmal, wie so manches Mal in ihrem Leben, und sah die goldenen Früchte hangen und durfte nicht nach ihnen greifen; denn sie war zum Hungern und Dürsten verdammt! – Doch wie thöricht, sich zu betrüben! Wußte sie denn, ob das Kleid ihr überhaupt paßte? Und wie um sich selbst zu beruhigen, zog sie es von Neuem hervor. Mit unruhigen Händen löste sie dann die Bänder und Knöpfe ihres Hauskleides, um geräuschlos den seidenen Rock überzuwerfen. Das schwere Gewebe bauschte sich in unverwüstlicher Pracht um ihre Glieder und ließ gerade noch die Spitze ihres Fußes sehen. Alle ihre Pulse begannen zu fliegen und mit glühenden Wangen zog sie die Taille an – auch diese paßte, sie saß, als sei sie für ihren Körper gearbeitet!
Mit weitgeöffneten Augen starrte sie dann ihr Spiegelbild an. Wie stolz aufgerichtet stand sie jetzt! Der tiefe Ausschnitt der Taille ließ einen zarten, tadellos geformten Nacken von blendender Weiße sehen, die blitzenden Augen mit den dunkelbewimperten Lidern, die glühenden Wangen gehörten ihr an; eine zauberhafte Wandlung war mit ihr vorgegangen – o, der Doktor hatte damals Recht: so brauchte sie keiner Andern mehr als Folie zu dienen, und wäre es selbst eine Melanie von Wolfersdorff!
Sie konnte sich nicht sattsehen an ihrem Spiegelbild, das ihr völlig fremd erschien. Endlich, nachdem mehr als eine halbe Stunde verflossen, riß sie sich los. Langsam, mit fest auf einander gebissenen Zähnen entkleidete sie sich, und als die Freude an der eigenen ungeahnten Wohlbildung geschwunden war, trat eine tiefe Zerknirschung an ihre Stelle. Ihr Thun erschien ihr wie ein Kirchenraub, wie ein Frevel an Tante Renate’s Heiligthum, und tief geängstet beeilte sie sich, das Kleid in die Truhe zu legen, als sie plötzlich am Boden derselben ein Kästchen bemerkte, von dessen Vorhandensein sie bisher noch nichts gewußt hatte. Als sie es emporhob und öffnete, entfloh ihrem Mund ein halberstickter Laut grenzenloser Ueberraschung, denn im matten Schein der Lampe blitzte es ihr in allen Farben des Regenbogens entgegen: herrliche Diamanten, wenn auch altmodisch geschliffen und gefaßt. Wie kam die Tante zu diesem kostbaren Schmuck? Und im Anschauen des flimmernden Arm- und Halsgeschmeides stieg ein bitteres Gefühl in ihr auf, das sich nach und nach bis zum offenen Groll steigerte. Sie mußte um ihrer dürftigen Kleidung willen Nichtachtung und Spott ertragen, während die Tante herrliche Kleinodien im Kasten vergraben hielt! Fast heftig schleuderte sie das Etui in die Truhe zurück, bettete das Kleid darauf und schlug den Deckel zu, um dann stundenlang im Zimmer auf und nieder zu wandern. So oft sie jedoch am Spiegel vorüber kam, wandte sie finster den Kopf ab – ihr Bild jetzt und vorhin bildete einen zu schreienden Gegensatz, als daß er unbemerkt hätte bleiben können.
Eine ruhelose Aufregung hatte Kordula ergriffen und nahm
mit jedem kommenden Tage zu, welcher sie dem Fest näher
brachte. Ihr Bild im Brautkleide der Tante verließ sie nicht
mehr, eine bisher nie geahnte Eitelkeit hob sich aus todestiefem
Schlaf und rang nach fernerer Befriedigung. Dennoch nähte sie
in den stillen Abendstunden an dem Domino, der sie in seiner
Dürftigkeit fraglos jedem Bekannten verrathen mußte. Aber dabei
wuchs immer übermächtiger der Wunsch, das Kleid auch ohne die
Erlaubniß der Tante zu tragen. Konnte sie nicht den Schlüssel von
der Truhe abziehen, oder auch für den Abend als unauffindbar
[363] erklären? Wenn sie sich nach scheinbarem Abschied dann zum
zweiten Mal in der kleinen abliegenden Küche umkleidete, mußte
da ihr Thun der Tante nicht verborgen bleiben? Und Melly, die
Einzige, welche ihr von dem Kostüm erzählen könnte? Nun, diese
würde sich schon zum Schweigen bestimmen lassen.
Wie schnell sie sich an den Gedanken der Täuschung gewöhnte! Wo früher das Herz erschreckt schneller gepocht im tiefsten Angstgefühl, klopfte es heut nur noch stärker in Erwartung des heißersehnten Genusses. Mit der kaltblütigsten Umsicht traf sie alle Vorbereitungen, stellte auch die Uhr vor, um Zeit für ein zweites Ankleiden zu gewinnen – ihre Hand zitterte nicht, als sie die Tante, welche über Kopfschmerz klagte, schon frühzeitig zur Ruhe brachte. Sorgfältig stellte sie ihr die Klingel bereit, deren Klang die freundliche Aufwärterin und Nachbarin herbeirief, bereitete noch das Süppchen zum Abendbrot, dann erst begann sie, an sich zu denken. Sie hatte ja Zeit.
Schon während des Mittagsschlafes der Tante hatte sie das Kleid, wie alle übrigen Bestandtheile ihres Maskenanzuges in die kleine Küche gebracht. Jetzt, als sie in derselben Licht ansteckte, sich umzukleiden, begann endlich doch eine tiefe Erregung sich ihrer zu bemächtigen. In stiegender Hast steckte sie das volle braune Haar in hohen Puffen auf, dasselbe dicht mit weißem Puder überschüttend, dann befestigte sie den bunten Federtuff und sah ein paar Minuten regungslos ihr Bild im Spiegel an. Wie schön, wie merkwürdig schön stand das Alles zusammen! Dann griff sie in wachsender Ungeduld nach dem schimmernden Kleide, als plötzlich sich leise Schritte näherten und, nachdem die Klinke niedergedrückt worden war, sich das runde Gesicht der Nachbarin im Spalt der Thür zeigte.
„I du meine Güte!“ rief Frau Bünger in heller Bewunderung aus. „Sind Sie aber prächtig!“ Und hilfsbereit trat sie näher, um die schweren Falten zurecht zu ziehen. „Ich wußte es ja, daß die Karten nicht lügen – also ist doch die Erbschaft gekommen! Seit Wochen weicht die Treffneun nicht von Ihrer Seite – nun kommt auch die Hochzeit bald hinterdrein, Sie sollen sehen!“ Sie half wie eine Kammerjungfer und nestelte die Taille vollends zu.
Ein lähmendes Entsetzen hatte zuerst die überraschte Kordula erfaßt; doch während Frau Bünger zog und richtete, gewann sie schnell ihre Haltung wieder.
„Sie haben errathen,“ sagte sie möglichst gleichmüthig, „eine entfernte Verwandte bedachte mich in ihrem Testament. Doch ich bitte Sie, liebe Frau Bünger, der Tante gegenüber zu verschweigen, daß ich Ihnen davon gesprochen, sie fürchtet das Gerede der Leute, die ja gleich aus der Mücke einen Elefanten machen!“
„Ich sage nichts, verlassen Sie sich darauf,“ versicherte diese eifrig, „sie mag auch so Unrecht damit nicht haben. Aber wie mich das freut! Die Frau Tante hielt Sie doch ein wenig gar zu knapp!“
„Ja, ja,“ erwiederte Kordula, immer sicherer im Ton. „Wie würde sie zum Beispiel schelten über die Ausgaben, die ich mir mit diesem Anzug gemacht habe! Vom Maskenverleiher natürlich,“ setzte sie erklärend hinzu. „Daß Sie auch über ihn schweigen, Büngerchen, nicht wahr? Das wäre eine schöne Geschichte, wenn die Tante erführe, daß ich in geliehenen Kleidern einherginge!“
Die Frau, stolz über die Vertraulichkeit der sonst so wortkargen Kordula, nickte kichernd. „Na, überhaupt ist die Frau Tante doch wohl ein Bissel zu geizig. So jämmerlich kann es doch um feine Leute, wie Ihresgleichen, nicht stehen, wie sie immer thut!“
Inzwischen war das Ankleiden beendet, und die Bünger beeilte sich, Kordula Fächer und Handschuhe zu reichen, als ihr Auge plötzlich auf das unscheinbare Etui fiel, das halb im Dunkeln auf dem Tische lag.
„Da ist noch was!“ meinte sie, das Kästchen öffnend. „Ah, der Schmuck! – Diamanten! Meine Frau Baronin, bei der ich Köchin war, hatte auch nicht schönere!“
Kordula stutzte einen Moment. Es hatte nicht in ihrem Willen gelegen, die Brillanten der Tante heute Abend zu tragen; dieselben mußten in den Kleiderfalten mit herausgekommen sein; doch dieser Zufall änderte sogleich ihren Entschluß.
„Theaterbrillanten!“ sagte sie leichthin, „nicht wahr, man ist weit gekommen in der Nachahmung echter Steine!“ Dann schob sie mit scheinbar vollkommener Ruhe den kostbaren Reif über ihr Armgelenk und beugte sich, damit ihr Frau Bünger den strahlenden Halsschmuck umlegen konnte.
Draußen schlug die Uhr, und eilig nahm sie den weiten Mantel um, der sie völlig verhüllte – noch ein paar freundliche Dankesworte an die Nachbarin, dann flog sie die Treppe hinab.
Bei Wolfersdorffs, welche sie abzuholen ging, erregte sie gleichfalls das höchste Erstaunen, das junge Ehepaar stand zuerst völlig wortlos der glänzenden Erscheinung gegenüber.
„Donnerwetter, Fräulein Kora, Sie sehen ja famos aus!“ sagte endlich der Gatte. „Ist denn irgend eine gütige Fee bei Ihnen eingekehrt? Und die Brillanten! Na, Simili, was?“ setzte er schon wieder im alten neckenden Tone hinzu, indem er mit vielen Umständen den Kneifer putzte und auf die Nase zwängte, um sie von Neuem von allen Seiten zu betrachten.
Melly, die bisher noch keine Silbe hervorgebracht hatte, schüttelte jetzt energisch den kleinen, lockenumflatterten Kopf.
„Hans Narr,“ schalt sie, „das und unecht!“ Dann küßte sie leise und vorsichtig die Freundin, um das eigenthümlich fremde Gefühl, welches sie plötzlich beschlichen, niederzudrücken. „Du siehst bildhübsch aus, Kora,“ gestand sie freimüthig, „ich glaube, Du machst uns heute Alle todt!“ Und ungesäumt trippelte sie zum hohen Spiegel, ihre reizende Erscheinung von Neuem mit kritischem Blick zu betrachten.
Indessen brachte Kordula ihr Märchen hervor mit einer bewundernswürdigen Geläufigkeit, nur daß hier Kleid und Diamanten in die Erbschaftsmasse geworfen wurden, und keiner ihrer Zuhörer kam auf den Gedanken, daß es sich nicht genau so verhalte, wie sie erzählt.
„Aber ich bitte Dich, Melly, so lange die Tante nicht selbst von dieser Erbschaft zu Dir spricht, davon zu schweigen. Die Ansprüche der Leute würden sich sofort steigern und – die Tante ist mit der Zeit ein wenig genau geworden. Dann noch Eins,“ fuhr sie langsamer fort, stockend, mit brennender Röthe auf den Wangen, „ich muß Dich auch noch bitten, nichts von meinem heutigen Kostüm zu erwähnen, da sie mich in meinem Mullkleid vermuthet. Sie würde es mir nie verzeihen, wenn ich das Brautkleid nach ihrer Meinung derartig entweihte.“
Melly lachte hell auf. „Gottlob, so bist Du endlich einmal von Deinem Postament herabgestiegen, Du Tugendausbund! Mir bist Du durch diese Täuschung noch viel, viel lieber geworden, denn Du erdrücktest mich fast mit Deiner Schuldlosigkeit!“ Und stürmisch umfaßte sie die Freundin, sie mit sich im Zimmer herumdrehend.
Wolfersdorf indessen wandte noch immer kein Auge von dem so plötzlich verwandelten Mädchen ab, und diese rückhaltlose Anerkennung ihrer Person übte eine ganz gewaltige Wirkung auf Kordula aus. Die Sicherheit des Benehmens, welche sie für sich so heiß ersehnt, bei Anderen so tief beneidet hatte, ließ sie jetzt den Kopf stolz in den Nacken werfen; die Augen flimmerten aus den weit zurückgeschlagenen, dicht bewimperten Lidern triumphirend hervor und die Röthe tiefer Erregung verschönte sie in ganz unerwarteter Weise. Als sie nun die Maske vorband, fühlte sie sich wirklich als ein anderer Mensch, und das übermächtige Wonnegefühl ihres Inneren drängte jedes Bewußtsein einer Schuld in den tiefsten Winkel ihres Herzens zurück.
Die Huldigungen, welche Kordula an jenem Ballabende
erfuhr, hätten selbst einen sieggewohnteren Kopf als den ihren
berauschen können. Alle Kräfte ihrer Seele drängten sich jetzt,
da sie sich auf gleicher Stufe mit denen fühlen durfte, zu welchen
sie bisher in hoffnungslosem Sehnen aufgeblickt hatte, mit
Ungestüm hervor, aber auch die dunklen dämonischen Gewalten
blieben nicht zurück: schon an diesem Abend war sie entschlossen,
jedes Mittel zu ergreifen, welches den köstlichen Rausch noch länger
andauern lassen konnte. Jetzt, da sie vom Genuß gekostet, wollte
sie den Becher um keinen Preis mehr aus der Hand geben. Mit
diesem Entschluß, der jede andere Regung übertäubte, kehrte sie
von dem Balle nach Hause zurück.
Nächst Wolfersdorff geleiteten sie auch noch Herren, welche für die „Folie“ früher kaum ein Wort übrig gehabt hatten, sich jetzt aber in Artigkeiten überboten für die „Erbin“, wie man sie schleunigst umgetauft, da Wolfersdorff, der es ja wissen mußte, [364] mit geheimnißvollen Worten von einer Millionentante gesprochen, die Kordula nun beerbt hatte.
Der phantasievolle Erfinder dieser Details hielt sich bei dieser Wanderung mehr im Hintergrunde und rieb sich als stiller Beobachter nur schmunzelnd die Hände über das „Preisrennen“, das er durch seine Worte hervorgerufen hatte, unbesorgt um ernsthafte Folgen. Er hatte ja offene Augen, konnte also bei einem nicht zu besorgenden „Reinfall“ eines Kameraden zur rechten Zeit einschreiten. An eine größere Erbschaft der Kleinen glaubte er nicht, doch gönnte er ihr die kurze Blüthezeit von ganzem Herzen. Besonders machte ihm Stangen Spaß, den die plötzlich entdeckten fascinirenden Augen Kora’s, ihre strahlenden Brillanten und die vermeintlichen Geldsäcke völlig überwältigt hatten. Diesem eleganten Gesellschafter konnte es Kordula zumeist danken, daß sie so schnell der Mittelpunkt des Festes geworden war, hatte er sie doch als pikantes reizvolles Mädchen bezeichnet!
Jetzt, als sich die kleine Gesellschaft von Kordula vor deren Wohnung verabschiedete, behielt Stangen ihre Hand auch länger in der seinen, als gerade nöthig gewesen, und seine Augen suchten mit ganz besonderem Blick die ihren. Ein alter Kunstgriff, welcher aber bei dem unverwöhnten Mädchen seine Wirkung nicht verfehlte, denn ihre Finger bebten leicht zwischen den seinen, und dieses Zittern hielt noch an, als sie die finstere schmale Treppe emporstieg.
Leise öffnete sie die Stubenthür, doch kaum war sie eingetreten und hatte Licht angezündet, als die Stimme der Tante vom Nebenzimmer her ihren Namen rief. Kordula stand athemlos. Noch knisterte die Seide an ihrem Körper, noch lagen die Steine schwer um Hals und Arm – was sollte sie thun? Antwortete sie, so begehrte die Tante wie sonst, daß sie sich auf den Bettrand setze, um ihre Erlebnisse zu schildern. Mußte dann nicht der tastende Finger, jede von unvermeidlichem Rauschen begleitete Bewegung der Blinden ihre Handlung offenbaren? Während sie noch überlegte, was zu thun sei, hörte sie die Tante sich von ihrem Lager erheben, und bald stand die gebückte Gestalt unter der Thür, mit den erstorbenen Augen unruhvoll durchs Gemach spähend.
Kordula regte sich nicht, kaum hob der Athem ihre Brust, und nur die Blicke folgten angstvoll jeder Bewegung der Blinden, welche langsam durch das Zimmer herangeschritten kam und, nur durch einen Tisch von ihr getrennt, vorüber wandelte.
„Kordula?“ frug diese von Neuem, doch leiser, ungewisser; dann plötzlich erhob sich der Kopf mit bebenden Nasenflügeln. „Das ist doch Lavendel!“ murmelte sie, und plötzlich, indem sich ihr Gesicht eigenthümlich verzog, tastete sie sich in ungewohnter Hast dem Schrank in der Ecke des Zimmers zu. Nachdem sie ihn geöffnet, bückte sie sich, um bald darnach einen Seufzer der Erleichterung auszustoßen „Da ist er ja,“ hörte Kora Tante Renate wieder leise vor sich hinsprechen – „Thorheit, Thorheit – aber wo mag der Schlüssel sein?“
Die Finger streiften suchend am Boden, immer unruhiger und hastiger, dann plötzlich schüttelte sie wie im Aerger über sich selbst den Kopf. „Er wird hinabgefallen sein – vielleicht unter den Schrank – was weiter!“ beruhigte sie sich, um dann endlich wieder nach dem Schlafzimmer zurückzugehen
Kordula schien zur Bildsäule erstarrt zu sein; nur die großen brennenden Augen ließen nicht von der gebrechlichen Frauengestalt, und tiefe Blässe und Röthe wechselten auf ihrem Antlitz. Reue war es nicht, was sie fühlte, nur die Furcht, der alten Frau Schmerz zu bereiten, und eine brennende Scham vor dem Ertapptwerden. Die kurzen Minuten wurden ihr furchtbar lang.
Noch als Frau von Velsen längst das Zimmer verlassen, stand das Mädchen bewegungslos, erst als tiefe Athemzüge den eingetretenen Schlummer verriethen, wagte Kordula sich von der Stelle zu rühren. Völlig unhörbar verließ sie von Neuem das Zimmer und begann sich in der Küche aus- und wieder anzukleiden; mit dem Domino über dem Arm kehrte sie dann geräuschvoller zurück.
Wie sie vermuthet, schreckte die alte Frau auch diesmal wieder empor, und sogleich beeilte sich Kordula, zu antworten, und nachdem sie scheinbar den Mantel abgelegt und die Lampe entzündet, in Wahrheit aber das Kleid und den Schmuck in die Truhe eingeschlossen, trat sie an das Lager der Tante.
Mit Genugthuung fühlte sie, wie der dürre Finger heimlich über ihr Kleid hinstrich; doch bald sprach der gerade Sinn der Alten aus, was sie „thörichterweise“ vermuthet, wie sie kopfschüttelnd eingestand.
„Ich weiß nicht, woher es mir plötzlich durch den Sinn schoß, daß Du mein Brautkleid anhabest, Kind, ich muß es wohl geträumt haben, eben so, daß ich deutlich die Thür gehen hörte. Mein Gott, riecht mir denn heute Alles nach Lavendel?“ unterbrach sie sich plötzlich, sich über des Mädchens Hand beugend.
Kordula strich zärtlich über die faltige Wange. „Wie mußt Du Dich aufgeregt haben, Tante, um solch’ hartnäckige Sinnestäuschungen zu erleiden! Aber sage mir,“ begann sie vorsichtig das Gespräch zu wenden, „Du hängst in wahrhaft rührender Liebe an diesem Kleide und doch warst Du nicht glücklich in Deiner Ehe? Ein seltsamer Widerspruch, den ich mir nicht zu erklären vermag!“
Frau von Velsen richtete sich halb auf ihrem Lager empor. „Du fragtest mich bisher nie nach meinen Schicksalen, Kind! Ich will Dir aber den Widerspruch verständlich zu machen suchen, vielleicht auch zugleich mein eigenes Wesen, das Dir gewiß manchmal schrullenhaft und ungerecht erschienen ist. – Ich war, wie Du weißt, das Kind eines Kavallerie-Officiers. Gerade, als ich in die Gesellschaft eintrat, ernannte man meinen Vater zum Regimentskommandeur der Gardedragoner. Die Eltern lebten auf großem Fuß; man sah uns überall, wir machten große Reisen, und der ganze Zuschnitt unseres Hauses war überhaupt ein derartiger, daß Jedermann uns für reich halten mußte. Es war nicht der Fall, doch thaten meine Eltern nichts, mir meinen Glauben zu nehmen, eben so wenig, die anderen Menschen aufzuklären. Ein Tag wie der andere schwand in Saus und Braus dahin, und ich ließ mich, vom Glück übermüthig gemacht, von der Woge tragen. Es stellten sich genug Bewerber um meine Hand ein, doch ganz besonders Einem schien mein Vater seine Gunst zu schenken, und daß ich mit dieser Vorliebe nicht unzufrieden war, kannst Du Dir denken, da Du die Bilder meines späteren Gatten kennst und ich noch hinzusetzen darf, daß er einer der elegantesten Reiter und Tänzer war und in den glänzendsten Vermögensverhältnissen sich zu befinden schien.
Als wir uns verlobten, schmunzelte mein Vater über die glänzende Partie seiner ältesten Tochter – und doch hatten sich beide gegenseitig betrogen. Kurz vor der Hochzeit, bei Eingabe des Konsenses kam es zur Aussprache, doch noch immer versuchte Einer dem Andern allerlei Vorspiegelungen zu machen. Erbschaften erschienen am Horizont, niedrige Spekulationspapiere und Aehnliches mehr, und – mir noch heute unerklärlich – sie glaubten einer dem Anderen.
Man nahm es damals nicht so streng mit Sicherstellung des Heirathsgutes, wie heut zu Tage, und so gründeten wir unseren Hausstand eigentlich auf Nichts.
Ich hatte von dem, was sich hinter den Koulissen abgespielt, keine Ahnung, ging ganz in der Liebe zu meimm Bräutigam auf und stand strahlend glücklich mit ihm vor dem Altar. – Wie der letzte Blick vor dem Scheiden auch der schönste zu sein scheint, also erging es mir in der Erinnerung mit diesem Tag. Alle Seligkeit meiner Jugend, das ganze Glück meiner Kinderjahre koncentrirte sich in meiner Erinnerung an ihn – begreifst Du jetzt vielleicht meine Liebe für das Gewand, das greifbare Andenken an jene Stunden reinen vollkommenen Glückes?“
Tief aufseufzend ließ sich die Greisin in die Kissen zurücksinken, und aus den todten Augen rollten schwere Tropfen langsam über die runzlige Wange.
„Und wie kam dann das Unheil, Tante?“ wagte endlich nach längerer Pause Kordula zu fragen.
„Schritt für Schritt, unerbittlich!“ sagte die Frau mit veränderter schneidender Stimme. „Schon am Tage nach unserer Hochzeit wurde mein Gatte unruhig und argwöhnisch, durch irgend ein Manöver meines Vaters aufgeschreckt, und seine Liebe begann rasch vor dem Mangel zurückzuweichen. Nicht der Blick auf die Zukunft stachelte ihn aber zu den rücksichtslosen Vorwürfen auf, die mich von nun an Tag und Nacht verfolgten, vielmehr das unerbittliche Muß, welches ihn zwang, endlich den falschen Schein abzuthun und unsere Dürftigkeit einzugestehen. Es war ein harter Kampf, mit meinem ganzen Glück hab’ ich den Sieg bezahlt – und seit jener Zeit hasse ich den Schein, wie sonst nichts in der Welt!“
[365]
[366] Schwer athmend lag die Sprecherin zwischen den Kissen und von dem Antlitz war jede Spur von Milde verschwunden, wahrend Kordula mit fest auf einander gepreßten Lippen der kurzen Erzählung nachsann.
„Und das Kästchen am Boden der Truhe – birgt es auch eine Erinnerung an jene Zeit?“
Tante Renate lachte kurz und schneidend auf. „Nein, Kind, wenn ich seinem Inhalt auch vielleicht mein ganzes Elend danke. Es enthält kostbare Diamanten, den fürstlichen Familienschmuck meiner Mutter, welcher meinem Vater für die Tausende Kredit verschaffte, die dann den Leuten Sand in die Augen streuten. Mir graut vor ihm!“
Tiefe Stille folgte dem letzten, fast wilden Aufschrei der gequälten Frau – und leise brach der erste Dämmerschein des kommenden Morgens durch den Vorhang, mit dem rothen Licht der Lampe zu kämpfen, die zu verlöschen drohte. Kein Laut war hörbar, als das leise Uhrticken von der Wand her.
Schießübungen unserer Soldaten.
Kompagniebefehl. Morgen früh schießt die Kompagnie auf Stand 3. Der erste Schuß fällt um 7 Uhr.
Es ist in der Hochsaison der Schießübungen, im Monat Juni oder Juli. Der Befehl, den der gestrenge Herr Feldwebel mit seiner etwas monotonen Jupiterstimme bei der Parole-Ausgabe verliest, trifft daher Niemand unvorbereitet, aber er veranlaßt doch während des Nachmittags in dem Quartier der Kompagnie eine rege Thätigkeit. Da hat der Schießunterofficier – bei jeder Kompagnie hat bekanntlich ein womöglich auf der Schießschule in Spandau ausgebildeter älterer Unterofficier diese wichtige Stellung inne – die Listen vorzubereiten, die Unterofficiere zur Aufsicht, den Schreiber zu kommandiren und die erforderlichen Patronen bereitzustellen; der Tischler der Kompagnie, natürlich auch ein Grenadier, der hier Gelegenheit findet, seinen civilen Beruf zu verwerthen, eilt auf den Boden und sieht noch einmal nach, ob der fertige Scheibenbestand auch ausreichen wird. Auf dem Kasernenhofe übt die Mannschaft „Anschlag und Zielen“; einzelne schlechte Schützen erhalten eine kleine Nachhilfe, indem der Chef sie persönlich mit dem Zimmergewehr schießen läßt. Der zur Leitung des Schießens kommandirte Herr Premierlieutenant aber macht, als ihm beim Mittagstisch in dem Kasino das Dienstbuch vorgelegt wird, sein süßsauerstes Gesicht. „Von 7 bis 11 Uhr auf dem Scheibenstande bei 19 Grad im Schatten,“ meint er leise, „das kann ja ein recht angenehmer Vormittag werden. Na: je mehr Dienst, je mehr Ehre!“
So ganz Unrecht hat der Premier nicht. Beim Frühschoppen sitzen ist entschieden angenehmer als drei oder vier Stunden „schießen lassen“. Es gehört eine eiserne Willenskraft dazu, die ganze Zeit über nicht nur seine volle Aufmerksamkeit auf die Schützen zu koncentriren, von denen jeder Einzelne gerade auf dem Scheibenstand seiner Individualität nach anders behandelt werden muß, wenn man einen Erfolg erzielen will, sondern auch die Scheibe und die Anzeiger fortgesetzt im Auge zu behalten, um diese zu kontrolliren und Unglücksfälle zu vermeiden. Wird einer der Anzeiger verwundet – und die Möglichkeit ist trotz aller Vorsichtsmaßregeln nicht ausgeschlossen, wenn das Aufsichtspersonal nicht äußerst aufmerksam ist – so lastet meist die ganze Verantwortlichkeit auf dem Officier.
Aber der Schießdienst ist andererseits auch sehr interessant. Wie jeder Musketier dafür Interesse zeigt, daß „seine Kompagnie“ am besten im Regiment schießt, so ruft der Wetteifer auch unter dem Ausbildungspersonal die höchste Anspannung hervor. Jeder fühlt außerdem, daß es sich um die wichtigste Vorbildung für den Ernstfall, für den Krieg handelt. Die Zeiten, wo der Soldat „über den Daumen“ anstatt über ein Visir zu zielen angehalten wurde, sind längst und für immer vorüber, und wie eine historische Kuriosität erscheint es, daß es vor noch nicht 80 Jahren als ein gewaltiger Fortschritt gepriesen wurde, den Infanteristen nunmehr jährlich 10 Patronen nach der Scheibe verschießen zu lassen. Heute genügt die zwanzigfache Munitionsmasse kaum für die jährlichen „vorgeschriebenen Uebungen“, und der Infanterist muß sein Gewehr in allen Lagen und auf alle in Betracht kommenden Entfernungen praktisch erprohen lernen, der Kavallerist muß mit der Pistole oder dem Karabiner durchaus vertraut sein.
Es ist ein langer Weg von den ersten Zielkunststückchen, die der ungelenke Rekrut mit dem unbekannten Ding, dem Gewehr nämlich, auf dem Sandsack vornimmt, von der „Vorübung“ gegen die Strichscheibe auf hundert Meter bis zu den weiten Entfernungen, den verschiedenen Scheibenarten gegenüber, und endlich bis zu dem Schießen im Terrain und in kriegsgemäßen Gliederungen. Hier wie bei allen Ausbildungszweigen in der deutschen Armee baut sich die größere und schwerere Anforderung an die Truppe stets auf der gründlichen, erschöpfenden Beendigung einer leichteren auf: für das Schulschießen mit seiner Stufenleiter von „Bedingungen“ ist die Mannschaft z. B. in drei Klassen eingetheilt, und nur wer die vorhergehende absolvirt hat, kann im nächsten Jahre in die höhere, die wieder größere Ansprüche stellt, aufsteigen. An das Schießen des einzelnen Mannes gegen die Strich-, Ring- oder Figurscheibe schließt sich dann endlich das Gefechtsschießen der Kompagnien, in dem die Führer in der Feuerleitung auszubilden, die Mannschaften in ihrer Gesammtheit zu prüfen und an gefechtsmäßige Situationen zu gewöhnen sind. Gerade die jüngste Errungenschaft des deutschen Heeres, das Magazingewehr, hat nach dieser Richtung hin wesentliche Veränderungen hervorgerufen, und es ist hier vielleicht der passende Ort, um das neue Infanteriegewehr M(odell) 71. 84 unseren Lesern in Wort und Bild vorzuführen.
Es sind etwa 14 Jahre verflossen, seit die deutsche Infanterie ihre letzte Feuerwaffe empfing. Dies war bekanntlich das Infanteriegewehr M/71, oder nach dem Volksausdrucke „Mauser-Gewehr“, welches im Jahre 1871 in dem deutschen Reichsheere zur Einführung gelangte. Das System Mauser löste damals das System Dreyse ab, nachdem letzteres in den Feldzügen der preußischen Armee 1864 und 1866 und in dem großen Kriege des geeinigten deutschen Heeres von 1870 auf 1871 seine guten Dienste gethan hatte, von dem man jedoch bald darauf einsah, daß es nicht mehr auf der Höhe der Zeit stehe. So ergeht es gegenwärtig dem Modell Mauser: dasselbe entspricht nicht mehr den Anforderungen, welche an eine durchaus kriegsbrauchbare Feuerwaffe gestellt werden müssen, und deßhalb macht dasselbe jetzt einem neuen Gewehr Platz, welches die bisher gewährten Vortheile des Hinlerladers mit denen der Schnellfeuerung des Mehrladers vereinigt.
Das neue Gewehr ist also ein Repetirgewehr, das heißt ein mit einer Mehrladevorrichtung versehener Hinterlader. Die Bezeichnung M/71.84 soll ausdrücken, daß die neue Feuerwaffe ihrer Konstruktion nach im Wesentlichen das alte Modell (M/71)geblieben ist, welches nur durch die im Jahre 1884 angenommene Neu-Einrichtung eine Mehrladevorrichtung, sowie einige andere, das Wesen der Waffe aber nicht aufhebende Veränderungen erlitten hat.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die neue Waffe, wobei uns die hier nach den amtlichen Vorbildern[1] in Holzschnitt wiedergegebenen Abbildungen gute Dienste leisten werden.
Das Gewehr besteht aus drei Haupttheilen: Lauf, Schloß, Schaft und der Garnitur. Das Zubehör bilden Gewehrriemen, Mündungsdeckel, Visirkappe und Schraubenzieher; von letzterem kommt je einer auf zehn Gewehre. Zu jedem Gewehr gehört ein Seitengewehr, welches aufgepflanzt wird, wenn das Gewehr als Stoßwaffe benutzt werden soll.
Von den drei Haupttheilen des Gewehrs glauben wir hier den Lauf und Schaft außer jeder Betrachtung lassen zu können, weil beide unwesentliche Veränderungen gegen früher erfahren haben, dagegen wollen wir unsere Aufmerksamkeit dem Schlosse zuwenden, welches als Sitz der neuen Mehrladevorrichtung vornehmlich Beachtung verdient.
Das Schloß dient zum Verschlusse des Laufs, zur Entzündung der Patrone, zum Ausziehen der Hülse der abgefeuerten Patrone und zum Zuführen der Patronen aus dem Patronenmagazin, wenn dessen Füllung zur Verwendung gelangen soll.
Die Bestandtheile des Schlosses sind: die Hülse, das eigentliche Schloß, welches alle die Theile umfaßt, die mit der Kammer unmittelbar in Verbindung stehen und nach dem Lösen der Kammerscheibe zugleich mit der Kammer aus der Hülse entfernt werden können, dann die Abzugs- und endlich die Mehrladevorrichtung.
[367] Das Patronenmagazin (m) besteht aus einem Rohr von dünnem Stahlblech, welches im Schaft unterhalb des Laufes liegt und hinten in die Hülse mündet, vorne dagegen über den Oberring vorsteht und mit einem aufgeschraubten Deckel verschlossen ist. Zum Zusammensetzen der Gewehre in Pyramiden ist der Deckel mit einem Stock versehen. Im Magazin befindet sich eine lange, das ganze Rohr ausfüllende Spiralfeder, „Magazinfeder“, zu dem Zwecke, die eingeladenen Patronen nach hinten, bezw. auf den Löffel zu drücken. Damit die Feder bei nicht gefülltem Magazin in diesem gehalten wird, bei gefülltem Magazin aber sich nicht auf eine Patrone schieben kann, ist sie am hinteren Ende mit einer Kapsel versehen. Das Heraustreten der Kapsel aus dem Magazinrohr oder, wenn dieses gefüllt ist, der Patronen, verhindert die Sperrklinke. Sie ist mit einem Stift, um welchen sie sich bewegt, an der linken Außenwand der Hülse befestigt und tritt mit ihrer Kralle durch die Hülse hindurch vor die hintere Oeffnung des Magazinrohrs. In der richtigen Lage wird die Sperrklinke durch eine mitteilst Schraube an der Hülse befestigte Doppelfeder gehalten, welche unter den hinteren Arm der Sperrklinke greift. Das Zurückdrücken der letzteren so daß jedesmal eine der im Magazin befindlichen Patronen an der Kralle der Klinke vorbei aus dem Magazin treten kann, wird beim Auf- und Zumachen der Kammer durch das gleichzeitig stattfindende Auf- und Abbewegen des Löffels (l) bewirkt, welcher die aus dem Magazinrohr tretende Patrone aufnimmt und in die Patroneneinlage befördert, von wo sie beim Vorschieben der Kammer in den Lauf gelangt. Der Löffel ist durch einen starken Stift, die Löffelwelle, drehbar in der Hülse befestigt, seine Aufwärts- und Abwärtsbewegung bewirkt der Auswerfer in Verbindung mit dem Anschlagstück. Das Anschlagstück liegt mit einer Führungsleiste in einer entsprechenden Führungsrinne auf der linken Seite des Löffels, ist mit dem Stellhebel verbunden und kann durch diesen hoch und tief gestellt werden. Zur Erhaltung des Stellhebels in der ihm gegebenen Lage dient die an der linken Seite der Hülse angeschraubte Stellfeder. Vorne hat dieselbe eine Warze, welche durch die Hülse hindurch in deren innere Bohrung tritt und beim Auswerfen der verschossenen Patronenhülsen mitwirkt, wenn die Mehrladevorrichtung abgestellt, das heißt das Anschlagstück gesenkt ist. Ein Abstellen der Mehrladevorrichtung ist nur möglich, wenn die Kammer geöffnet und vollständig zurückgezogen sowie der Löffel gehoben ist. Wird das Gewehr auf Magazinfeuer gestellt, so ist man in der Lage, bei geöffneter Kammer das Magazin mit 8 Patronen zu füllen, eine Patrone auf den Löffel und eine in den Lauf zu legen. Dieses Füllen erheischt die Zeit von etwa 20 Sekunden. Wird ein Schuß abgefeuert, so braucht man nur die Kammer zurückzuziehen und erreicht durch diesen Griff das Auswerfen der Patronenhülse und das Spannen des Schlosses, schiebt man hierauf die Kammer wieder zu, so ist der Lauf geladen und das Gewehr zum Schuß fertig.
Die Einführung des Magazingewehrs gab der deutschen Heeresleitung zugleich Veranlassung zum Erlaß einer neuen „Schießvorschrift“: nebenbei bemerkt, sind in dieser Vorschrift – nicht mehr „Instruktion“ – in höchst anerkennenswerther und geschickter Weise alle Fremdwörter ausgemerzt; es heißt z. B. nicht mehr Theorie des Schießens, sondern „Schießlehre“, nicht mehr Terrain, sondern Gelände“, nicht mehr Distance, sondern „Entfernung“. Durch die Vorschrift ist, den heutigen Kampfverhältnissen entsprechend, den Uebungen im gefechtsmäßigen Schießen ein noch größerer Raum gewährt als bisher; sie werden zum ersten Mal geradezu als die Hauptsache bezeichnet. In der That ist damit einem unbedingten Gebot der Zeit Rechnung getragen, denn das Magazingewehr erfordert weit mehr, als der Einzellader, eine gründliche Schulung der Führer wie der Mannschaft unter Verhältnissen, die der Wirklichkeit möglichst nahe kommen. Die Feuerleitung ist unendlich schwieriger geworden; es kommt gerade bei der neuen Waffe darauf an, die Verwerthung ihrer eigenartigen Kraft dem Führer allein vorzubehalten. Das Magazin soll und darf nur auf seinen Befehl, nicht nach Willkür der Mannschaft ausgefeuert, es muß für die entscheidenden Augenblicke des Kampfes aufgespart werden. Diese entscheidenden Augenblicke fallen mit den nahen Entfernungen zusammen. Die letzte Vorbereitung vor dem Einbruch in die Stellung des Gegners, die unmittelbare Abwehr des feindlichen Sturmlaufs oder eines überraschenden Reiterangriffs sind Gefechtslagen, in denen die Wirkung des Magazinfeuers am vortheilhaftesten zur Geltung kommen wird, für welche das gefüllte Magazin bereit gehalten werden muß. Unsere Infanterie kann aber nur eine beschränkte Anzahl Patronen mit sich führen und der Ersatz derselben auf dem Gefechtsfelde selbst ist äußerst schwierig. Mehr als je heißt es jetzt, der Gefahr des „Verschießens“ entgegenzutreten, und dies kann allein durch sorgfältigste Gewöhnung, durch zweckmäßige Schulung geschehen.
Die Uebungen im Gelände mit scharfen Patronen sind daher mehr und mehr zu wirklichen Gefechtsbildern geworden; die Scheiben werden den Verhältnissen des Ernstfalls entsprechend vorbereitet und aufgestellt; selbst der Pulverdampf, der die feindlichen Linien kennzeichnet, wird durch abgebrannte Kriegsfeuer nachgeahmt; die Entfernungen, auf welche die Truppe in das Gefecht eintritt, sind Führern und Mannschaften unbekannt und müssen abgeschätzt werden; alle Feuerarten vom Schützen- bis zum Magazinfeuer kommen abwechselnd zur Anwendung. Die Kompagnie hat z. B. zwei Züge gegen einen durch Figurscheiben dargestellten Feind in der Front aufgelöst und sich allmählich an denselben herangeschossen – da klappt plötzlich und überraschend in der Flanke eine langgestreckte weiße Scheibe auf. „Kavallerie von rechts! – Magazin!“ schallt das Kommando, und während die Schützen den Flügel der Front zurückbiegend sofort ihr Feuer auf den neuen Feind richten, rückt das Soutien ein und Salve auf Salve donnert gegen die anreitenden Schwadronen.
Solch eine Kavalleriescheibe beehren unsere Musketiere mit ihrer besonderen Liebe; das „fluscht“ doch wenigstens noch, meinen sie, wenn die Salven gegen die Leinwand klatschen. Und wenn es dann nach beendeter Uebung zum Trefferzählen kommt, eilt Alles nach der großen, weißen Wand hin, die wie ein Sieb durchlöchert zu sein pflegt, ein Jeder freut sich über den „erbaulichen“ Anblick und sucht unter den Treffern nach seinen eigenen, natürlich unfehlbaren Kugeln. Die arme Kavallerie! Die Zeiten, da sie das Schlachtfeld abfegte und wie die Windsbraut in die Infanteriemassen einfiel, sind für sie vorüber; das sagt sich beim Trefferzählen selbst der einfache Musketier und blickt mit verdoppeltem Stolz auf seine Waffe.
Aber die Reiterei hat darum ihre Bedeutung nicht verloren; sie hat nur ihre frühere Aufgabe, die auf dem Schlachtfelde lag, mit einer anderen, dem operativen Dienst vor der Front der Armee, vertauscht. Bei dieser selbständigen Thätigkeit kann jedoch auch sie der Feuerwaffe nicht entbehren; sie muß sich unter Umständen selbst ein Defilé öffnen; sie muß ein Dorf, eine vorgeschobene Stellung vertheidigen können, bis die Infanterie sie ablöst. In neuerer Zeit rüstete man daher die Kavallerie in allen Heeren anstatt mit der Pistole mit weittragenden Feuerwaffen aus, und auch sie erscheint jetzt fleißiger als ehedem auf den Schießständen. In Rußland hat man die gesammte Reiterei sogar geradezu in „reitende Infanterie“ verwandelt, denn die vorgeschriebene Ausbildung der russischen Dragoner stellt den Infanteriedienst vollgültig und gleichwerthig neben den kavalleristischen. Im deutschen und österreichischen Heere vermied man diese extreme Richtung glücklicher Weise und räumt auch heute noch der Wahrung des echten, alten Reitergeistes mit seinem schneidigen Drauflosgehen in der ganzen Ausbildung den ersten Rang ein. Und das mit Recht. Die reitende Infanterie wird, wie frühere Versuche gezeigt haben, stets bald zu einer schlechten Infanterie und zu einer noch miserableren Kavallerie. Die Leistungsfähigkeit des Reiters liegt nun einmal in erster Linie in der Schnelligkeit und Ausdauer seines Rosses; die Kraft des Infanteristen in seinen Beinen, denn diese gewinnen bekanntlich nach Napoleon’s treffendem Wort die Schlachten, und in seinem Gewehr – so wird es auch in Zukunft bleiben.
Blätter und Blüthen.
Ein deutscher Theaterintendant. In den „Venetianischen Epigrammen“ singt Goethe von seinem Weimar:
„Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine;
Kurz und schmal ist sein Land, mäßig nur, was er vermag.
Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte
Jeder; da wär’s ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.
Und was Goethe von dem weimar’schen Lande singt, das gilt noch heute von dem weimar’schen Theater, dessen Leiter August Friedrich Freiherr von Loën am 28. April dahingeschieden ist. Wir haben ein Bild und eine gedrängte Charakteristik des tüchtigen Mannes bereits früher gegeben (Jahrg. 1884, S. 381); heute müssen wir des obigen Spruches gedenken, denn mit den mäßigen Mitteln der weimar’schen Bühne hat er der Kunst Ersprießlicheres geleistet, als manche größere Hofbühne, der zu wünschen wäre, daß sie so „nach innen und außen“ die Kräfte wenden möchte.
Daß aber ein Theaterleiter litterarische Bildung besitzen muß, auch ein Hoftheaterintendant, wenn er mehr leisten will, als einen Sport für das Amüsement der Hofkreise zu bieten, wenn er aus der Hofbühne zugleich eine edlere Volksbühne herausgestalten will: das bewies Loën durch seine Theaterleitung, bei welcher er den engen Zusammenhang mit schöpferischen Kräften der neuen Dichtkunst und Musik stets zu wahren wußte, in denen er mit Recht das Trieb- und Schwungrad des ganzen Theaterwesens erblickte. Daß er aber die weimar’sche Bühne zu einem solchen Mittelpunkte zu machen verstand, dazu trug wesentlich seine Vertrautheit mit der neuen deutschen Dichtung und jene Bildung bei, die ihn selbst befähigte, gewandt und geistvoll die Feder zu führen.
Er ist zwar nicht, wie Laube und Dingelstedt, von dem Schreibpult zur Theaterleitung berufen worden: er war Officier und hatte schon seine Jugend in Hofkreisen verlebt, da sein Vater in Dessau, wo der Sohn am 27. Januar 1828 geboren wurde, Oberhofmarschall war. Als Officier machte der junge Loën den Feldzug in Schleswig mit und wurde nachher Adjutant des Erbprinzen von Dessau. Doch schon in dieser militärischen Stellung veröffentlichte Loën seinen ersten Roman „Bühne und Leben“, der warm für die idealen Bestrebungen des mit intimer Kenntniß gezeichneten Theaters eintrat und sich gegen den Schwindel auf jedem Gebiete des Lebens und der Kunst erklärte. Dabei war der Roman, wie auch Loën’s spätere Domäne, z. B. „Verloren und nie besessen“, in feinem Goethisirenden Stil geschrieben und enthielt viele schöne Gedanken in klarer Form. Als daher Loën an Stelle des nach Wien an das Burgtheater berufenen Dingelstedt 1867 die Intendanz des weimarschen Hoftheaters erhielt, da fielen bei einem litterarisch gebildeten Hofe seine schriftstellerischen Leistungen ebenso ins Gewicht wie seine Stellung als Kavalier und Officier, und man kann von ihm nicht sagen, wie von Hülsen, daß er direkt von der Kaserne aus an das Steuerruder eines Kunstinstituts berufen worden sei.
Seiner Direktion hat man in erster Linie die Aufführung der beiden Theile des Goethe’schen „Faust“ in der Devrient’schen Bearbeitung und die Veranstaltung eines Cyklus von Wagner-Opern nachgerühmt. Durch diese künstlerischen Thaten wurde allerdings ein großer Zustrom von Fremden nach Weimar gelenkt; aber in solchen äußerlichen Glanzpunkten, die man gleichsam als Knalleffekte bezeichnen könnte, sehen wir nicht das Hauptverdienst der Loën’schen Direktion, sondern in der steten Pflege des künstlerischen Geistes, welche die an der klassischen Stätte in Weimar doppelt weihevollen Aufführungen der klassischen Dichtungen bewiesen, unter denen auch manche Goethe-Reliquie zum ersten Male in theatralischer [368] Fassung erschien, sowie in der muthigen Initiative, mit welcher die Werke jüngerer talentvoller Poeten von ihm an das Licht der Prosceniumslampen gefördert wurden. Loën hatte als Kritiker und jahrelanger Mitarbeiter der „Blätter für litterarische Unterhaltung“, noch mehr in einer Reihe von Aufsätzen in der „Leipziger Zeitung“, in denen er besonders Portraits der hervorragenden Schriftsteller der Gegenwart entwarf, kritischen Scharfsinn und Feingefühl in der Auffassung dichterischer Eigenart bewiesen, so daß er nicht wie viele andere Intendanten und Direktoren auf die Empfehlungen der Theateragenten und die Reklame, die sich an erfolgreiche Aufführung von Stücken an anderen Bühnen anknüpft, angewiesen war, sondern die neuen Dichtungen selbständig prüfen und Werthvolles seiner Bühne aneignen konnte. So ging er oft den andern Theatern voran mit der Vorführung von Dramen, die zum Theil die Runde über die andern Bühnen machten, zum Theil in Weimar einen Achtungserfolg davon trugen, der die Wahl seitens des Intendanten rechtfertigte.
In allen jenen Gesellschaften, die in Weimar ihren Sitz haben, der Shakespeare-Gesellschaft, der Schiller-Stiftung, der neubegründeten Goethe-Gesellschaft, hatte Loën eine einflußreiche Stellung im Vorstand; er war gleichsam der Großsiegelbewahrer der klassischen Heiligthümer, die in der Musenstadt Weimar für die Jünger und Forscher in den nachstrebenden Geschlechtern aufbewahrt werden.
Loën war nicht bloß ein Intendant, welcher eine den Hoftheatern feindselige Stimmung mit diesen zu versöhnen vermochte: er war auch ein edler, liebenswürdiger Mensch, im Sinne des Goethe’schen Ausspruchs: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“ War er doch auch durch einen seiner Vorfahren, der ganz wie der Enkel sich schriftstellerisch thätig gezeigt, mit dem Altmeister von Weimar, dem Hohenpriester einer menschenfreundlichen Gesinnung, verwandt. †
Sonntagsreiter. (Zu der Illustration S. 353.) Das Motiv ist aus dem Großen Garten in Dresden, diesem „Dorado“ aller dortigen Sonntagsreiter, entnommen. Die „Helden“ des Bildes sind wohlsituirte Kaufleute, und ihre zwei Gäule mit den klangvollen Namen „Kleopatra“ und „Almansor“, beide für gewöhnlich „lammfromm“, sind heute durch ein vorbeifahrendes Gefährt höchst bedenklich aus der Ruhe gebracht. Uebrigens eine Situation, wie man sie nicht nur in Dresden beobachten kann: störrische Gäule und schlechte Reiter giebt es auch an anderen Orten, und belustigte Zuschauer, denen die Schadenfreude eben so aus dem Gesichte lacht wie den beiden Dienern auf dem Rücksitz des vorübereilenden Wagens, fehlen gleichfalls nirgends. **
„Von ihm!“ (Mit Illustration S. 357.) Sie befinden sich auf Sommerfrische – er, sie, es: der behäbige Papa, die noch behäbigere Mama, und es –? „Es“ ist etwas Siebzehnjähriges, Schlankes, Reizendes und Verlobtes. Woher ich weiß, daß sie sich auf Sommerfrische befinden? Ich weiß es nicht, aber ich nehme es als sicher an; denn die Vegetation deutet auf Hochsommer, auf jene Zeit, wo Leute in guten Verhältnissen schlechterdings es zu Hause nicht mehr aushalten. Auch daß der Kaffeetisch im Freien servirt ist, scheint mir dafür zu sprechen; und „Es“ pflückt Blumen. Ich behaupte, sie würde das im eigenen Garten nicht thun, obschon es sich nur um wilde Blumen handelt. Junge Mädchen pflücken Blumen nur auf Spaziergängen im Freien, vorzugsweise aber in der Sommerfrische. Wie dem auch sei: „Es“ ist verlobt, und der Verlobte weilt in der Ferne. Das ist hart, aber nicht tödlich. Es liegt sogar ein gewisser Reiz darin, die holde Pein des Fernseins durchzukosten, und die Nothwendigkeit des Ausfliegens in Sommerfrischen pflegt diesen Reiz der Brautzeit noch zu erhöhen. Ich bin überzeugt, „Es“ trägt etwas von dem Hochgefühl der Büßer mit sich herum, welche freiwillig sich quälen; sie leidet – leidet um ihn! Inzwischen sorgt die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit unserer Postverbindung dafür, daß ihr dann und wann eine „Birne für den Durst“ in Gestalt eines Briefes von dem Fernen wird. Ohne das wäre es natürlich nicht zum Aushalten. Ah, welche Wunder wirkt solch ein Brief! Längst ist der Kaffee servirt, und das Töchterchen pflückt Blumen: sie ist heut nicht herauf zu bekommen.
„Gleich, Mama!“ Das ist wenigstens das fünfte Mal, daß sie den Ruf zum Kaffee mit „Gleich, Mama!“ beantwortet hat. Soeben aber ist der Reichspostbote dagewesen, und Mama hat den Zauber in Händen, der allem Zaudern ein Ende macht; „Von ihm!“ O Himmel, man hält sich hier mit Blumen auf, und da oben wartet ein Brief von ihm! Welch eine Sünde wäre es, noch einen Augenblick länger zu glauben, daß man oben nicht dringend nöthig ist! – Leider ist zu befürchten, daß, falls der für das junge Mädchen bestimmte Kaffee bisher etwa noch nicht kalt geworden sein sollte, er nunmehr diesem Schicksal sicherlich nicht entgehen wird.
Ein altes Komplimentirbuch. In artigen Komplimentirbüchlein gültige Regeln für gesellschaftliches und sociales Leben in Kurs zu bringen, ist nicht nur unsere Zeit so löblich beflissen; schon frühere Jahrhunderte haben danach getrachtet, in wohl durchdachten Paragraphen Recepte für Gewinnung des feineren Lebensschliffes und galanter Politur zu gewinnen. Ja man hat sogar das savoir vivre schon früh als eine Art Wissenschaft erkennen gelernt und demgemäß mit akademischer Gründlichkeit erörtert. Sehr interessant ist in dieser Hinsicht ein heute längst verschollenes, im Jahre 1730 in zweiter Auflage erschienenes Büchlein, das den Titel führt; „Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft, der Privat-Personen, welche die allgemeinen Regeln, die bey der Mode, den Titulaturen, dem Range, den Complimens, den Geberden, und bey Höfen überhaupt, als auch bey den geistl. Handlungen, in der Conversation, bey der Correspondenz, bey Visiten, Assembleen, Spielen, Umgang mit Dames, Gastereyen, Divertissemens, Ausmeublirung der Zimmer, Kleidung, Equipage, u. s. w. enthält. Einige Fehler entdeckt und verbessert, und sie hin und wieder mit einigen moralischen und historischen Anmerkungen begleitet, abgefaßt von Julio Bernhard von Rohr.“[WS 1] Ein Hauptabschnitt handelt natürlich „von dem Umgang mit Frauenzimmer“. „Die Conversation mit dem Frauenzimmer muß allezeit mit Tugend und Sittsamkeit vergesellschaftet werden.“
| Weiß: | Schwarz: |
| 1. D a 1 – e 1 | K e 5 – d 4 : |
| 2. L e 4 – g 2 | L h 2 – g 1 ! A) |
| 3. D e 1 – g 3 : ! | L g 1 – e 3 (oder beliebig) |
| 4. D g 3 – g 7 : (resp. c 2 – c 3) matt. | |
A) 2. … beliebig anders, 3. c 2 – c 3 +, K d 4 – d 3, 4. L g 2 – e 4 matt. – Auf 1. … L g 1 folgt 2. D g 3 : + und falls K : T so 3. L g 2 (h 1) etc. Auf 1. … S e 6 geschieht 2. L d 3 aufged. +, K : T, 3. L c 4 ! nebst 4. c 2 – c 3 matt. Dies ist zugleich die Drohvariante. Das Problem bekundet in Anlage und Durchführung die Hand des Meisters.
A Glaesle gut’n Wein,
A Trum von a Wurst,
Ist gut für den Hunger
Und stillt a den Durst!
An das „Kränzchen“ in M. Wenn Sie in dieser heiklen Frage unser Urtheil anrufen, so müssen wir Ihnen aufrichtig sagen, daß das Schreiben eines anonymen Briefes unter allen Umständen auch zu dem von Ihnen angeführten „guten Zweck“ eine verwerfliche Handlung ist. Abgesehen davon, daß der vermeintlich Ahnungslose, den man warnen will, meistens bereits hinlänglich unterrichtet ist, kann ein solches Zielen aus dem Hinterhalte niemals gebilligt werden. Was man nicht offen sagen oder mit seiner Namensnennung schreiben kann, das muß ungeschrieben bleiben. Anonyme Briefe haben schon großes Unheil angerichtet – es stände besser um die Gesellschaft, wenn das Schreiben eines solchen allgemein als niedrige Handlung verpönt wäre!
Buchhalter S. in L. Sie verlangen von uns, wir möchten Ihnen einen „interessanten, Abwechslung bietenden“ Apparat für Zimmergymnastik empfehlen. Die Freiübungen seien Ihnen zu „langweilig“. Vermuthlich wird die Langeweile bei Ihnen vornehmlich auf Turnfaulheit beruhen; denn die Freiübungen sind unserer Meinung nach sogar sehr interessant. Einen reiche Abwechslung bietenden Apparat wollen wir Ihnen trotzdem empfehlen. Es ist dies der Gummistrang, eine starke Gummischnur mit zwei Handgriffen versehen. Der Apparat ist so leicht, daß man ihn bequem in der Tasche tragen und auch auf Spaziergängen benutzen kann. Es giebt verschiedenartige Konstruktionen desselben; wir geben derjenigen den Vorzug, bei welcher der Gummistrang in einzelne Schnüre zerlegbar ist, so daß der Anfänger mit Zunahme der Kräfte den Strang verstärken kann. Der Gummistrang von E. Trachsler-Wettstein in Hallau entspricht diesen Anforderungen, und es lassen sich mit ihm Kraftübungen ausführen, welche denen mit Hanteln oder Eisenstäben schwersten Kalibers durchaus gleich sind.
E. V. in N. In den Klagen über strenge Behandlung der Elsässer steckt ein gutes Theil Uebertreibung. Noch kursiren in Straßburg zahllose französische Kupfermünzen und werden unbeanstandet genommen, außer von der Post und öffentlichen Kassen; noch sind die Mehrzahl der Ladenschilder französisch und in den Läden die Auszeichnungen nach Franken und Centimes notirt; noch wird in den Instituten „histoire française“ als besonderes Fach gelehrt, kurz, man begegnet auf Schritt und Tritt einer Duldung französischer Elemente, die auf einen aus Deutschland Kommenden fast befremdend wirkt. Auch mit den von Ihnen als „unpolitisch“ getadelten Ausweisungen ist es nicht so arg. Es leben in Straßburg genug Leute, die ehemals für Frankreich optirt haben und dann ruhig in der Stille zurückgekehrt sind, um in ihren altgewohnten Beziehungen weiter zu leben. So lange sie sich ruhig verhalten, werden sie geduldet; daß man sie aber ausweist, sobald sie auch noch auf solche Langmuth hin sündigen, ist doch nur natürlich!
H. P. in P. Ein Artikel über das betr. Thema erscheint demnächst.
Inhalt: Götzendienst. Roman von Alexander Baron v. Roberts (Fortsetzung). S. 353. – Allerlei Nahrung. Gastronomisch-wissenschaftliche Plaudereien. Von Karl Vogt. IV. Meerfrüchte und kein Ende. S. 359. – Fortschritte und Erfindungen der Neuzeit. Stickapparat an Doppelsteppstich-Nähmaschinen. Von C. Falkenhorst. Mit Abbildung. S. 361. – Die Einsame. Erzählung von S. Kyn (Fortsetzung). S. 361. – Schießübungen unserer Soldaten. S. 366. Mit Illustration S. 365 und zwei Abbildungen S. 366. – Blätter und Blüthen: Ein deutscher Theaterintendant. S. 367. – Sonntagsreiter. S. 368. Mit Illustration S. 353. – „Von ihm!“ S. 368. Mit Illustration S. 357. – Ein altes Komplimentirbuch. S. 368. – Allerlei Kurzweil: Schach. S. 368. – Auflösung der Schach-Aufgabe auf S. 336. S. 368. – Auflösung der räthselhaften Inschrift auf S. 352. S. 368. – Kleiner Briefkasten. S. 368.
- ↑ Dieselben sind enthalten in der amtlichen Schrift „Instruktion über das Infanteriegewehr M/71.84 nebst zugehöriger Munition. Berlin, 1886, E. S. Mittler u. Sohn, königliche Hofbuchhandlung.“ Die kleine Schrift war anfangs nur auf dienstlichem Wege aktiven Mitgliedern des Reichsheeres zugänglich, ist jedoch seit December 1886 für den Buchhandel freigegeben worden.