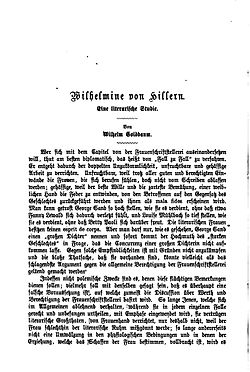Wilhelmine von Hillern (Goldbaum)
Wer sich mit dem Capitel von der Frauenschriftstellerei auseinandersetzen will, thut am besten diplomatisch, das heißt von „Fall zu Fall“ zu verfahren. Er entgeht dadurch der doppelten Unzukömmlichkeit, unfruchtbare und gehässige Arbeit zu verrichten. Unfruchtbare, weil trotz aller guten und berechtigten Einwände die Frauen, die sich berufen fühlen, doch nicht vom Schreiben ablassen werden; gehässige, weil der beste Wille und die zarteste Bemühung, einer weiblichen Hand die Feder zu entwinden, von den Betroffenen auf den Gegensatz des Geschlechtes zurückgeführt werden und ihnen als mala fides erscheinen wird. Man kann getrost George Sand so hoch stellen, wie sie es verdient, ohne daß etwa Fanny Lewald sich dadurch verletzt fühlt, und Louise Mühlbach so tief stellen, wie sie es verdient, ohne daß Betty Paoli sich darüber freut. Die literarischen Frauen besitzen keinen esprit de corps. Aber man darf nur, wie es geschehen, George Sand einen „großen Dichter“ nennen und sofort kommt der Hochmuth des „starken Geschlechtes“ in Frage, das die Concurrenz einer großen Dichterin nicht aufkommen lasse. Gegen solche Empfindlichkeiten ist mit Gründen nicht anzukämpfen und die bloße Thatsache, daß sie vorhanden sind, könnte vielleicht als das schlagendste Argument gegen die allgemeine Berechtigung der Frauenschriftstellerei geltend gemacht werden.
Indessen nicht polemische Zwecke sind es, denen diese flüchtigen Bemerkungen dienen sollen; vielmehr soll mit denselben gesagt sein, daß es überhaupt eine falsche Voraussetzung ist, auf welche zumeist die Discussion über Werth und Berechtigung der Frauenschriftstellerei basirt wird. So lange Jenen, welche sich im Allgemeinen ablehnend verhalten, während sie in jedem einzelnen Falle gerecht und unbefangen urtheilen, mit Emphase eingewendet wird, sie vertrügen literarische Großthaten, von Frauenhand verrichtet, nur deshalb nicht, weil der Frau schlechthin der literarische Ruhm mißgönnt werde; so lange andererseits nicht eine Umwälzung in den physiologischen Bedingungen und in denen der Erziehung, welche das Schaffen der Frau bestimmen, vollbracht ist, wird es [105] schon dabei bleiben müssen, daß die weibliche Production nicht anders als die männliche, will sagen nach ihrem inneren Werthe und von Fall zu Fall, abgesehen von allgemeinen Controversen beurtheilt werde. Und dabei wird sich noch immer ein Facit herausstellen, mit welchem der weibliche Ehrgeiz sich zufrieden geben kann, nur muß eben nicht gleich auf schönen Wangen die Flamme der Entrüstung aufsteigen, wenn etwa die Wahrnehmung gemacht werden sollte, daß es ein männlicher Zug sei, der an den Charakterbildern hervorragender Dichterinnen besonders hervorsteche, so wenig als es Emanuel Geibel, Theodor Storm, Oscar von Redwitz wie eine Beeinträchtigung empfinden werden, daß an ihrer literarischen Physiognomie bisweilen ein weiblicher Zug bemerkt wird. Es ist ja damit weder gesagt, daß der männliche Zug die Frauen, noch daß der weibliche die Männer entstelle, und am allerwenigsten soll etwa der männliche Zug an den Frauen als eine Art Defraudation, der weibliche Zug an den Männern als ein weibischer affichirt werden. Im Gegentheil, jener bedeutet ein Heraustreten aus den Bedingungen der Schwäche, welche nun einmal – gerechter- oder ungerechtermaßen – von der Natur der Frau gesetzt sind, dieser eine Aneignung der duftigen Zartheit, der Sensibilität, welche die Frau vor dem Manne voraus hat. Die Geschlechter geben einander, empfangen von einander, was gebens- und empfangenswerth ist, auf dem Gebiete des literarischen Schaffens so gut wie auf jedem anderen, und darin liegt weder für das eine, noch für das andere eine Herabsetzung. Roswitha, die Gandersheimer Nonne, welche als die erste auf deutschem Boden erwachsene Schriftstellerin gelten darf, hat in dieser Beziehung ein treffliches Beispiel richtiger Erkenntniß gegeben, indem sie den Gönnern ihrer Muse schrieb: „Ihr, gesättigt und getränkt auf dem reichen Grunde philosophischer Forschung, in jeglichem Gebiete der Welt- und Menschenkunde ausgezeichnet, habt doch dem Werkchen, das ein schwaches Weib euch bot, Bewunderung geschenkt und euch an demselben brüderlich erfreut.“
Eine flüchtige Umschau in der Geschichte des Schriftthums bestätigt überdies, daß jener männliche Zug, eine gewisse Härte und Folgerichtigkeit, fast allen Schriftstellerinnen eigen war, deren Schöpfungen sich über die Mittelmäßigkeit erhoben, so zwar, daß kein abstracter Maßstab, sondern der auch für Männer giltige, der allgemeingiltige an sie angelegt werden konnte. Von Sappho bis Annette v. Droste-Hülshoff zeigt sich die nämliche Erscheinung. Man verstehe recht: nicht darin, daß George Sand in Männerkleidern umherging und Cigaretten rauchte, erblicken wir das Männliche an ihr, so wenig als wir an der Gattin des Sokrates in der Art, wie sie den Philosophen einst für verspätete Heimkehr bestrafte, etwas Weibliches finden. Das sind weibliche Verirrungen, die mit der Literatur so wenig zu schaffen haben wie mit der wahren Emancipation. Aber die geistige und sittliche Ueberlegenheit über ihren Geliebten, welche Sappho zum Bewußtsein bringt, daß sie sich weniger eigne, von einem Manne geliebt zu werden als Melitta, und den Gedanken des Selbstmordes ihr eingibt, hat eine unweibliche Geistesbeschaffenheit zur Voraussetzung; die Ehescheu der Droste, welche hart und ablehnend in ihrem Verließ auf der „rothen Erde“ bis zum Tode jungfräulicher Einsamkeit genießt, gehört einer ähnlichen Kategorie an; der kecke Trotz, den Frau v. Staël selbst dem gewaltigen Usurpator Bonaparte gegenüber bekundet; die kühne Weise George Sand’s, ihr dichterisches Vermögen an [106] den schwersten socialen Problemen zu bewähren; der streng philosophische Geist der George Eliot, der vor keiner Consequenz zurückschreckt; der aristokratisch-polemische Hochmuth der jüngst verstorbenen Gräfin Hahn-Hahn, welche die erste „unverstandene Frau“ unserer Literatur war; das stark ausgebildete historische Gefühl bei Louise von François, einzig in dieser Art bei einer Frau; der Reformeifer Fanny Lewald’s endlich und die düstere Resignation Betty Paoli’s – es ist allüberall etwas Männliches, etwas von dem geläufigen Begriffe der Weiblichkeit Gesondertes, was uns entgegentritt. Jede dieser Frauen denkt man sich schwer als Mutter; an jeder von ihnen fesselt mehr ihr Können als ihr Sein; die meisten sind stürmischer Liebe fähig, aber nicht jener, welche wie Frühlingshauch erquickt, sondern der anderen, welche wie Sonnenguth versengt. Davon wußten Alfred de Musset und Friedrich Chopin zu erzählen.
Und in der That stammt die Schaffenskraft der Frauen aus jenem dunkeln Zwischengebiete, das zwischen den beiden Geschlechtern liegt, gleichsam als neutrale Zone, doch mehr den Männern als den Frauen unterthan. Nicht umsonst ist auch in der Natur die Fähigkeit, zu erzeugen, dem Manne vorbehalten, und nicht umsonst bildet auch sie etwas Dämonisches, Unerforschtes, Elementares wie die poetische Production. Man braucht darum just nicht am Worte zu kleben und die literarischen Frauen zu reizen, indem man sie der Unweiblichkeit zeiht; man braucht auch nicht den Vorwurf der Selbstvergötterung auf sich zu laden, indem man ihren Genius einen männlichen nennt. Das Wort thut nichts zur Sache. Aber sicher ist, daß alle belangreichen dichterischen Frauenschöpfungen sozusagen eine militirende Weiblichkeit zum Merkmal haben, eine Weiblichkeit, die mit sich selbst ringt, um sich von sich selbst zu befreien.
Die vortreffliche Schriftstellerin, deren Namen über diesen Zeilen steht, ist ein classisches Muster jener militirenden Weiblichkeit. Eine beneidenswerthe Gestaltungskraft ist ihr gegeben, der das Dramatische wie das Epische, das Descriptive wie das Didactische sich gehorsam fügt; ihre Alpenbilder sind ebenso meisterhaft wie ihre Sittenschilderungen, ihre Conflicte nicht weniger ergreifend als die Handlungen ihrer Erfindung imposant und folgerichtig. Aber das Lyrische ist ihr versagt; die beschauliche Selbstbefriedigung des naiven weiblichen Empfindens, die Freude am Kleinen, Unscheinbaren hat in ihrer Seele keinen Raum. Es muß Kampf, Größe, Leidenschaft sein, in der Natur, in den Entwicklungen ihrer Menschenschicksale, damit ihr Talent sich wohlfühle; die Unterjochung des einen Geschlechtes durch das andere, der weiblichen Kraftentfaltung durch die männliche, ist ihr Problem. Ja soweit geht diese Freude an dem Walten der Kraft, daß nicht selten die reine physische Entwickelung derselben entscheidend wird und der Leser an den Armen der Geyer-Wally und des Bären-Joseph die Muskeln förmlich glaubt anschwellen zu sehen während ihres herculischen Ringens. Hier tritt Wilhelmine v. Hillern aus dem Bereiche des Weiblichen entschieden heraus, welches sie dennoch in anderer Richtung sichtlich in seinem Banne gefangen hält. Als sie noch nicht zu jener phänomenalen Sicherheit in der Gestaltung, welche sich in den beiden Erzählungen „Und sie kommt doch“ und „Die Geyer-Wally“ manifestirt, vorgedrungen war, da äußerte sich der militirende Charakter ihrer Begabung in den dialektischen Kämpfen [107] ihrer Figuren; es wurde mit Worten gestritten, bis die weibliche Ueberhebung durch die männliche Ueberlegenheit besiegt war. Aber die Dialektik, das scharfe Wenden und Einwenden logischer Argumente, die Ausdauer der Beweisführung sind nicht Frauensache und sie sind auch nicht die Sache der Frau v. Hillern. Hier unterliegt die Dichterin den Bedingungen ihres Geschlechtes, die sie vergebens zu überwinden sucht. Endlich zeigt sich noch in einem dritten Punkte bei Wilhelmine v. Hillern der Zwiespalt zwischen ihrem männlichen Können und ihrem weiblichen Sein, und zwar hier zum großen Vortheile ihres dichterischen Schaffens. Es ist eine Wahrnehmung, welche man einem Erfahrungssatze gleichachten kann, daß die Frauen in ihrem literarischen Können von einer stufenreichen Entwickelung und Vervollkommnung ausgeschlossen sind; wie Minerva aus dem Haupte des Zeus, so treten sie fertig auf den literarischen Plan; es gibt kaum ein Rückwärts, nie ein Vorwärts. Selbst George Sand blieb in alle Zukunft auf derselben Stufe, auf der sie war, als sie mit Jules Sandeau im Vereine ihre ersten Erzählungen schrieb. Wilhelmine v. Hillern aber ist gewachsen; man sah es an ihren Werken, wie sie sich reckte und dehnte und wie jeder neue Schritt sie von der dialektischen Unreife ihrer ersten zur plastischen Sicherheit ihrer letzten Erzählungen, von dem blos reflectirenden zum gestaltenden Vermögen förderte. Ihre erste Erzählung „Doppelleben“ (1865) war ein Sensationsstück, mit erklecklicher Unbeholfenheit und jener Effecthascherei aufgebaut, welche sich bei phantasievollen Pensionatsmädchen aus aufregender Lectüre zu ergeben pflegt; die zweite „Ein Arzt der Seele“ (1868) zeigte bereits ein sehr bewußtes Compositionstalent und Anläufe zu scharfer Charakterisirung, wenn auch noch allerhand überschüssige Reflexion den Eindruck trübte; in der dritten „Aus eigener Kraft“ (1870) waren die Vorzüge der zweiten potenzirt, die Schwächen gemindert; die vierte endlich, unter dem Titel „Die Geier-Wally“, zuerst in der „Deutschen Rundschau“ veröffentlicht, erwies sich als Meisterstück, dem die wunderbar erzählte Anekdote „Höher als die Kirche“ sich ebenbürtig anschloß, und wenn auch in der fünften „Und sie kommt doch“ heroische Fehler die Gesammtwirkung beeinträchtigen, so ist andererseits die gestaltende Begabung der Dichterin darin zu einer erstaunlichen Höhe entwickelt. Es gibt kaum eine schriftstellerische Erscheinung, bei welcher die ansteigende Kraft sich so deutlich wie bei Wilhelmine v. Hillern von Stufe zu Stufe beobachten und verfolgen läßt. Sie ist sich dieser Wandlung auch völlig bewußt und hat dieselbe drastisch genug gekennzeichnet, indem sie, einem späteren Freunde ihren Erstlingsroman „Doppelleben“ zusendend, ihn mit den zueignenden Worten begleitete: „Dies Erstlingswerk mit der Bitte um möglichste Discretion, da diese Jugendsünde besser verschwiegen bliebe.“
Heutzutage, da es Mode geworden, auch in der literarischen Kritik mit Schlagworten zu hantiren, drängt sich an jede literarische Leistung die Frage heran, inwieweit sie realistischer Anschauung zum Ausdruck diene. Es herrscht eine wahre Jagd nach dem Realismus und Iwan Turgènjew ist es sogar widerfahren, daß man ihn den „Romantiker des Realismus“ nannte. Das Begründete an der Sache ist, daß das Wort Realismus in solcher Verbindung nur das Wort Naturwahrheit zu ersetzen hat, und stellt man in Bezug auf Wilhelmine v. Hillern die Frage richtig so, inwiefern ihre Menschen, ihre Landschaften und [108] die von ihr geschilderten Leidenschaften der vollen Naturwahrheit sich nähern, dann muß man sagen, es gebe überhaupt keine deutsche Schriftstellerin, die auch nur in annäherndem Maße wie sie das Vermögen besäße, realistisch zu empfinden, zu schauen, zu beobachten, zu gestalten. Indessen der Realismus hat in Kunst und Dichtung seine Grenze; auch er ist ein Vasall der Schönheit. Kehrt er sich an diese Grenze nicht, so wirkt er abstoßend, grausam, unsystematisch. In der „Geier-Wally“ ist eine Stelle, welche der Naturwahrheit die Schönheit zum Opfer bringt, die Stelle nämlich, da Wally den Bären-Joseph zum erstenmal gesehen und nach dem unseligen Zweikampfe zwischen ihm und ihrem Vater dem letzteren erklärt hat, daß sie den Joseph lieb gewonnen habe, „so lieb wie keinen Menschen auf der Welt“. Da plötzlich, heißt es weiter, schrie Stromminger auf: „Jetzt Hab’ I‘s g’nug!“ Es sauste über ihr durch die Luft und ein Streich schmetterte von des Vaters Stock auf sie nieder, daß sie meinte, das Rückgrat sei ihr abgebrochen, und sie erbleichend das Haupt neigte. Es war Hagel, der auf die kaum erschlossene Blüthe der Seele fiel. Einen Augenblick war ihr so übel, daß sie sich nicht regen konnte. Schwere Tropfen quollen aus den geschwollenen Lidern hervor wie der Saft aus dem gebrochenen Zweig, sonst war Alles todt und stumm in ihr. Stromminger stand leise fluchend neben ihr und wartete, wie der Treiber bei einem Stück Vieh wartet, das unter seinen Schlägen zusammengefallen ist und nicht weiter kann.“ Wer wird leugnen, daß hier der Realismus einen wahren Triumph feiert? Aber dieser Triumph ist verletzend, ist eine Sünde vor dem Richtelstuhle der Schönheit. Und noch greller ist in der Erzählung „Und sie kommt doch“ die vielgetadelte Scene von der Selbstblendung des Mönches Donatus. So unerbittlich realistisch kann die Wissenschaft, die Kritik sein, bis zu einem gewissen Grade auch die Malerei, aber die Dichtung bedarf keines Mikroskopes, verträgt kein Mikroskop. Sainte-Beuve, der feinste französische Kritiker, hat in seiner bekannten Vorrede zu Flaubert’s Roman „Madame Bovary“, welcher unter ähnlichen Mängeln leidet, die treffende Bemerkung gemacht: „Dieses Buch liest sich am besten, wenn man eben einen scharfen Dialog aus einer Comödie des jüngeren Dumas gehört hat, zwischen zwei Artikeln von Taine. Denn unter den verschiedenen Formen glaube ich die neuen literarischen Zeichen zu erkennen: Wissen, Beobachtungskunst, Reife, Kraft, ein wenig Härte“. Ja wol, ein wenig Härte oder, wie man es bei uns nennt, Realismus. Wir sind später auf diesen „neuen“ Weg gelangt als die Franzosen; wir haben ihn aber auf unsere Weise schließlich auch betreten, nachdem wir der „Gräfin Faustine“ und ein wenig auch der Schwarzwälder Dorfgeschichte, des vielbändigen Zeitromans, des Tendenzromans und des Memoirenromans satt geworden waren, und jedes Wort Sainte-Beuve’s paßt auf Wilhelmine v. Hillern: „Wissen, Beobachtungskunst, Reife, Kraft, ein wenig Härte.“
Brauche ich mich erst gegen den Verdacht zu erwehren, als ob ich diese partielle Vergleichung mit dem jüngeren Dumas, mit Flaubert und Taine auf die gesammte literarische Thätigkeit Wilhelmine v. Hillern’s auszudehnen trachte? Hoffentlich nicht. Wilhelmine v. Hillern ist deutsch durch und durch; ja sie hat als Deutsche die Fehler ihrer Tugenden. Sie ist ehedem breit und theoretisch im Dialog gewesen wie ein Professor und wissensselig wie ein Student. Man erinnere sich jener wunderlichen Scene in „Ein Arzt der Seele“, wo die emancipationssüchtige [109] Ernestine eine ganze Anzahl von Professoren der naturwissenschaftlichen Facultät brüskirt, weil dieselben nichts von Dorothea Rodde, der Tochter Schlözers, wissen. Man suche in derselben Scene die Debatten über die Schwere des Gehirns, über die Nothwendigkeit, weibliche Leichen zu seciren, um physiologisch die geistige Entwickelungsfähigkeit der Frauen zu erforschen. Derartige theoretische Excursionen, die nicht durchaus mit dem Gange und der Entwickelung des Ganzen zusammenhängen, würden einem Franzosen überhaupt nicht und einem Flaubert oder Dumas am wenigsten die Bewegung hemmen. Wilhelmine v. Hillern ist auch in der Gesinnung und in der Sentenz durch und durch deutsch. Welcher neuere Franzose würde einen Roman mit einer Abstraction, einem Fabula docet, einer Moral abschließen, wie es bei Frau v. Hillern in der Erzählung „Aus eigener Kraft“ geschieht, wo der Held, Dr. Alfred v. Salten, pathetisch die glückliche Gestaltung seines Lebens mit den Worten preist: „Ich danke es mit gerührtem Herzen dem Fortschritt unseres denkenden Jahrhunderts! So seid getrost, Ihr Alle, die, wie ich, geschmachtet hinter den Schranken, welche eine stiefmütterliche Laune der Natur oder das Vorurtheil der Menschen Euch gesteckt: die Arena des Geistes ist aufgethan, Jeder ist zum Kampfe zugelassen und Jeder kann siegen aus eigener Kraft“? Das denkende Jahrhundert! Die Arena des Geistes! Wie concret weiß der Franzose die „neuen literarischen Zeichen“ zu fixiren! Ein Dialog aus einer Comödie des Dumas fils, ein Roman Flaubert’s, zwei Artikel von Taine – Wissen, Beobachtungskunst, Reife, Kraft, ein wenig Härte. Wie umständlich philosophirt dagegen die Deutsche! Denkendes Jahrhundert, Laune der Natur, Vorurtheil der Menschen, Arena des Geistes. Hier Begriffe, dort Gesichte. Und da wir nun schon einmal dabei sind, das Deutsche an Frau v. Hillern, das Nationale, auszuspüren, so wollen wir auch nicht verschweigen, wie hinwiederum sympathisch, französischer Denkungsweise durchaus unerreichbar, sich dasselbe häufig bei ihr offenbart. Wir denken dabei unter Anderem an den Hymnus auf den Sieg der Mutterliebe über den leidenschaftlichen Emancipationsdrang in „Ein Arzt der Seele“, an Ernestine’s jubelndes Bekenntniß: „Ich bin Mutter! O Johannes, was käme dieser stolzen Freude gleich? Ich beneide keinen Mann mehr und unser Mädchen soll es dereinst auch nicht thun. Es soll aufwachsen im Schoße der Liebe, und soll das jugendliche Haupt stolz erheben zu der geistigen Höhe, welche das Weib erreichen muß, um dem Mann eine würdige Gefährtin zu sein, aber mit jeder Faser soll es in dem Boden wurzeln, aus dem wir doch die besten Kräfte ziehen: in dem alten geheiligten Boden der Familie. Dann spricht es vielleicht zu einem theuren Mann, wie ich jetzt zu Dir: Wohl mir, daß ich ein Weib!“ Wir denken ferner an das Gespräch zwischen Alfred v. Salten und dem Könige in dem Roman „Aus eigener Kraft“, wo der adelige Sprecher, ein echt deutscher Individualist, den demokratischen Grundsätzen das Wort redet. Der König fragt ihn scherzhaft, ob er ein Feind des Adels sei. „Nein Majestät, nicht des Adels,“ lautet die Antwort, „nur seiner Vorrechte, denn unter ihrem Schutze spreizt sich auch die Unfähigkeit und nimmt dem Verdienste den Platz weg.“ Endlich schwebt uns das wunderbar stimmungsvolle Bild von der Ruhe nach der Schlacht in demselben Roman vor der Erinnerung, ein Bild, das so, just so, kein Meissonier und kein Horace Vernet[WS 1] zu Stande bringt. „Vom fernen Kirchthurm läutet es den [110] Abendsegen, und vor dem frommen Klang, der wehmüthig mahnend über die blutgetränkten Felder zieht, wie ein Klageruf des entweihten zerstörten Friedens, entfliehen die bösen Geister der Wuth und der Rache. Durch die müden Seelen der Soldaten zieht die Erinnerung an das heimische Dorf, wo unter dem Läuten der Abendglocke jetzt eben die Zurückgebliebenen ein Vaterunser für sie sprechen – und wie der perlende Schweiß der Stirn, so entquillt auch wol dem Auge ein frischer Tropfen, eine verborgene Thräne des Heimwehs und der Sehnsucht nach dem Frieden. Die Sonne ist unter. Das Heer bereitet sich zum Bivouac. Die Wachtfeuer lodern auf, erst gelb und matt abstechend von der röthlichen Dämmerung, mit der sinkenden Nacht aber immer heller leuchtend. Unzählige rührige Gestalten gleiten daran vorüber. Es ist ein Summen und Schwirren, ein Hin- und Wieder- und Durcheinanderrennen, eine Geschäftigkeit auf dem weiten Plan, als könnten diese Schwärmer nie zur Ruhe kommen. Endlich strecken sich die müden Soldaten auf der harten Erde aus. Die Feuer lodern leise knisternd zu dem gestirnten Firmament empor. Rieselnder Thau kühlt die fieberheißen Stirnen der Schläfer. Eine Grille singt in dem geknickten Korn das Klagelied um ihre zertretenen Gefährten. Wie Leuchtkäfer funkeln die ruhenden Waffen im Schimmer des Mondes und geheimnißvoll, wundersam flüstert es in den Lüften – die Götter steigen zu den Helden hernieder.“
Wenn aber weder die Berufung aus den alleinseligmachenden Realismus, noch die Vergleichung mit verwandten Erscheinungen ausreicht, um der schriftstellerischen Physiognomie Wilhelmine v. Hillern’s ihre Eigenthümlichkeit abzumerken; wenn der sonst für literarische Frauenleistungen übliche Maßstab versagt, um diese sinnliche Gluth, diese Energie und Unerschrockenheit im Erfinden und Durchführen abzuschätzen – wo steckt nun jenes Etwas, das die Originalität der Frau v. Hillern ausmacht, und woher stammt es? Es stammt von der Mutter und ist der ererbte und selbsterprobte dramatische Nerv, der Sinn für den Effect, für die Action, für die leidenschaftlich bewegte und folgerichtig entwickelte Handlung, das Interesse an allem Spannenden, mit Einem Worte: die Theateratmosphäre. Auf der Bühne gibt es kein psychologisches Grübeln, kein beschauliches Stillehalten und Retardiren, keine spiritualistischen Finessen. Da will Alles mit dem leibhaftigen Auge gesehen sein, Alles unmittelbar wirken. Und liest man in „Aus eigener Kraft“, wie der Neger Frank die kleine Anna rettet („Er macht ein Seil los, das er um den Arm gewickelt hat, an dessen Ende ist ein großer Stein. Niemand weiß, was er damit will. Er spricht mit Aennchen, aber man kann es bis hinunter nicht verstehen. Was will er nur mit dem Stricke?“), dann, wie die „Geier-Wally“ den jungen Lämmergeier aus dem Felsenneste herunterholt („Ohne langes Besinnen packte sie mit der Linken den jungen Vogel, der nun ein jämmerliches Geschrei anhob, und nahm ihn unter den Arm. Da rauschte es durch die Lüfte und in demselben Augenblicke ward es dunkel um sie her und wie ein Sturm und Hagelwetter schlug und brauste es ihr um den Kopf. Ihr einziger Gedanke war: „Die Augen, rette die Augen“ und das Gesicht dicht an die Felswand drückend, focht sie mit dem Messer in ihrer Rechten blindlings gegen das wüthende Thier, das mit dem scharfen Schnabel, mit Klauen und Fittigen auf sie niederdrang“), lauscht man endlich mit angehaltenem Athem dem [111] Rettungswerk, das die „Geier-Wally“ an dem Bären-Joseph vollbringt („Die Weiber beten laut, die Kinder schreien. Die Männer fangen an, langsam aufzuwickeln, aber nur ein paar Hände – da widersteht das Seil! Es ist nicht gerissen, es hält – Wally hat Fuß gefaßt! Und jetzt – horch! ein verhallender Ruf aus der Tiefe – und aus allen Kehlen bricht noch angstzitternd die Antwort. Wieder wird das Seil schlaff, sie wickeln nach, das wiederholt sich ein paarmal; es scheint, Wally klimmt an der Felswand empor. Mittlerweile ist es Tag geworden, aber ein schwerer kalter Regen rieselt herab und immer dichter wird das Nebelgemeng dort unten. Jetzt nimmt das Seil plötzlich eine schräge Richtung u. s. w.“) – urtheilt man, sagen wir, nach diesen und ähnlichen Proben, so ist das Geheimniß bald ergründet. Wilhelmine v. Hillern erzählt Alles, daß man es vor seinen eigenen Augen zu schauen meint; sie sieht es selbst, indem sie es schildert; es geht vor sich wie auf offener Bühne. Was ist gegen diese dramatische Unmittelbarkeit der sentimentale Eindruck der Novellen-Katastrophen einer andern vielgenannten Schriftstellerin? Und was verfängt gegen dieselbe der graue theoretische Einwand, daß nach dem Maße des weiblichen Könnens auch bei Frau v. Hillern die Kenntniß und Darstellung der weiblichen Charaktere diejenige der männlichen bei weitem übersteige? Daß zuviel Kraftaufwand der weiblichen Malerin nicht anstehe? Hat Jemand schon, wenn er Charlotte Wolter auf offener Scene vor sich sah, ihr im Geiste vorgeworfen, daß sie der Orthographie nicht völlig Herr sei? Oder hätte er gewünscht, daß sie, um weiblicher zu erscheinen, den Heroismus ihrer Rolle und ihres Talentes verleugne? Es ist ganz unzweifelhaft, daß die Novelle nicht in das Drama verpflanzt werden kann, ohne dasselbe in seiner Wirkung zu beeinträchtigen; aber welcher Gewinn der Novelle erwächst, wenn eine dramatisch geübte Hand sie führt, davon zeugen die Erzählungen der Frau v. Hillern, allen voran die „Geier-Wally,“ dann „Und sie kommt doch.“
Und Wilhelmine v. Hillern hat diese dramatisch geübte Hand von ihrer Mutter, von Charlotte Birch-Pfeiffer; sie hat sie auch von ihrer eigenen Bühnenvergangenheit her. Die gute Charlotte ist viel verlästert worden, beinahe soviel wie August v. Kotzebue, und beinahe mit ebenso zweifelhaftem Rechte. Es ist wahr, sie nahm ihre Stoffe, wo sie dieselben fand. Am lebhaftesten hat sich ja Berthold Auerbach dagegen gewehrt, den die Tochter mit dem Andenken der Mutter aussöhnte, indem sie dem Dichter der „Frau Professorin“ die „Geier-Wally“ zueignete. Aber griff Charlotte einmal nach einem Stoffe, so war er auch im Handumdrehen scenisch hergerichtet und so geschickt für die Bühne appretirt, daß seine dramatische Wirkung nie versagte. Sie lebte ein doppeltes Leben, eines in der Wirklichkeit, das andere hinter der Coulisse, und das letztere war das maßgebende. Mit erstaunlicher Sicherheit ergriff sie den fremden Stoff, dehnte und reckte, schnitt und strich, bis er bühnenfertig war. Dabei kam die ursprüngliche Poesie desselben meist zu Schaden und eine robuste Hausbackenheit war ihm octroyirt. Aber seine dramatischen Eigenschaften blieben ihm erhalten, ja sie wurden erhöht, denn Frau Charlotte wußte besser wie alle Männer, was die Bühne erheischt; sie war ein geborenes Theatergenie, welches sich[WS 2] übrigens auch in ihren Originalstücken, in der „Marquise von Villette“, „Kind des Glücks“, „Goldbauer“ etc. nicht verleugnet hat. Auf ihre Tochter Wilhelmine hat sich diese dramatische Intuition in edlerer Form und Art verpflanzt. Wilhelmine hat, soviel [112] wir wissen, drei kleine Theaterstücke, die Bluette „Guten Abend“, das Charakterbild „Ein Autographensammler“ und das Lustspiel „Die Augen der Liebe“ geschrieben, aber es ist uns nicht bekannt, daß dieselben ein besonderes Glück auf der Bühne gehabt hätten. Wir begreifen dies. Sie ist eine prononcirt selbständige Natur und bedarf fremder Anregungen nicht, geht ihnen vielleicht sogar geflissentlich aus dem Wege. Das theatralische Talent der Mutter ist bei ihr zu einem dramatischen erhöht, das Drama mit der Erzählung vertauscht. Frau Charlotte war für die künstlerische Führung einer Novelle, eines Romans zu wenig gebildet; ihre Tochter Wilhelmine ist zuviel Künstlerin, um die handwerksmäßige Manipulation der Mutter zu übernehmen.
Wilhelmine v. Hillern ist in München geboren als das einzige Kind Charlottens und des durch eine „Geschichte Ludwig Philipp’s“ bekannt gewordenen Schriftstellers Christian Birch. Sie erhielt im elterlichen Hause zu Berlin durch treffliche Lehrer eine sorgsame Erziehung, und durch den Verkehr mit bedeutenden Menschen schon im Kindesalter mannigfache Anregungen. Vom Theater ward sie lange ferngehalten, aber als sie Dawison und Rachel auf der Bühne gesehen hatte, erwachte in ihr eine unbezähmbare Neigung, Schauspielerin zu werden, und in Gotha betrat sie als „Julia“ die Bretter. Sodann gastirte sie in Braunschweig, Karlsruhe, Berlin, Frankfurt und Hamburg, bis sie ein festes Engagement an Mannheim fesselte. Als sie von der Bühne schied, ward sie die Gattin des Kammerherrn und Landgerichtspräsidenten v. Hillern in Freiburg.
Aus diesem knappen biographischen Abrisse ersieht man, wie der enge Zusammenhang mit der Bühne auch über die vorbildlichen Einflüsse der Mutter hinaus für die schriftstellerische Entwickelung der Frau v. Hillern zum maßgebenden werden mußte. Was sie selbst der Bühne gewesen ist, entzieht sich unserer Kenntniß; aber daß sie von derselben lebhafte Impulse empfing, unterliegt keinem Zweifel. Eines der Geheimnisse ihrer Originalität stammt geraden Weges aus jener theatralischen Vergangenheit. Es sind wenige unter den deutschen Schriftstellerinnen, welche sich in der sicheren Erfassung und Behandlung eines Problems mit ihr messen können; keine reicht in der Führung des Dialogs oder in dem Verständniß für drastische Wirkungen an sie heran. Das sind ihre Errungenschaften von der Bühne. Sie hat sicherlich auch ihre emancipatorische Uebergangskrankheit gehabt – welches gebildete Weib hätte dieselbe nicht gehabt, wenn es noch dazu der Freiheit des Theaterstandes genoß? Aber sie hat diese Krankheit rühmlichst überwunden. „Ich beneide keinen Mann mehr,“ sagt Ernestine in „Ein Arzt der Seele“. Vielleicht entnimmt mancher Widersacher der Frauenschriftstellerei aus diesem Bekenntnisse das verdrießliche Argument, daß es der „Neid auf die Männer“ ist, welcher oft dem weiblichen Emancipationsdrange zu Gevatter steht. Wilhelmine v. Hillern hat sich aus dem Ringen mit ihrer Weiblichkeit eine schöne Trophäe heimgetragen, einen Cult des Erhabenen, Gewaltigen, Grandiosen, der zugleich ihrem literarischen Ehrgeize als Wegweiser dient. Man kann diesen Cult kaum schöner charakterisiren, als sie selbst es thut in dem Epilog zur „Geier-Wally“:
„Von dem Kreuz (am Grabe Wally’s und Joseph’s) herab weht es ihn (den Wanderer) an wie eine Klage aus längst verklungenen Heldensagen, daß [113] auch das Gewaltige wie das Schwache dahinsinkt und vergehen muß – doch der Gedanke mag ihn trösten: das Gewaltige kann sterben, aber nicht aussterben. Sei es im Strahlenpanzer Siegfried’s und Brunhild’s, oder im schlichten Bauernkittel eines Bären-Joseph und einer Geier-Wally – immer finden wir es wieder.“
So wäre denn im Ganzen und Großen das literarische Charakterbild Wilhelmine von Hillern’s fertig. Vielleicht findet Mancher, daß es mehr einer Daguerreotypie, als einer Photographie, ein Anderer, daß es mehr einer aus Aphorismen zusammengesetzten Mosaik, als einem beharrlich durchgeführten psychologischen Gemälde gleiche. Wenn es indessen nur dem Originale ähnlich geworden, so ist sein Zweck erfüllt. Allerdings aber gehört zur vollen Treue noch Eines; es handelt sich darum, die Dichterin zu postiren, das heißt ihr die Stelle in dem geistigen Leben und Schaffen der Gegenwart anzuweisen, die ihr gebührt. Denn ob man auch noch so geflissentlich aller Classification aus dem Wege gehe, gewiß ist, daß alles dichterische Schaffen mindestens ebenso viele Impulse von Zeit und Zeitgenossen empfängt, als es der Originalität einen umfassenden Spielraum läßt. Diese Impulse wollen aufgespürt und gewürdigt sein.
Unter den zeitgenössischen Schriftstellerinnen ist es zunächst die Marlitt, welcher Wilhelmine v. Hillern in manchem Stücke gleicht. Namentlich in der Art, die Probleme zu stellen. Eine siegreiche Mannesnatur überwindet ein herbes Frauengemüth. Johannes Möllner und Johannes Hellwig sind Zwillingsbrüder. Aber die sentimentale Eintönigkeit und die aufdringliche sociale Tendenz, welche der Marlitt eigenthümlich sind, fehlen bei Frau v. Hillern. Es muß nicht just ein bürgerlicher Mann sein, der die Vorurtheile einer adeligen Frau bezwingt, oder mindestens ein adeliger Mann, der seine eigenen Vorurtheile überwindet. Das ist ein sehr wesentliches Unterscheidungsmerkmal, denn wo bei der Einen die Tendenz sich breit und selbstgefällig auslegt, ist bei der Anderen für die künstlerische Entwickelung der Raum frei. Im Uebrigen ähnelt Frau v. Hillern der Marlitt auch nur in der ersten Hälfte ihres Schaffens, nämlich in den beiden Romanen „Aus eigener Kraft“ und „Ein Arzt der Seele“. Dadurch, daß sie fortschreitend Schauplatz und Zeit ihrer Erzählungen verändert, stellt sie sich eben weit über die in einen festen Kreis gebannte Rivalin, der sie in der Gunst des deutschen Lesepublicums den Rang ablief. In jener ersten Periode ihrer Production erinnert sie aber auch nicht selten an Fanny Lewald, deren Dialog ihr damals vermuthlich zum Vorbilde diente. Aber der Doctrinarismus der Ostpreußin hat sie nicht angesteckt. Fanny Lewald strebte mit den Romanen, die ihren literarischen Charakter feststellten, durchwegs praktische, sociale und politische Zwecke an und sie mußte deshalb in das Gewühl des Tages hinabsteigen, der Debatten über herrschende Themata sich bemächtigen, mit den Bedürfnissen der öffentlichen Meinung sich auseinandersetzen. Emancipation der Juden, der Frauen, der Individualitäten – es ist der Ton, den die „Jungdeutschen“ angeschlagen hatten, der in Gutzkow’s „Uriel Acosta“ zu seiner classischen Geltung gelangte, der Ton des Vormärz. Man hat, wenn man die ersten Romane der Lewald heute nachliest, bisweilen das Gefühl, als stehe man vor der parlamentarischen Tribüne späterer Tage, oder als habe man einen Leitartikel vor sich. Diese Tendenz ist, indem sie sich selbst persiflirte, durch Freytag’s [114] „Journalisten“ aus der Literatur verdrängt worden. Wilhelmine v. Hillern wurde von ihr nicht mehr berührt; sie konnte die Lebendigkeit ihres Naturells, ihr leidenschaftliches Temperament, das enorme sinnliche Anschauungsvermögen, das ihr innewohnt, anderen Stoffen zuwenden, die mehr zu plastischer Gestaltung drängten; konnte vor allen Dingen sich der Naturbetrachtung widmen, aus der jene gewaltigen Landschaftsbilder aus dem Inn- und Etschthale hervorgingen, denen die deutsche Literatur wenig Gleichwerthiges an die Seite zu stellen hat.
In der zweiten Hälfte ihres bisherigen dichterischen Schaffens („Die Geier-Wally“ – „Und sie kommt doch!“) hört aber überhaupt die Möglichkeit auf, Wilhelmine v. Hillern aus dem Gesichtspunkte der Frauenliteratur zu beurtheilen. Hier muß man schon nach den Männern ausschauen, um Analoges zu finden und zwar nach den Besten. Man denkt an Berthold Auerbach, und Frau von Hillern hat sich selbst in das Cortége des berühmten Dorfgeschichten- Erzählers eingereiht, indem sie ihm schrieb, sie habe in der „Geier-Wally“ auf dem Boden weiter gebaut, den Auerbach urbar machte. Aber ist die „Geier-Wally“ eine Dorfgeschichte? Dem Schauplatze nach allerdings. Aber dieser entscheidet nicht. In diesen Bergwildnissen wächst das Schicksal der Menschen weit hinaus über die enge Sphäre ländlichen Selbstgenügens, so hoch wie etwa der Alpenferner über den Hohentwiel hinauswächst. Darin liegt keineswegs eine Erhöhung Wilhelmine v. Hillern’s über Berthold Auerbach; nur der innere Unterschied zwischen Beiden, zwischen der Muse des behutsamen, mit philosophischer Bedächtigkeit schaffenden Epikers des Schwarzwaldes und der impulsiven, in tragischer Kraft sich steigernden Alpenmuse der Frau v. Hillern soll damit angedeutet sein. Man denkt auch an Georg Ebers und dessen Roman „Homo sum“, wenn man die Erzählung „Und sie kommt doch!“ in’s Auge faßt. Das Studium der Vergangenheit, des klösterlichen Anachoretenthums frappirt sogar bei der Frau, während es an dem Manne nicht besonders auffällt. Aber Georg Ebers ist geklärter, harmonischer; Frau v. Hillern dagegen phantasievoller, gewaltiger und gerade in ihrer letzten Erzählung – excentrisch.
So bleibt Wilhelmine v. Hillern sie selbst, ein originelles Talent, dem nur zu wünschen wäre, daß es in die Grenzen maßvoller Einschränkung sich zurückfinde, die es jüngst in einem einzigen Falle übersprang. Es ist an imposanteren Erscheinungen in unserer zeitgenössischen Literatur kein Mangel; aber was Frau v. Hillern vor Allen voraus hat, ist ihr Temperament, ihr mächtiger Herzschlag, das, was man bei uns in Wien volksthümlich mit dem Worte „Race“ bezeichnet. Die Musen waren ihr günstig; sie hat nie die Wahrheit des französischen Ausspruches empfunden, daß die Literatur eine liebenswürdige Gesellschafterin, aber eine schlechte Ernährerin (compagne aimable, mauvaise nourrice) ist. Möge die Gunst der Musen ihr erhalten bleiben!
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Ernest Meissonier (1815–1891) und Horace Vernet (1789–1863): französische Künstler
- ↑ Vorlage: üch