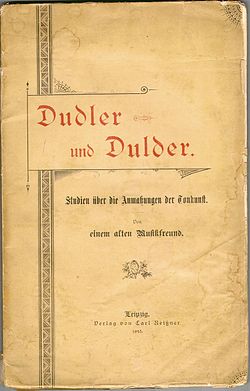Dudler und Dulder
einem alten Musikfreund.
Verlag von Carl Reißner.
1893.
[5] Endlich einmal muß es gesagt werden: denn euer Maaß ist gerüttelt voll, und alle Demut und Schweigsamkeit nimmt ein Ende, wo die Rücksichtslosigkeit von Jahr zu Jahr unverblödeter ihre Orgien feiert…
Die Musik, ihrem innersten Wesen nach eine Gnade, ein Labsal, ein welterlösendes Himmelsgeschenk – in euren Händen, tonwutkranke Dilettanten und Modenarren, ist sie zur Geißel geworden. Ihr habt die Göttin dämonisirt, und die herzliebe wonnige Aphrodite, deren Kuß den frommen Anchises und tutti quanti so selig machte, in die Teufelinne verwandelt, vor der sich Christ und Jude ganz mit der nämlichen Herzbeklemmung bekreuzigen.
Und die Teufelinne übt eine seelenmordende Tyrannei aus, eine Herrschaft, die durch Nichts zu erschüttern ist, einen Despotismus, der schon deßhalb jeden Sturm überdauert, weil eben die Mode ihn stillschweigend anerkennt. Die Herrschaft der souveränen Musik gehört zu jenen conventionellen Rücksichtslosigkeiten, an denen unser Gesellschaftsleben so reich ist; und keine andre von diesen stummen Verabredungen wider [6] das Recht und die Wahrheit flößt dem betrachtenden Geist größre Bedenken ein …
Wir wollen an dieser Stelle nicht nachweisen, daß die gesellschaftliche Moral auch in andern gewichtigen Fragen auf einer wortlosen Uebereinkunft beruht, die mit dem wahrhaft Sittlichen oft im unversöhnlichen Widerspruch steht. Wir wollen nicht accentuieren, daß sogar der ob seiner Feinfühligkeit gepriesene Codex der Ehre Punkte enthält, deren conventionelle Unmoral derb in die Augen springt; wie z. B. die Auffassung, daß es der Ehre eines wahrhaften Cavaliers zwar schnurstracks zuwiderläuft, einem Millionär, mit dem er Baccarat oder Meine-Tante-deine-Tante gespielt hat, tausend Mark länger, als dieser Millionär ihm gestattet, schuldig zu bleiben, während der nämliche Cavalier mit der größten Gemüthsruhe einem Handwerker, der für ihn arbeitet, um den Ertrag seiner Mühen prellt. Vielmehr gilt es uns nur um die Herausgreifung eines recht schlagenden Beispiels für den Begriff der conventionellen Rücksichtslosigkeit, da wir auf diesen Begriff mehrfach im Verlauf unsrer menschheitsfreundlichen Abhandlung zruückkommen werden. Wir möchten auf einem andern völlig entlegnen Gebiet dem wohlwollenden Leser – gleichsam aus Gründen der Propädeutik – ad oculos demonstriren, wie äußerst partheiisch die moderne Gesellschaft verfährt, wenn es sich darum handelt, die Grenzen festzustellen, die man, ohne rücksichtslos zu erscheinen, bei der Belästigung oder Schädigung fremder Interessen zu streifen berechtigt ist.
Es herrscht hier in der That eine überraschende Willkür, die uns nur darum nicht in abstracto entrüstet, weil wir zu sehr an die Allmacht des Conventionellen gewöhnt sind; die uns jedoch sofort mit der Wucht einer empörenden Ungerechtigkeit [7] auf die Nerven fällt, wenn wir einmal in concreto darunter zu leiden haben.
Nehmen wir an, es befinden sich in einem gegebenen Raum zehn Personen, von denen eine zum Schnupfen neigt oder nur eine gewisse Antipathie gegen die atmosphärische Luft besitzt, während die übrigen neun von apoplektischer Anlage, vollblütig, zum Schwindel geneigt, von Congestionen bedroht und ausgesprochene Freunde eines ozonreichen Mediums sind. In dem Raum, wo gleichzeitig ein halbes Dutzend Gasflammen brennt und ein coaksüberfüllter Ofen seine ausdörrenden Gluten verströmt, brütet eine Temperatur von zwanzig Grad Réaumur. Die Luft ist nicht nur durch die Exhalationen von zehn menschlichen Lungen, sondern auch durch die mannigfach untereinander gequirlten Düfte eines ausgewählten Menue’s – Seezunge, Hummersalat, Wildpret, Plumpudding, Fromage de Brie und sonstige Delikatessen – bis zur Unerträglichkeit überladen. Die neun Apoplektiker sitzen mit schweißüberperlten Stirnen keuchend und fauchend vor den Champagnergläsern und schreien nach Kühlung wie der Hirsch nach dem Wasser. Zwei oder drei sind nahezu blaurot; sie haben schon aufgehört, ihren Sekt zu schlürfen, weil ihnen zu Mut ist, als müßten sie in der nächsten Sekunde vor Hitze aus ihrer gepeinigten Haut fahren. Neun schmachtende Männerseelen sind Eins in dem schönen Gedanken, ein Fenster zu öffnen. Der Eine aber, der hagere, ausgemergelte Luftfeind, erklärt mit verschämten Lächeln, er könne das nicht vertragen, es ziehe ihm so … Was ist nun, den Regeln der conventionellen Rücksichtslosigkeit entsprechend, die Folge? Das Fenster bleibt zu! Die neunfache Majorität, die vielleicht ernstlich Gefahr läuft, wird von dem einem miasmafreundlichen Frostmenschen terrorisirt; denn sic volo, [8] sic jubeo, sagt der gesellige Takt, die unfehlbare Stimme des Hergebrachten, der Absolutismus jener stillschweigenden Verabredung, deren Gründe oft so rätselhaft sind, wie die Probleme der Metaphysik.
Und doch könnte der Frostmensch, falls die Luftwellen, die zum geöffneten Fenster hereinströmen, ihm wirklich mehr von seiner leiblichen Temperatur entziehen, als ihm erwünscht ist, sehr leicht seinen Paletot überhängen, während die Apoplektiker, wenn das Fenster geschlossen bleibt, nicht in der Lage sind, die Röcke und Westen bei Seite zu werfen und sich die Kragen vom Hemde zu knöpfen; es sei denn, daß man sich auf der Stundentenkneipe befände oder sonst wo im allerintimsten Eng-Cirkel, was wir im vorstehend skizzirten Fall nicht vorausgesetzt haben.
Kurz, die conventionelle Rücksichtslosigkeit fordert von dem Kulturmenschen, sich neunmal vom Schlag rühren zu lassen, ehe ein empfindlicher Miasmatiker einmal zu seinem Paletot greift.
Ist das vernünftig und logisch? Ist das gerecht? Ist das der wahrhaften Humanität entsprechend? Ich hoffe, selbst die luftfeindlichsten unserer Leser werden mir zugeben, daß eine solche Bevorzugung, so erwünscht sie für Den sein mag, der sich gegebenen Falls ihrer erfreuen darf, thatsächlich die schreiendste Vergewaltigung involvirt, die sich denken läßt.
Es will mich nun in meinem Herzen bedünken, als habe uns neuerdings die Musik-Narrheit in eine ganz ähnliche Situation gebracht, wie jener Frost-Mensch die Luft-Freunde; in eine Situation nämlich – (und ich bitte recht sehr, auf dies tertium comparationis achten zu wollen) – die nur denkbar erscheint unter der Herrschaft der conventionellen Rücksichtslosigkeit.
[9] Ich habe mir die Bezeichnung „Musikfreund“ auf dem Titelblatt dieser Flugschrift wahrlich weder aus Ulk noch aus boshafter Ironie beigelegt. Eher aus Klugheit. Man muß die prinzipielle Musikfreundlichkeit seiner anima candida heutzutage gar scharf betonen, wenn man es unternimmt, Uebelstände zu rügen, die mit der göttlichen Kunst irgend wie im Zusammenhang stehen. Die Musikfanatiker fallen sonst über den Tadler her, wie die hungrigen Wölfe über ein Steppenroß und brüllen dabei aus vollem Halse: „Böotier!“ Ganz besonders ist es die weitverbreitete Species der Kunstheuchler, die sofort ihr „Anathema sit!“ auf den ruhigsten Mann schleudert, wenn er es bei Gelegenheit wagt, über gewisse Punkte seine Privatmeinung zu äußeren. Obschon ich also für den herausgesteckten „Musikfreund“ Gründe der Vorsicht und der Selbsterhaltung nicht völlig in Abrede stelle, will ich doch hier ausdrücklich vor allen neun Musen den Eid darauf ablegen, daß die Bezeichnung vor Allem der Wahrheit entspricht. Ich liebe nicht nur die Musik, nein, ich bin geradezu schwärmerisch in sie verliebt. Mit Albert Möser bin ich der Ansicht, daß die herrlichen Melodieen der „Zauberflöte“ und der Beethoven’schen C-Moll-Symphonie für uns Sterbliche eigentlich viel zu gut sind, und daß ihr Genuß eine der wenigen unschätzbaren Freundlichkeiten bedeutet, die uns der Himmel aus Mitleid dann und wann zukommen läßt… Die phantastischen Träumereien, mit denen der geistreiche Hieronymus Lorm die Leistungen eines Heroen wie Franz Liszt umrankt hat, sind mir so recht aus der Seele geschrieben … Ich höre mit gleicher Empfänglichkeit das süßzärtliche „Nò, nò, resta, gioja mia“ das der sehnsuchtentbrannte Herzensberücker auf das bängliche „Ah, lasciatemi andar via“ Zerlinens antwortet, wie den gewaltigen Ruf [10] des steinernen Gastes: „Don Giovanni! A cenar teco…“ Ich lasse mir meinen individuellen Bedarf eben so wohl das schlichteste Volkslied, wie den über-genialen Tumult des Walkürenritts gelten, wiewohl ich bekenne, daß ich für jene Schlichtheit und Einfachheit häufiger disponirt bin. Dennoch: so sehr mein Gemüt überall da mitschwingt, wo ächte Kunst mit gottbegnadeter Hand in die Saiten greift, so sehr hasse ich den Exceß, den Mißbrauch, die strafbare Ungebühr… Und daß der Exceß, der Mißbrauch, die strafbare Ungebühr auf keinem Gebiet unseres schöngeistigen Lebens so blindwüthig einhertollt, wie auf dem der Musik, daß soll dem Leser in den hier folgenden Blättern … nicht etwa als eine Hiobspost mitgetheilt, nein, ihm aus der innersten Tiefe seines eignen bedrängten Gefühls heraus zum Bewußtsein gebracht werden.
Von einem vergleichsweise unbedeutenden Uebelstand, der sich zunächst mir aufdrängt, will ich nur ganz im Vorbeigehn reden. Ich meine das tadelnswerthe Zu-viel-auf-einmal, das leider nicht nur bei musikalisch-dramatischen Darbietungen, wo die Verantwortung auf den Tondichter fällt, sondern ebenso sehr im Concertsaal und im Privatsalon seine breitschattenden Flügel entfaltet. Selbst Wagnerianer vom reinsten Wasser geben uns zu, daß ein Tag aus den Nibelungen ganz gewaltige Anforderungen an die Genußfähigkeit stellt, wobei dem sakrilegischen Nicht-Wagnerianer unwillkürlich das Goethesche: "Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage" auf den erschauernden Lippen schwebt. Aber das mag noch unkritisirt bleiben, da es nicht wohl angeht, das Rheingold aus Gründen der praktischen Wohlfahrt in zwei Theile zu trennen. Was aber zwingt die Veranstalter eines Concerts, zwei große Beethoven’sche Symphonieen unmittelbar nach einander zu [11] geben? Kunstschöpfungen, die eine Welt für sich darstellen, Tonwerke, die vom begeisterten Hörer die ganze hingebungsfreudige Seele fordern? Es gibt ja Leute, die ohne Ermüdung an einem Nachmittag zwei Diners mitmachen, auch keinerlei Verdauungsbeschwerden davontragen: aber entweder sind das Kraftmenschen von exzeptioneller Begabung, herkulische Charaktere mit richtigem Straußen-Gedärm, – oder sie speisen nur scheinbar. Der Kunst und dem Kunstgenuß aber ist doch mit dieser Scheinbarlichkeit nicht gedient. Der musikalische Wirt rechnet auf wirkliche Esser, nicht auf Halb-Gäste, die ab und zu einmal knabbern und mit dem Seufzer der Uebersättigung gerade die consistentesten Gänge vorbei lassen. – Auch im Lieder-Concert wird dem herrlichen Grundsatz Bion’s, daß Maaß halten gut sei, beinahe regelmäßig die Achtung verweigert. – Dies unaufhörliche Stapeln von Eindruck auf Eindruck läuft ganz auf die Barbarei thörichter Schlemmer hinaus, die den Genuß am Wein zu erhöhen glauben, wenn sie eine recht große Anzahl von Sorten auffahren lassen. In Wirklichkeit stumpft sich das Weinverständniß mit jeder neu ausgetragenen Marke bedenklicher ab, und zuletzt wird die Zunge so schlaff und pelzig, daß sie die einfachsten Ur-Elemente der Trinkwissenschaft nicht mehr beherrscht und, wenn man dem Zecher die Augen verbindet, kaum noch im Stande ist, Rotwein von Weißwein zu unterscheiden. Aber so ist der Mensch: selbst beim Kunstgenuß wohnt ihm etwas von jener animalischen Gier inne, die den Wolf schlingen statt kauen heißt, und den Bauernjungen beim Reisbrei sich mit eiserner Consequenz überfressen läßt. Er kann nicht genug bekommen – und übersieht dabei, daß alle Genußmittel, auch die geistigen, Gifte werden, sobald man die Dosis zu stark nimmt. [12] Man könnte über dieses eminent kunstfeindliche Zuviel und seine Genesis Bände schreiben. Hier genüge der kurze Hinweis. Der Schwerpunkt dessen, was ich die conventionelle Rücksichtslosigkeit der Musik nenne, liegt wohl auf andern Gebieten.
Für mein Gefühl bedeutet es an und für sich schon eine conventionelle Rücksichtslosigkeit, daß unsere Epoche die Musik so einseitig zum Nachtheil der Poesie und der bildenden Künste bevorzugt.
Dieser kaum zu bestreitende Uebelstand ist während der letzten Jahre hundertfältig von Leuten betont worden, denen die Unterstellung einer grundsätzlichen Musikfeindschaft oder gar der Verständnißlosigkeit mit aller Kraft der Sophistik nicht aufgehalst werden kann.
So protestirt Paul Heyse in seinem Künstlerroman, den er „Im Paradiese“ betitelt, sehr energisch gegen die tadelnswerthe „Erhöhung der Musik über alle übrigen Künste“. Seinem Helden, dem Bildhauer Jansen, legt er in dieser Beziehung Worte in den Mund, die unzweifelhaft als ein Bekenntniß des Autors selbst zu betrachten sind. Jansen, der die Suprematie der Musik angreift, erklärt ausdrücklich, die Musik sei ihm ein Lebensbedürfniß; wenn er sie längere Zeit zu entbehren habe, so fühle sich seine Seele eben so wenig wohl dabei wie sich sein Körper wohl fühle, wenn er sich eine Zeit ohne Bad zu behelfen habe. Als nun die Gegner diesen Vergleich profan finden, vertheidigt er die Berechtigung desselben wie folgt:
„Nicht wahr,“ sagt er, „ein Bad regt an und aus. Es beruhigt oder belebt das Blut, es spült den Staub des Werkeltags von den Gliedern und beschwichtigt allerlei Schmerzen. Aber es stillt weder Hunger noch Durst, und wer zu häufig badet, fühlt seine Nervenkraft erschlaffen und sein Blut überreizt [13] werden. Ist es nun nicht ähnlich so mit der Musik? Vielleicht hat man es nur ihr zu verdanken, wenn die Menschen ihre Bestialität nach und nach verloren haben und gottähnlich geworden sind. Das aber steht nicht minder fest, daß Menschen, die nun diesen Genuß übertreiben, nach und nach in ein pflanzenhaftes Traumleben versinken, und daß zu einer Zeit, wo man dahin käme, die Musik wirklich als die erste und höchste Kunst zu feiern, die höchsten Aufgaben der Menschheit nicht gelöst werden würden … Ich weiß, das sind Ketzereien, die man in gewissen Kreisen nicht vorbringen darf, ohne ein bischen gesteinigt zu werden. Auch möchte ich mit einem Musiker nicht darüber streiten, da er kaum begreifen würde, was ich eigentlich meine. Das In-Tönen-Denken, was diese Kunst mit sich bringt, löst mit der Zeit alles Feste im Gehirn in eine weiche Masse auf, und nur die großen, wahrhaft schöpferischen Talente bewahren sich die Fähigkeit und Neigung für andre geistigen Interessen. Daß die höchsten Meister in einer jeden Kunst einander ebenbürtig sind, brauche ich nicht erst zu versichern. Auf die Uebrigen aber paßt wahrhaftig das Wort, das Jemand von den lyrischen Poeten gesagt hat: sie sind die Gänse, die auf die Leber gemästet sind; treffliche Lebern aber kranke Gränse. Wie soll auch das Gleichgewicht des Geistes erhalten bleiben, wenn Jemand neun Stunden des Tags vor einem Instrument sitzt und beständig dieselben Passagen exercirt? Aber freilich, eine solche Aufopferung ist nur möglich bei einem falschen Begriff vom Wert der Sache.“
Die conventionelle Rücksichtslosigkeit, mit der die Musikpropheten jede halbwegs häretische Meinung niederzuschreien bemüht sind, richtet sich natürlich auch gegen den tollkühnen Bildhauer, der solche Worte in eine Gesellschaft zu schleudern [14] wagt, wo alle übrigen Künste nur für halbwerthige Stiefschwestern der Alleinherrscherin gelten. Ein musik-fanatischer Professor und Hauptästhetikus widerspricht ihm energisch und führt ein paar schlecht gezielte aber brutal gemeinte Hiebe gegen die Bildhauerei.
„Sie reden sich um den Hals, mein Wertester!“ ruft er mit siegesgewisser Stimme. „Sie könnten ebenso gut in einer Moschee behaupten, daß Allah nicht Allah und Mahomet nicht sein Prophet sei, wie unter dieser begeisterten Jugend, daß es etwas Göttlicheres gäbe, als die Musik, und daß jemals die Hingebung an sie, ihr Dienst, ihr Cultus zu weit getrieben werden könne. Was würden Sie sagen, wenn Jemand behauptete, wer neun Stunden des Tags den Meißel führe, dem müsse mit der Zeit Hören und Sehen vergehen, dessen geistige Kraft werde zuletzt erstarren und verstarren, und seine Seele so staubig und schmutzig werden, wie die Blouse, in der er seine Steine klopft?“
Worauf Jansen ihm antwortet:
„Was ich sagen würde? Daß es in jeder Kunst Künstler und Handwerker gibt, und daß die letzteren ebenso wenig von dem Gotte wissen, dem sie dienen, wie der Küster, der in der Kirche ausfegt und mit dem Klingelbeutel herumgeht. Nur eine Kunst von allen kennt den Stand der Werkstatt nicht, hat keine Handlanger und Gehülfen, höchstens Pfuscher, die sich Meister dünken; aber selbst diese wissen nichts von bloßen seelenmordenden und sinnelähmenden Fingerfertigkeiten, und darum ist sie die höchste und göttlichste, vor der die andern sich neigen, die sie als ihre Herrin und Meisterin verehren sollten. Ihnen, der Sie Vorlesungen über Aesthetik zu halten pflegen, würde ich mich schämen noch ausdrücklich zu sagen, daß ich hier von der Poesie rede, wenn Sie nicht in Ihrem“ [15] Trinkspruch (auf die Suprematie der Musik) eine Majestätsbeleidigung gegen diese höchste Muse begangen hätten, die ich nur damit entschuldigen kann, daß Sie sich aus dem Tempel der wahren Gottheit in eine Moschee verirrt haben.“
Theoretisch wird das Uebergewicht dieser „wahren Gottheit“ denn in der That auch nur von einer verschwindenden Minorität der Kunstphilosophen geleugnet; aber diese Minorität befindet sich in dem Fall der zugfürchtigen magern Herrn unter den neun Apoplektikern. In praxi hat sie das Uebergewicht. Die Freunde des poetischen Sauerstoffs müssen sich beugen: das Fenster bleibt zu!
Ganz ähnlich, wenn auch nicht mit der gleichen Beredsamkeit wie Paul Heyse, äußert sich Hector Malot in seiner „Ghislaine“. Der Held, mit dem sich der Autor in diesem Fall identifizirt, sagt zu Fräulein von Chambrai, die seiner Meinung zu Folge des Guten zu viel thut, etwa das Nachstehende:
„Ich liebe die Musik als Erholung, aber ich liebe sie nicht als Beschäftigung. Mit der Musik verhält es sich meines Erachtens wie mit den Wohlgerüchen. Gelegentlich einen Wohlgeruch einzuschlürfen ist köstlich; in einer Luft, die mit Wohlgerüchen geschwängert ist, dauernd zu athmen, ist unangenehm und gefährlich. Während die übrigen Künste uns stärken, schwächt die Musik, sobald man ihren Genuß übertreibt.“
Noch einen anderen Punkt, der die conventionelle Rücksichtslosigkeit der Musikfanatiker gegen die Rechte der Poesie beweist, führt Malot an: das zweierlei Maaß nämlich in der Beurtheilung literarischer und musikalischer Kunstwerke. Die prüde Engländerin, die bei Ghislaine als Gouvernante fungirt, entsetzt sich nämlich vor der geringsten Freiheit bei Lamartine, [16] Victor Hugo, Alfred de Musset, ist aber vollständig blind gegen die größten Kühnheiten der zeitgenössischen Oper. Das Verhalten des Königs Franz I. gegen die Tochter Triboulet’s nennt sie infam; das des Herzogs von Mantua gegen die Tochter des Rigoletto findet sie harmlos. In Deutschland erlebt man das Gleiche mit der Veurtheilung gewisser Scenen des Don Juan und ähnlicher nicht halb so verfänglicher Momente in den Dichtungen neuerer Dramatiker.
Wir haben vor längerer Zeit anderwärts den Versuch gemacht, die augenscheinliche Ungerechtigkeit, mit der die Majorität des Publicums die Musik über sämmtliche Schwesterkünste emporschraubt, in ihren Ursachen aufzudecken. Das Resultat dieses Versuchs läßt sich ungefähr zusammenfassen wie folgt:
Die meisten Menschen kennen nur ein Interesse: das sinnliche. Dies gilt zunächst buchstäblich und bezieht sich sonach auf die einseitigen Sympathieen der Masse für Alles was die Sinne erregt und befriedigt; dann aber auch, weitergefaßt, auf den rohen, mit dem Wesen der Kunst in keiner Berührung stehenden Zeitvertreib. Ganz besonders schwärmt diese Majorität für Alles, was neben sonstigen ihr willkommenen Vorzügen die Eigenschaft hat, sie der Nothwendigkeit des Denkens zu überheben. – Von Zeit zu Zeit überläßt sich auch der geistig begabte Mensch mit besonderem Wohlgefühl einem Natur- oder Kunsteindrucke, der das Individuum gleichsam ganz in Empfindung auflöst, einer Kunst, bei welcher uns, wie Paul Heyse sagt, die Gedanken vergehen; das grundsätzliche Perhorresciren des discursiven Denkens, soweit dasselbe nicht dem Erwerb dient, – die Antipathie gegen jedes geistige Mitschaffen beim Genießen – das charakterisirt den intellektuellen Pöbel. Existirt nun eine [17] Gattung der Kunst, die vermöge des von ihr verwendeten Materials einmal den Sinnen unmittelbar schmeichelt, zweitens aber das Denken so gut wie gar nicht in Anspruch nimmt, so läßt sich a priori vermuten, diese Kunst werde unter sämmtlichen Concurrentinnen die größte Volkstümlichkeit besitzen. Das gilt denn thatsächlich von der Musik und innerhalb der Musik vom Gesang, der durch die Einfachheit seiner Mittel und durch das Mithereinspielen des Persönlichen, Individuell-Sinnlichen über die complicirtere Instrumentalmusik den Sieg davonträgt. Wer daran zweifelt, daß die Musik zunächst durch die Macht des Naturschönen und erst in zweiter Linie als Kunstschönes wirkt, der möge sich in’s Gedächtniß rufen, daß harmonisch gegliederte Töne ihren Effekt aus Individualitäten ausüben, bei denen auch die dämmerndsten Schatten künstlerischen Verständnisses nicht vorausgesetzt werden können. Nicht nur Kinder im allerzärtesten Alter, nicht nur Wilde, nicht nur Cretins, nein, sogar Tiere unterliegen dem allgewaltigen Zauber des sinnlichen Wohllauts, wie denn bekanntlich die Araber ihre müde gewordenen Kameele durch den Klang eines Instruments zu neuer Leistungsfähigkeit anfeuern. Nur geben sich diese müde gewordenen Kameele nicht für Kunstkenner aus: das ist der ganze Unterschied zwischen ihnen und der Mehrheit des Publikums.
Das echte Verständniß für das Kunstschöne ist äußerst spärlich verbreitet. Es wird also, um den Forderungen der Mode und des ästhetischen Anstands Genüge zu leisten, einfach erheuchelt. Das aber ist oft mit einem Aufwand von Selbstbeherrschung verknüpft, der die Leute verstimmt. Einer Aufführung des Hamlet oder des Nathan beizuwohnen, bedeutet für zahllose „Kunstfrenude“ eine Tortur. Bei ihrer [18] Vergötterung der Musik dagegen können die „Kunstfreunde“ ihrem wahren Instinkt, der Lust am Sinnlichen, treu bleiben und doch dabei ihr künstlerisches Gewissen befriedigen. Dem reinen Gedanken diesem ohnehin lästigen, überflüssigen Kameraden bringt man nicht gern ein Opfer; auch nicht der denkenden Phantasie, denn auch diese erhebt unangenehme Ansprüche an die Bequemlichkeit. Zehn Mark für ein Diner aber hat man allemal übrig, und was man dem Gaumenschmaus bewilligt, das gönnt man doppelt freudig dem Ohrenschmaus, da sich bei diesem die oben geschilderten Nebenvorteile – Beruhigung des ästhetischen Gewissens – herausstellen. Wären diese Nebenvorteile mit dem Diner verknüpft, so wäre Diniren künftig die populärste und am meisten vergötterte Kunst. Macht es zur Mode, auserlesene Menus aus ästhetischen Gesichtspunkten durchzuspeisen, gebt den Leuten die Möglichkeit, von der stimmungsvollen Composition des Ragoûts, von der klassischen Structur der Pasteten und dem stilgerechten Arom des Fruchteises zu faseln, so wird vom Nordmeer bis zu den Alpen unter der heuchlerischen Maske des Kunstinteresses – sit venia verbo – gefressen werden, daß es nur so eine Art hat! Jede Indigestion gilt alsdann für ein Zeugniß artistischen Hochsinns; jeder Katzenjammer für die leuchtende Aureole des Auserwählten. Hübschen Köchinnen wird man die Pferde ausspannen; verdienstvolle Saucenkünstler werden in Lorbeer ersticken; Pastetenbäcker und Rôtisseurs geben Gastrollen zu tausend Dollars den Abend. Da dies leider noch nicht der Fall ist, so übt einstweilen der wohlfeile Musik-Enthusiasmus jene Tyrannis aus, die wir als conventionelle Rücksichtslosigkeit gegen die Schwesterkünste bezeichnet haben.
Innerhalb der allgemeinen musikalischen Selbstüberhebung [19] gibt es eine Specialität, deren verblüffende Hoffart schon das Gebiet des Pathologischen streift: der Unfehlbarkeitsdünkel des Wagnertums. Der Leser darf unbesorgt sein: wir wollen die Sintflut der Wagner-Literatur nicht einmal um das Bruchstück einer polemischen Skizze vermehren. Die Frage, ob der hochmögende Schöpfer der Götterdämmerung wirklich der längstersehnte Messias der Kunst ist, für den er sich selbst aus vollgläubiger Seele gehalten hat, liegt weit ab von dem, was hier Gegenstand unsrer Betrachtung ist. Uns gilt es lediglich die Hervorhebung der conventionellen Rücksichtslosigkeit, mit der das Wagnertum überall und bei jeder Gelegenheit Andersdenkende auf’s Schaffot schickt. Neben dem Dogmen-Trotz der kirchlichen und der socialdemokratisch-materialistischen Orthodoxie kenne ich kaum etwas Anmaßenderes, Einseitigeres und Intoleranteres, als den ächt in der Wolle gefärbten Wagner-Katholicismus. Im Kampfe mit diesen Privilegirten kommt, wie Juvenal sagen würde, kein Advokat und kein Marktschreier aus, ja nicht einmal eine Salondame. Jede noch so bescheidene Skepsis ist Barbarei oder Hochverrat: alles Uebrige, was die begnadetsten Meister in Klang und Wort, in Farben und Formen jemals hervorgebracht, hat nur insoweit Geltung, als mit jener Ur-Norm vereinbar ist. Sonst: überwundener Standpunkt, Unkunst; im besten Fall: ahnende Vorbereitung auf den Gewaltigen, der da vollenden sollte, Zurechtstimmen des unendlichen Saitenspiels für den großen Hineingreifer, messianische Weissagung. Man muß es gehört haben, mit welch’ souveräner Geringschätzung erfolgreiche Interpreten der Wagner’schen Tonschöpfungen über die herrlichsten Meisterwerke nicht-wagner’scher Richtung witzeln und hohnlächeln, Meisterwerke, die für den unbefangnen Geschmack noch keineswegs abgewelkt, sondern [20] in frischer Jugendschöne zu Herz und Gemüt sprechen! Und Eins vor Allem soll die Wagner’sche Kunst von dem rein ephemeren Tongestammel der Uebrigen unterscheiden: die ewige Gültigkeit ihrer Principien, die zeitlose Dauer, ihr Kunsttum par excellence. Wagner selbst hat bekanntlich in seinem geflügelten Wort: ‚Jetzt haben Sie eine Kunst‘ und früher schon in dem klassischen Vorwort zum „Ring der Nibelungen“ diese Parole der Selbstüberhebung ausgegeben. „Zwei Grundwahrheiten“ so urtheilt der maßvolle Eduard Hanslick „zwei Grundwahrheiten schreiten das ganze Vorwort hindurch stolzen Hauptes neben einander her. Erstens die Ueberzeugung, daß Alles, was überhaupt unter dem Namen Oper besteht, wert ist, daß es zu Grunde gehe, und zweitens, daß Wagner’s Nibelungenring ein außerordentliches Kunstwerk ist, für dessen Vorführung keine Mühe und kein Opfer zu groß sein kann. Wagner thront in diesem Vorwort, wie Gott Vater beim jüngsten Gericht: zur Rechten stellt er die allein gerechten Wagner’schen Opern, links, für den Schwefelpfuhl, alles Uebrige.“
Aus solchen und ähnlichen „Grundwahrheiten“ baut sich im Hirn der Wagner-Enthusiasten der Irrwahn auf, die Tonkunst Wagners sei die absolute Verkörperung der ewigen Schönheitsgesetze. Daher sie denn nur mit der Menschheit selber zu Grund gehen könne.
Die ewigen Schönheitsgesetze! Mit dieser Phrase wird so erschrecklich viel Unfug getrieben, daß es wohl einmal lohnt, dem dreisten Gespenst ein wenig in die Physiognomie zu leuchten.
Und eh’ ich das thue, sei mir vergönnt, dem Leser ein Abenteuer zu referiren. Das Abenteuer ist rein innerlicher [21] Natur, aber es hat das Gute, vielleicht unterhaltsamer zu sein, als eine starr-theoretische Auslassung…
Es war im verwichenen Herbst. Ich hatte kurz vor Einbruch der Dämmerung die vergilbten Blätter einer alten literarisch-kritischen Zeitschrift durchstöbert. Der eigentümliche Modergeruch, der dem ehrwürdigen Folianten in gewaltigen Duftwellen entströmte, war mir zu Kopf gestiegen. Nicht minder narkotisch hatte eine Besprechung der „Römischen Elegien“ Wolfgang Goethe’s gewirkt. Die köstlichen Dichtungen des Altmeisters waren damals die haute nouveauté des Tages, und Alles, was eine kritische Feder führte, versuchte sich an den melodischen Rhythmen dieser modernen Antike.
Mein moderduftiger Folianten-Kritiker erging sich einleitungsweise in mysteriösen Erörterungen über die ewigen Sittengesetze. Denn für gewisse Moralphilosophen bedeuten die ewigen Sittengesetze genau das Nämliche, was für den Kunstphilosophen die ewigen Schönheitsgesetze: ein volltöniges, unantastbares Axiom! Wie der Musik-Aesthetiker spricht: Der Meister, den ich vergöttre, ist ewig; so lange es eine Menschheit gibt, wird er gekannt, gepflegt, geliebt und bewundert werden – so spricht der conservative Ethiker: Was gut und sittlich ist, das wird gut und sittlich bleiben, solang es in unserer pochenden Brust einen kategorischen Imperativ, ein unverfälschtes Gewissen gibt…
Also der Kritiker meiner vergilbten Zeitschrift fußte auf jenem Axiom und wandte es praktisch auf den conkreten Fall an. Daß ich’s nur gleich gestehe: er ließ kein gutes Haar an Wolfgangs „Römischen Sünden“. Seine catonische Moral fand die Offenheit, mit welcher der Dichter sein Verhältniß zu Faustina behandelt, „cynisch“, da es klar [22] zu Tag liege, daß besagte Faustina nicht als legitim angetraute Gemahlin, sondern als vagabundirendes Frauenzimmer ohne jeden sittlichen Halt zu denken sei. Alle Einwände, wie zum Beispiel die Behauptung, der Sänger habe sich in die moralische Denk- und Gefühlsweise des Altertums versetzt und dem Properz nachgeeifert, der doch ungenirt und unbeanstandet sein: „Lectule deliciis facte beate meis!“ in die klassische Luft seiner Epoche hinausjubilire, verwarf der[WS 1] schroff-urtheilende Kunstrichter als unzulänglich, sintemalen die ewigen Sittengesetze zu allen Zeiten die gleichen seien. Wie der Donner dem Blitz, so folge in der Seele des correkt organisirten Menschen die Entrüstung dem moralischen Verstoße – ganz unabhängig von den Schwankungen einer äußerlichen Mode. Dieses angeborene Sittlichkeitsgefühl könne zwar momentan getrübt, aber nie wesentlich modificirt werden. Johannes Wolfgang von Goethe sei also trotz seiner großen dichterischen Begabung ein unmoralischer Autor und verdiene von wohlgesinnten deutschen Familienvätern fürderhin nicht mehr gelesen zu werden.
So mein Kritiker aus dem letzten Decenium des vorigen Jahrhunderts.
Seine Bemerkungen hatten mich nachdenklich gemacht. Es war inzwischen vollständig Nacht geworden, und da ich nichts Besseres zu thun wußte, so streckte ich mich langswegs auf das Sopha und lauschte dem einthönigen Ticken der Pendeluhr – eine Beschäftigung, die mich nach wenigen Minuten in einen magnetischen Halbschlaf wiegte.
Während dieses Zustandes hatte ich einen seltsamen Traum, dessen vornehmste Züge ich hier zu Papier bringen will.
Ich sah mich an den Ufern des Ganges, in phantastischer [23] Landschaft; die Kämme des fernen Gebirges glühten in Purpur eines orientalischen Sonnenunterganges; der Palmenhain rauschte im Abendwind, und „fromme Gazellen“ traten aus dem Dickicht hervor und schlürften die Wellen des heiligen Stromes…
Während ich ihnen so zuschaute und im Anblick der langsam dahinflutenden Gewässer ganz melancholisch wurde, fühlte ich plötzlich, wie sich eine Hand auf meine Schulter legte. Ich kehrte mich um. Es war ein ernster, philosophischer Inder in langem, wallendem Gewande, etwas bleich, aber doch wohlgenährt und von augenscheinlicher Gutmütigkeit. Er wünschte mir in sanftklingendem Prakrit einen guten Abend und hieß mich willkommen im Reiche Buddha’s und seiner beschaulichen Diener. Ich wunderte mich anfänglich, daß mir die indische Conversationssprache so geläufig war, obgleich meine akademischen Sanskrit-Studien das Embryonen-Stadium nicht überschritten hatten: indeß, wo der Ganges flutet, sind alle Dinge möglich, und wenn Plato behauptet, das Lernen sei nur die Wiederbelebung von Reminiscenzen aus einem früheren Dasein, so konnte ich mir sehr wohl einreden, bereits vor mehreren Jahrhunderten als Pariah die hindostanische Luft geatmet zu haben.
„Mein Freund,“ sagte der Inder, „wie lange gedenkst Du hier am Ufer zu stehen und über die Geheimnisse des Daseins nachzugrübeln?“
„Ich? Hältst Du mich für einen Weltweisen?“
„Nun, ich meinte nur… weil Du so stumm und in Gedanken verloren…“
„Du irrst, Eingeborner!“
„Wohlan, gestatte mir denn die Frage: Was hast Du vor für heute?“
[24] „Nichts.“
„Vortrefflich. Hiernach dürftest Du wohl geneigt sein, meiner Einladung Folge zu leisten. Ich bin Mahaguma, der Kritiker. Ohne Zweifel hast Du mich nennen hören?“
„Mahaguma… Der Name kommt mir bekannt vor… Was kritisirst Du?“
„Dramatisches, nur Dramatisches.“
„Ah, Du wärest…“
„Der Referent des ‚Grünen Bambusrohres‘. Heute geht im Nationaltheater unserer ehrwürdigen Provinzialstadt Dêvasipatam eine hochinteressante Novität in Scene. Ich verfüge just über ein zweites Freibillet. Willst Du?“
„Mit Vergnügen. Du bist in der That für einen Kritiker außerordentlich liebenswürdig.“
„So komm. In einer Stunde wird man beginnen. Wir haben noch weit bis nach Dêvasipatam.“
„Dêvasipatam… Wo liegt dieses vielsilbige Gemeinwesen?“
„Zweihundert Meilen landeinwärts.“
„Besitzest Du irgend ein diabolisches Faß oder einen mephistophelischen Mantel…?“
„Wie prosaisch! Seit den dreißiger Jahren machen wir unsere Luftreisen auf Flügeln des Gesanges.“
Er zog eine Leier aus der Tasche und präludirte. Dann begann er eine prakritische Uebersetzung des berühmten deutschen Liedes:
Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh’…
Kaum hatte er die erste Strophe gesungen, als eine unsichtbare Macht uns emporhob und pfeilgeschwind durch [25] den Aether trug. Wenige Minuten später kamen wir vor dem Portale des Dêvasipatamer National-Theaters zu Boden.
Eine dichte Volksmenge drängte sich nach der Kasse. Auf großen dreieckigen Anschlagezetteln war zu lesen:
Die schöne Madora.
Trauerspiel in 5 Acten
von Vasadalhi,
dem gekrönten Dichter der Inder.
Dieses wahrhaft erschütternde Werk des erhabenen Poeten ist gleichwohl so reich an zarten und lieblichen Zügen, daß die geehrten Zuschauer das Höchste erwarten dürfen, was die dramatische Kunst bis zur Stunde geleistet hat. Kalidasa ist nicht gewählter, kräftiger, hinreißender als unser Vasadalhi, der treffliche Sohn Dêvasipatams.
Die Schauspielerin, welche die Rolle der Madora gibt, ist das schönste Mädchen, das jemals in unserer Stadt aufgetreten ist. Sie hat Augen wie Feuer, Zähne wie Elfenbein, Lippen wie Sammet und einen Busen wie frisch erblühte Wasserlilien. Auch singt sie wie eine Nachtigall.
Ich lade euch Alle ein, Bürger der Stadt und Bewohner des flachen Landes.
Valaveia der Aeltere,
Direktor des National-Theaters.
[26] Mein Begleiter ließ mir kaum Zeit, dieses interessante Dokument mit dem erforderlichen Behagen zu studiren. Er hatte seinen Arm in den meinigen gelegt und zog mich jetzt mit sanfter Gewalt nach einem Seitenpförtchen, das auf ein dreimaliges Pochen geöffnet wurde.
Wir betraten einen spärlich erleuchteten Korridor und gelangten schließlich in die Loge der Kritiker, wo wir drei oder vier ernste Männer eifrig mit Schreiben beschäftigt fanden.
„Störe sie nicht!“ sagte Mahaguma leise, indem er den Finger an seine Lippen legte.
„Was schreiben sie denn?“ fragte ich ebenso leise.
„Ihre kritischen Berichte,“ entgegnete Mahagnma.
„Schon jetzt? Aber das Trauerspiel hat ja noch gar nicht begonnen.“
„Das thut nichts. Wir Inder verfassen unsere Referate stets im Voraus. Aber verhalte Dich jetzt ruhig und gewärtige der Dinge, die da kommen sollen.“
Es währte noch mehr als eine halbe Stunde, bis der Vorhang in die Höhe ging. Das Theater hatte sich inzwischen gefüllt; Mahaguma’s kritische Plauderei für das „Grüne Bambusrohr“ war fertig geworden.
Die Scene stellte einen prächtigen Park vor. Im Hintergrunde gewahrte man ein elegantes Landhaus. Rechts auf einer marmornen Ruhebank saßen zwei junge Männer und conversirten.
Ihr Gespräch drehte sich um eine Bajadere, und zwar ergab es sich, daß besagte Bajadere mit der Madora des Titels identisch war.
Der Eine pries ihre Reize ganz im Tone des dreieckigen Theaterzettels, nur noch etwas lebhafter, farbenreicher, [27] überschwänglicher; der Andere lobte ihr freundliches Wesen und ihre entgegenkommenden Manieren. Beide stimmten darin überein, Madora sei das Ideal eines schönen, liebenswürdigen Weibes.
Gleich darauf erschien die Bajadere selbst. Sie war sehr luftig gekleidet und unverschleiert. Es entspann sich nun ein Huldigungs-Wettstreit, der damit endete, daß der eine der beiden Männer die Faust ballte und im Pathos des beleidigten Ehrgefühls die vernichtenden Worte rief:
Ist Alan mehr als ich?
Weh’ mir, Verrätherin,
Holdselig lächelnde Schlange!
So lohnst Du Gadi’s Freundschaft?
Gab ich Dir nicht des Goldes Fülle
Und silberne Spangen
Und weißlich schimmernde Perlen?
Zitt’re, Verruchte!
Zitt’re!
Meine Rache wird Dich verfolgen
Bis zum Tage Nirwana’s,
Des Weltenschlummers!
Mit dieser Apostrophe entfernte er sich; Madora zuckte die Achseln, reichte dem Zurückbleibenden Alan die Hand und begab sich, vom Beifall des Publikums begleitet, ins Haus. So schloß der erste Act.
„Aber das ist ja skandalös unsittlich!“ sagte ich zu Mahaguma. „Eine Bajadere, ein feiles Frauenzimmer auf die Bühne zu bringen und ihre Geheimnisse auszukramen – Pfui!“
„Unsittlich?“ wiederholte Mahaguma erstaunt … „Wie so?“
[28] „Eine Bajadere! Ich bitte Dich!“
Er schüttelte den Kopf. In diesem Augenblick ging der Vorhang wieder auf. Die Tragödie nahm ihren Fortgang. Meine Entrüstung wuchs. Madora erschien trotz ihres schimpflichen Gewerbes im vollsten Glorienscheine der Poesie. Ihre „edle Natur“, ihre „schöne Weiblichkeit“ ward nachdrücklichst vom Dichter betont. Ich war starr vor Verwunderung. Die indischen Frauen applaudirtens beim Aktschluß mit einer Vehemenz, die mich wie kaltes Wasser überschauerte.
„Mahaguma,“ sagte ich, „eure Dramatiker sind schamlose Gesellen!“
„Wie verstehe ich das?“
„So etwas übersteigt doch das Mögliche! Eine käufliche Dirne als Heldin einer Tragödie — und in welchem Stile behandelt!“
„Aber ich weiß in der That nicht…“
„Pfui, pfui!“
„Du scheinst an einem gesellschaftlichen Institute Anstoß zu nehmen, das in Hindostan durchaus nicht als verwerflich betrachtet wird. Die Bajaderen sind ganz wohlgeachtete Mädchen. Es ist durchaus nicht schimpflich, sich diesem Stande zu widmen. Die Töchter der besten Familien…“
„Schweig’! Ich habe genug von euren Dramatikern. Komm mit nach Deutschland; es ist just noch Zeit für heut’ Abend … Ich will Dir doch zeigen, was wir unter der sittlichen Aufgabe der Bühne verstehen! Komm, ich beschwöre Dich!“
„Gut, mir soll’s nicht darauf ankommen; meine Kritik für’s ‚Grüne Bambusrohr‘ ist ja fertig. Wohin also?“
[29] Ich nannte ihm eine süddeutsche Residenzstadt. Er zog die Leier hervor, präludirte und sang:
Es fällt ein Stern herunter
Aus seiner funkelnden Höh’;
Das ist der Stern der Liebe,
Den ich dort fallen seh’.
Alsbald entschwebten wir durch das halbgeöffnete Fenster und sausten dem Westen zu. Nach vier Minuten hatten wir die Sonne eingeholt; als wir die deutsche Grenze erreichten, war es noch heller Tag. Wir kamen in der Nähe des Hoftheaters zu Boden. Erst in zwei Stunden sollte die Vorstellung beginnen. Da die Luftfahrt uns Beide durstig gemacht hatte, so führte ich meinen Begleiter in ein benachbartes Bierhaus, wo wir unter mannigfachen Gesprächen über Indien und seine Schönheiten, über Buddha und seine Lebensweisheit, über deutsche und orientalische Verhältnisse etc. etc. den ersehnten Augenblick heranwarteten.
Mein Blick fiel, wie in Dêvasipatam, auf den Theaterzettel. Ich las:
Badecuren.
Lustspiel in einem Act
von
G. zu Putlitz.
„Vortrefflich!“ sagte ich zu Mahaguma. „So sind wir der Mühe überhoben, den ganzen Abend vor der Rampe zu sitzen. Dieses kleine Salonstück wird ausreichen, Dir von [30] der sittigen, distinguirten Manier unserer Dramatiker einen Begriff zu geben. Jeder Anklang an das Heikle, Undelikate ist sorgfältig vermieden; die Frauen-Charaktere, mit denen der Dichter uns bekannt macht, sind lebenswahr, aber honnet; kein Mädchen braucht bei ihrem Anblick zu erröthen…“
„Ich bin wirklich neugierig!“ versetzte der Inder ein wenig pikirt.
…Die Stunde schlug. Wir nahmen zwei Sperrsitze und verfügten uns in den Musentempel, der bereits von zahlreichen Besuchern wimmelte.
Die Vorstellung begann. Reinhold ärgerte seine Mutter und bewunderte seine Cousine; Louise, die reizende Wittwe, ließ sich von dem lebenslustigen Vetter zur Sympathie für das Studentenleben und schließlich zur Liebe und Verlobung hinreißen … Der Vorhang fiel und das Publikum klatschte – ganz wie in Dêvasipatam.
Mahaguma hatte inzwischen regungslos dagesessen. Seine Brust rang nach Atem …
„Aber das ist ja skandalös unsittlich!“ stammelte er endlich mit bebender Stimme.
„Unsittlich? Wie so?“
„Eine Wittwe! Eine Wittwe, die sich nach dem Tod ihres Gemahls nicht zu Ehren Brahma’s verbrennen läßt, sondern in schnöder Sinnlichkeit, in ruchloser Impietät nach neuen Liebesbanden jagt … Pfui!“
„Aber ich bitte Dich …“
„Rede kein Wort! Eure Dramatiker sind schamlose Gesellen!“
„Du scheinst an Verhältnissen Anstoß zu nehmen, die hier zu Lande als selbstverständlich betrachtet werden. Ich versichere Dich, … dergleichen ist ganz gewöhnlich! Die [31] Töchter unserer besten Familien verheirathen sich nach dem Tode ihres ersten Gemahls ohne Anstand zum zweiten Mal…“
„Pfui!“ wiederholte er. „Wahrhaftig, mein Freund, ich bin kein Rigorist – aber die ewigen Sittengesetze, die Principien des Rechts und der Tugend müssen von einem ehrenhaften Dramatiker doch respektirt werden!“
„Und das sagst Du, der Du eine liederliche Dirne als tragische Heldin vertheidigst?“
„Eine Bajadere … Warum nicht? Ich erkläre Dir nochmal…“
„Aber ich habe Dir ja gesagt, unsere Wittwen…“
„Das verstehst Du nicht.“
„Mahaguma, Du wirst beleidigend.“
„Ach was, ich lasse mich nicht einschüchtern! Ihr Deutschen seid erbärmliches Volk!“
„Mensch … noch ein Wort!“
„Tempelschänder! Feind Brahma’s! Unreine Pariah-Seele!“
„Das war zu viel … Ich packte den cholerischen Inder am Schopfe und hob ihn mit nervigem Griff in die Höhe.“
„Hülfe! Hülfe!“ schrie er mit verzweifelter Anstrengung … „Hülfe im Namen der ewigen Sittengesetze!“
Ich aber holte aus und schleuderte den zitternden Orientalen ins Orchester.
Wunderbar! Ich blickte jetzt näher zu – und siehe da: Mahaguma bestand nur aus bedruckten Folioblättern und — einem grauleinenen Einband …
Ich erwachte … Neben mir auf dem Boden [32] lag die kritisch-literarische Zeitschrift aus den neunziger Jahren ……
Und nun halte man mit dem logischen Resultat dieser Halbschlaf-Vision, deren Basis durchaus nicht visionär, sondern enorm thatsächlich ist, die unverständigen Auslassungen gewisser Musik-Enthusiasten zusammen, die sich geberden, als gäbe es aus dem Gebiete des Musikalisch-Wertvollen keinerlei Wandlungen! Nur Hanslick begreift, daß es hier mit den „ewigen Schönheitsgesetzen“ übel bestellt ist; er sieht theoretisch ein, was die Erfahrung unausgesetzt lehrt, wiewohl sie stocktauben Ohren predigt. Er schreibt:
„Das berühmte Axiom, es könne das ‚wahrhaft Schöne‘ (– wer ist Richter über diese Eigenschaft? –) niemals, auch nach längstem Zeitlauf, seinen Zauber einbüßen, ist für die Musik wenig mehr, als eine schöne Redensart. Die Tonkunst macht es wie die Natur, welche mit jedem Herbst eine Welt voll Blumen zu Moder werden läßt, aus dem neue Blüten entstehen. Alle Tondichtung ist Menschenwerk, Produkt einer bestimmten Individualität, Zeit, Cultur, und darum stets durchzogen von Elementen schnellerer oder langsamerer Sterblichkeit. Unter den großen Musikformen ist wieder die Oper die zusammengesetzteste, conventionellste und daher vergänglichste.“
Und dann fügt er hinzu:
„Dem schönen Unsterblichkeitsglauben müssen wir entsagen. Hat doch jede Zeit mit demselben getäuschten Vertrauen die Unvergänglichkeit ihrer besten Oper proklamirt. Noch Adam Hiller in Leipzig behauptete, daß wenn jemals die Opern Hasse’s nicht mehr entzücken sollten, die allgemeine Barbarei hereinbrechen müßte. Noch Schubart, der [33] Musikästhetiker vom Hohenasperg, versicherte von Jomelli, es sei gar nicht denkbar, daß dieser Tondichter jemals in Vergessenheit geraten könnte. Und was sind uns Hasse und Jomelli? Die Geschichte der Oper bewahrt ähnliche Prophezeiungen aus jeglichem Zeitabschnitt, darum wird eine Wanderung durch ihre Hallen uns unversehens zur „Promenade d’un sceptique“, wie Diderot eine seiner Flugschriften betitelt. Die Historie lehrt uns, daß Opern, für deren „Unsterblichkeit“ man sich ehedem totschlagen ließ, eine durchschnittliche Lebensdauer von vierzig bis fünfzig Jahren haben, eine Frist, die nur von wenigen genialen Schöpfungen überdauert, von der Menge leichterer Lieblingsopern aber fast nie erreicht wird.“
Solche Betrachtungen dürften geeignet sein, dem Größenwahn superlativischer Wagnerianer einen Dämpfer aufzusetzen. Nichts ist absolut in der Welt des Schönen, nichts dauernd, nichts vollgültig; das Wort des ehrwürdigen Herakleitos „Alles fließt“ herrscht auch hier über allen Erscheinungen; das Eine fließt schneller, das Andere langsamer; aber es fließt.
Der Leser vergleiche übrigens die in mancher Beziehung hierhergehörige Auslassung Zola’s[1] in „Le roman naturaliste“, wo es heißt:
„Wenn man die Schriftsteller der vergangenen Jahrhunderte liest, so bemerkt man bald, daß man ihre Werke in zwei Teile zerlegen muß, einen Teil, der menschlich-gültig geblieben, und einen andern Teil, der gealtert ist. Dieser [34] gealterte Teil ist gerade die literarische Ausdrucksweise der Zeit. Man betrachte die Liebesdialoge bei Molière, Corneille und Racine: alle die schönen Sachen, die darin gesagt werden, erscheinen uns heute schrecklich kalt und lächerlich, und doch entzückten sie einst die Zuschauer und mußten auf daß Publikum eine unfehlbares Wirkung ausüben, denn wir finden sie in allen Werken der Zeit wieder. Im achtzehnten Jahrhundert hat sich die Mode geändert; man liebt die Natur und die Tugend; aber, du lieber Gott, welches Pathos! Ich erkläre, daß es mir stets unmöglich gewesen ist, die „Nouvelle Héloïse“ ohne Gähnen zu lesen. Ihr Stil ist unerträglich geworden, trotzdem man seinetwegen soviel Tränen vergossen, trotzdem er soviel Herzklopfen verursacht hat. Das sollte uns wirklich zum Nachdenken veranlassen. Es gibt also in jeder literarischen Periode eine eigentümliche Sprache, die die Mode annimmt, die Jedermann bestrickt, die unmodern wird und die, nachdem sie die Bücher berühmt gemacht hat, dieselben ebenso der Vergessenheit überliefert. Aber wir müssen doch einmal unsere Sprache haben. Unglücklicherweise werden wir von der unsern durchaus nicht verletzt, während wir die Lächerlichkeiten der Sprache früherer Epochen klar und deutlich erkennen. Ich habe oft darüber nachgedacht, und es packt mich bei dem Gedanken, daß gewisse Sätze, die ich heute mit großem Vergnügen schreibe, in hundert Jahren Lachen erregen werden, ein gelinder Schauer. Das Schlimmste ist, ich bin schließlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Sprache unserer Zeit, dieser der Mode unterworfene Stil, welcher notgedrungen altern muß, eine der entsetzlichsten Verirrungen der französischen Sprache bleiben wird. Das läßt sich mit ziemlich mathematischer Gewißheit voraussagen. Was besondere altert, das sind die Bilder. [35] Das Bild bestrickt, so lange es neu ist. Wenn es dann von einer bis zwei Generationen gebraucht ist, wird es ein Gemeinplatz, ein Plunder, eine Lächerlichkeit. Man sehe Voltaire mit seiner lockeren Sprache, seiner nervichten Satzbildung ohne Adjektive, die erzählt und nicht schildert: er bleibt verhältnißmäßig jung. Man betrachte Rousseau: diese Bilder, diese leidenschaftliche Rhetorik: er hat Seiten, die geradezu unerträglich sind. Wir vollends, die wir Sätze wie Marmor feilen und von den Worten den Duft der von ihnen ausgedrückten Gegenstände verlangen, wir haben Rousseau überholt. Das Alles packt uns, wir finden es ausgezeichnet, es ist vollendet schön. Aber was werden unsere Enkel dazu sagen? Ihre Art und Weise zu fühlen wird sich geändert haben, und ich bin überzeugt, einzelne unserer Wendungen werden ihnen Entsetzen einflößen. Fast Alles wird dann veraltet sein. Ich will Niemand nennen: aber ich habe mich oft gefragt, wem von uns gegenüber die Nachwelt sich am strengsten erweisen werde, und ich glaube, gerade die größten werden am schlimmsten wegkommen.“
So weit Zola auf einem verwandten Gebiet. Was er von Stil, von der äußern Form sagt, das gilt bis zu einem gewissen Grade vom Kunstwerk überhaupt …
Und, wie kommt das denn? Weshalb ist denn das Schöne nicht absolut? Weil es in letzter Linie nur eine Emanation des Menschlichen ist, und weil sich das Menschliche fortwährend in der Entwicklung befindet.
Dieser Zusammenhang leuchtet auch dem befangensten Laien ein, wenn es sich um die Schönheitsideale der bildenden Kunst handelt. Die Kunst aber ist Eine; die Künste sind nur die verschiedenen Aggregationszustände der Ur-Kunst.
[36] Das Schöne ist in der That ganz und gar relativ: denn es wird unwiderruflich bestimmt von dem jeweiligen intellektuellen und leiblichen Zustand des Menschengeschlechts.
Uns erscheinen die medicäische und die milonische Venus, jede in ihrer Art, als die verkörperten Ideale menschlicher Schönheit, weil diese Meisterwerke den Typus des gegenwärtigen Entwickelungsstadiums am vollendetsten wiederspiegeln.
Hat aber Darwin Recht mit seiner Lehre von dem rastlos umgestaltenden Einfluß der Anpassung, so wird dereinst in fernen Jahrtausenden auch der Typus der Menschheit eine Wandlung erleiden, wie er sie in unzähligen Abstufungen erlitten hat seit jener nebelgrauen Vergangenheit, die den hochmögenden Herrn der Schöpfung langsam und stetig aus dem ersten unscheinbaren Protoplasma heranentwickelt hat.
Wir können uns die Resultate dieser fortschreitenden Umbildung nicht wohl denken, ohne sie häßlich zu finden, denn sie stehen eben im Widerspruch mit dem gegenwärtigen Typus der Gattung, und Alles, was diesem Typus nicht adäquat ist, verletzt unser Schönheitsgefühl. Sei es nun, daß der Mensch der Zukunft eine weitere Verkürzung der Extremitäten erleidet, wie diese nachweisbar vorliegt bei der Entwicklung der niederen Menschheitsform in die höhere; sei es, daß die immer wachsende Anspannung und Uebung der Intelligenz größere Gehirnmassen und demgemäß größere Schädelräume zu Stande bringt –: immer wird uns die sinnliche Vorstellung einer solchen Modifikation widerwärtig oder komisch berühren, denn wir stecken mit der Gesatmmtheit unserer Instinkte in jener Befangenheit, die nur [37] sich für vollendet hält und Alles perhorrescirt, was über die Linien des gegenwärtigen Typus in störender Weise hinausgreift.
Ebenso notwendig jedoch, wie uns die Vorstellung eines derartig fortentwickelten Typus häßlich erscheint, ebenso notwendig wird jene Zukunfts-Menschheit unsern Typus abscheulich finden. Die medicäische Venus, vor welcher so und so viele Jahrtausende in Verzückung gerieten, muß jenen späteren Geschlechtern in ähnlicher Weise langarmig oder kleinköpfig erscheinen, wie uns die Neger oder Orang-Utangs. Das Schöne von Einst ist alsdann zum Unschönen von Jetzt geworden, und die „ewigen Gesetze der Schönheit“ haben sich kläglich blamirt, wie so manche apodiktische These der Schulweisheit.
Nur in einem Sinne gibt es ein Schönheitsgesetz, das voraussichtlich – das heißt, soweit wir mit dem vorhandenen Apparat unsers Denkens hierüber entscheiden können – dauernde Gültigkeit haben wird. Dies Gesetz lautet: Das herrschende Schönheits-Ideal wird sich stets mit dem geistigen und leiblichen Menschheits-Typus einer bestimmten Epoche decken.
Die Sache ist eigentlich selbstverständlich, und die vorsichtige Fassung, die wir unsrer These gegeben haben, entspringt nur dem Bedürfniß einer gewissen stilistischen Decenz, die nicht den Ton der Unfehlbarkeit anschlagen möchte.
Ja, die These ist streng genommen eine Tautologie.
Es liegt klar auf der Hand – um zunächst bei dem, Kapitel der leiblichen Schönheit zu bleiben – daß jede Menschheit ihren eigenen derweiligen Typus schön finden muß. Dieses „Schönfinden“ ist lediglich ein andrer Ausdruck für das Obwalten des Sexualtriebes, der sich zunächst in die [38] Form der Bewunderung kleidet, und sich diejenigen Individuen ausliest, welche den Typus der Gattung am reinsten und vollendetsten repräsentiren.
Die Schönheit fällt hier durchaus mit der Zweckmäßigkeit zusammen; sie ist eigentlich identisch mit der Gesundheit im prägnanten Sinne des Wortes, insofern nämlich jede störende Abweichung von der typischen Form auf einer Hemmung, d. h. auf einer Krankheit beruht.
Gesunde Zähne sind schön, weil sie zweckmäßig sind; denn sie gewährleisten durch eine vollständige Zerkleinerung der Speisen eine zweckmäßige Ernährung. Eine hohe, ebenmäßige Stirne ist schön, weil sie zweckmäßig ist, denn sie verbürgt eine Reihe psychischer Eigenschaften, die im Kampf ums Dasein günstig und fördernd sind. Eine breite, vollentwickelte Brust ist schön, weil sie zweckmäßig ist; denn sie bedeutet die Tauglichkeit der Atmungsorgane.
Umgekehrt berühren uns nicht nur die sogenannten Gebrechen, sondern alle irgend auffällig hervortretenden Abweichungen vom Zweckmäßigkeits-Typus unsympathisch.
Eine schmalhüftige Frauengestalt ist häßlich, weil die dürftige Entwickelung des Beckens das Schicksal der künftigen Generation compromitiirt. Ein im Punkte der Plastik stiefmütterlich behandelter Busen ist häßlich, weil er dem neugeborenen Kinde keine zweckentsprechende Nahrung gewährleistet.
Wo sich dagegen keinerlei Hemmung vorfindet, wo alle diejenigen Eigenschaften, die sich im Lauf der Jahrtausende als zweckmäßig für den Kampf ums Dasein bewährt haben, in möglichster Vollkommenheit ausgeprägt sind, da sprechen wir von vollendeter Schönheit, und je mehr sich ein Individuum diesem Typus nähert, um so entschiedener wird [39] es von dem andern Geschlechte begehrt. Hiermit ist selbstverständlich nicht nur an die kalte Regelmäßigkeit der Linien, sondern auch an jene psychischen Vorzüge zu denken, die den Linien erst das reizvolle, lebendige Leben einhauchen.
Der Schönheits-Typus der Plastik und Malerei ist nun selbstverständlicher Weise mit dem Schönheits-Typus, wie er der Liebe vorschwebt, völlig identisch. Vorübergehend kann sich hier eine naturwidrige Manier, eine Kunst-Mode geltend machen, die im Gegensatz zu dem echten, unverkünstelten Schönheitsgefühl gewisse Abweichungen von der gesunden Norm bevorzugt; und diese Kunst-Mode kann den Salon-Geschmack influiren und bei den „Leuten von Welt“ Sympathieen zeitigen für Erscheinungen, die eigentlich unschön sind; zum Exempel für die sogenannte Wespentaille, diesen Hohn auf alle Plastiker des glücklichen Hellas. Aber derartige Phänomene gehören in die Kategorie der geistigen Epidemieen, von denen lediglich die schwachen, verbildeten Individuen ergriffen werden, während die kernigen, urwüchsigen, selbstständig organisirten nach wie vor dem Genius der echten Natur treu bleiben, und allem Chic und allem Bon-ton-Gefasel zum Trotz die Taille der capuanischen Venus schöner finden und minniglicher, als den korsett-gedrillten, höchst ätherischen, aber höchst lufthungrigen Spindel-Thorax der „entzückendsten“ unserer eindärmigen Lieutenants-Tänzerinnen. –
Von solchen Kunst-Moden abgesehen, deckt sich das, was der Liebende schön findet, und das, der bildende Künstler schön findet, vollständig.
Ist nun der Schönheites-Typus, wie er der Liebe vorschwebt, veränderlich – weil er ja mit der fortschreitenden Entwicklung des Gattung-Typus, sich modificirt — so gilt [40] diese Veränderlichkeit natürlich auch von dem Schönheits-Typus der Kunst, der nur die höchste und idealste Ausprägung dieses Gattungs-Typus bedeutet. Mit andern Worten: der Praxiteles des hundertsten oder fünfhundertsten Jahrtausends nach Christus wird andere Ideale haben, als der des klassischen Alterthums, — was zu beweisen war.
„Ewige Schönheitsgesetze“ kann es schon um deßwillen nicht geben, weil die Schönheit keineswegs etwas Objektiv-Fixirbares ist, sondern lediglich eine Abstraktion, die mit der verschiedenen Struktur des percipirenden Gehirns variirt. Der Neger findet die Negerin ganz mit dem gleichen Rechte schön, wie der Weiße die Frauengestalten Raffaels; ja, wenn der Gorilla nach menschlicher Weise zu reflektiren vermöchte, so würde er eine recht typische Gorilla-Gestalt aus vollster Ueberzeugung und mit Aufbietung aller Beweismittel seiner Aesthetik als das Hoheitsvollste und Herrlichste hinstellen, was aus dem schöpferischen Schooße der Mutter Natur hervorgegangen, während die Species homo sapiens ihm als eine verzerrte Abart erscheinen müßte, bei deren Bildung die „ewigen Schönheitsgesetze“ ein wenig zu kurz gekommen.
So fände sich hier in aestheticis dieselbe Naivetät, die den Holländer veranlaßt, sein Idiom für die Sprache par excellence, das Deutsche aber für ein verderbtes Holländisch zu halten, während die umgekehrte ebenso thörichte Auffassung in Deutschland gang und gebe ist.
Als eine höchst komische Tautologie berührt sonach den betrachtenden Naturphilosophen jede treuherzig-poetische Versicherung im Stile der folgenden:
[41]„Von allen Frauen in der Welt
Die deutsche mir am besten gefällt.“
Da der liebeglühende Sänger, der diese Verse zu Papier gebracht hat, ein Deutscher ist, und zwar ein deutscher Mann, der also der deutschen Frau gegenüber völlig in der Befangenheit der Instinkte verstrickt ist, so prädicirt sein Ausspruch thatsächlich nicht das Geringste zu Gunsten der also Glorificirten; er formulirt nur, was sich von selbst versteht: daß jede Rasse von ihrem eignen Typus enthusiasmirt ist, oder noch einfacher: daß die Fortpflanzung regulariter innerhalb der Gattung, der Species, der Rasse, der Völkerschaft stattfindet, nicht aber durch Kreuzung mit solchen Individuen, die außerhalb dieser Gemeinschaft stehen. Wäre der Sänger ein kalkuttischer Hahn, so würde er ganz mit dem nämlichen Anspruch auf eine objektive Bedeutung seines Verdiktes die betreffenden Verse wie folgt gestalten:
„Von allen Hennen in der Welt
Die kalkuttische mir am besten gefällt.“
Gewiß läßt sich gegen die subjektive Berechtigung dieses lyrisch-erotischen Enthusiasmus nichts einwenden; nur darf die rein instinktive Sympathie nicht auf Irrwege geraten; sie darf nicht zum Pharisäertum werden, daß sich nun einbildet, alle übrigen Frauen des Universums seien faktisch nicht wert, der deutschen die Schuhriemen aufzulösen. Wer die Litteraturen anderer Culturvölker kennt, der weiß, daß solche Hoch- und Herrlichpreisungen der nationalen Frau keineswegs eine Specialität der deutschen Lyrik sind; daß vielmehr überall der gleiche – poetisch begreifliche, aber philosophisch groteske – Irrtum begangen wird.
[42] Aus dieser Erwägung sollte sich eine ähnliche Toleranz entwickeln, wie aus der unbefangnen Betrachtung der verschiedenen Religionssysteme und ihrer begeisternden Wirkungen auf den Gläubigen. Jeder meint den echten Ring zu besitzen, denn er findet in seinem Besitz jene Befriedigung, die er als Bürgschaft der Echtheit auffaßt. Das gilt von den Frauen wie von den Glaubenssystemen; das gilt vom Sittlichkeits-Ideal wie vom Schönheits-Ideal.
Wir sind scheinbar von unserm Thema abgeschweift und stehen doch thatsächlich mitten darin. Auch die Musik, soweit sie Ideen und Anschauungen überhaupt zu verkörpern im Stande ist, verkörpert doch nur die Ideen und Anschauungen der Zeit, der vergänglichen, rasch dahinflutenden Geistesbrandung. Je weniger sie mit der Darstellung des Leiblichen sich zu befassen hat, desto wandelbarer und flüchtiger sind ihre Formen: denn die Entwickelungs-Processe intellektueller Art vollziehen sich rascher als die eigentlich biologischen.
Unsre Skizze hat sich bis jetzt mit der rein theoretischen Anmaßung der Musik auseinandergesetzt. Diese Anmaßung ist in mehr als einer Beziehung töricht und irreleitend; sie schädigt die freie Entfaltung der Schwesterkünste; sie unterwühlt die Grundpfeiler einer gerechten und sachgemäßen Aesthetik. Immerhin läßt sie mit einiger Philosophie sich ertragen. Eine conventionelle Rücksichtslosigkeit unerträglicher Art ergibt sich dagegen auf dem Gebiete der musikalischen Praxis.
Wenn sich ein Mensch einfallen lassen wollte, unmittelbar vor dem Fenster meines Arbeitsgemachs eine Esse zu construiren, die mir zu jeder beliebigen Tageszeit Qualm und Ruß wider die Scheiben jagte, so würde es nur eines Winkes bedürfen, um diesem ungebührlichen Essenmann das Handwerk [43] zu legen. Ja, die Behörden der Stadt würden dem schnöden Belästiger von vornherein die Erlaubnis verweigern, einen Schlot zu errichten, dessen Funktionen einen so evidenten Eingriff in eine fremde Rechtssphäre zu bedeuten hätten. Wenn sich dagegen über mir, unter mir, neben mir ein müßiger, geist- und talentloser Tagedieb einfallen läßt, von Morgens bis Abends durch Bearbeitung seiner Geige, seines Piano’s, seiner Trompete unausgesetzt Tonwellen in mein Zimmer zu senden, die mir die Nerven zerrütteln, jede geistige Sammlung unmöglich machen, ja durch die Gleichzeitigkeit mit anderen Tonwellen eine Disharmonie erzeugen, die an das wütendste Heulen nächtlicher Kater erinnert, so giebt mir die conventionelle Rücksichtslosigkeit unserer Gesetzgebung absolut kein Mittel zur Hand, dieser brutalen Eingriffe in mein allerpersönlichstes Recht mich zu erwehren.
Und doch kann ich gegen die qualmenden Ausdünstungen der Esse mich halbwegs schützen, indem ich daß Fenster schließe.
Gegen die Tonwellen, die doch genauso real und in ihrer Wirkung weit nachhaltiger sind als die Rußwolken des Schlots, kann ich mich nicht einmal dadurch verteidigen, daß ich die Ohren mit Wachs verklebe, denn bekanntlich hört man auch durch die Mundhöhle.
Wir sind an den schreienden Mißstand, der sich hier kennzeichnet, schon so lange gewöhnt, daß wir uns wohl oder übel fast schon damit zurechtfinden, wie mit den Schrecknissen einer Naturgewalt. Und doch stehn wir in diesem Fall lediglich unter dem innerlich unberechtigten Bann einer conventionellen Rücksichtslosigkeit, deren Herrschaft durch einen einzigen kühnen Act der Gesetzgebung mühelos zu beseitigen wäre.
[44] Wenn die musikalischen Kunstleistungen eines Hausnachbarn durch die Wände und Decken dringen, so kommt es nicht mir, dem belästigten Dulder, zu, diese Attacken durch Polsterungen oder Gott weiß wie sonst mühsam zurückzuschlagen, sondern der Klimperer, Kratzer, Dudler und Bläser hat die Verpflichtung, den von ihm erregten störenden Tonwellen eine Schranke zu setzen; – just wie es nicht etwa dem Flusse obliegt, sich gegen die vergiftenden Einläufe der Färbereien zu wehren, sondern den Färbereien, den Fluß zu verschonen.
Nur die Gewohnheit und die leidige Indolenz kann uns gegen die Wahrheit des hier ausgesprochenen Rechtsgrundsatzes verblenden.
Wie es Verboten ist, Nachts, wenn die Bürger im Schlafe liegen, ruhestörenden Lärm zu verursachen; wie man nicht etwa den Bürgern sagt: „Verbarrikadirt eure Fenster, wenn ihr das Johlen und Brüllen der Trunkenbolde nicht hören wollt!“ – sondern den Trunkenbolden: „Ihr schweigt oder wandert in’s Loch!“ – just so könnte und sollte man auch die Arbeit der Bürger während der Tagesstunden gegen alle Geräusche beschützen, die sich vermeiden lassen. Nicht zu vermeiden sind nur solche Geräusche, die mit dem freien Verkehr und der gewerblichen Produktion zusammenhängen. Ja, in letzterer Beziehung übt man sogar in den meisten Städten eine gewisse heilsame Einschränkung. Kupferschmiede und sonstige Pauker, die das Trommelfell ihrer Nachbarn bedrohen, werden innerhalb der belebteren Stadtteile nicht mehr geduldet, geschweige denn in den Vierteln, wo sich die geistige Arbeit concentrirt. Nur die Klimperer, Kratzer, Dudler und Bläser haben überall plein [45] pouvoir und kehren wohl noch den schwergekränkten Idealisten heraus, wenn ein gepeinigter Mitmensch im letzten Stadium seiner Verzweiflung den Stock oder Hammer ergreift, um durch ein freundnachbarliches Pochen an Decke und Wand ihnen begreiflich zu machen, daß selbst der Exceß seine Grenzen hat.
Zeichner und Dichter, ruhige Beobachter und juvenalisch-veranlagte Spötter haben dem Mißstand dieser fürchterlichen Musik-Vergewaltigung Feder und Stift gewidmet.
So singt ein sächsischer Lyriker unter der Spitzmarke: „La prière d’une vierge – morceau caractéristique pour le piano par Thekla Badarzewska“ das nachstehende bitter empfundene Trauerpoëm:
Wann erst auf den Straßen
Der Abendwind weht,
Ein seltsames Rasen
In Tönen entsteht.
Auf Gassen und Plätzen,
Aus jeglichem Haus,
Da dringt es – Entsetzen! –
Tralarum heraus.
Es hämmert und stümpert
Und dudelt im Takt,
Es klippert und klimpert
Und trillert vertrackt.
Der Wandrer, der draußen
Vorüber noch geht,
Der flüstert voll Grausen:
„Der Jungfrau Gebet!“
[46] Der Wandrer aber geht doch noch wenigstens vorüber. Weit schlimmer ist’s um den Helden der nachstehenden, jüngst in den „Fliegenden Blättern“ publicirten qualdurchzitterten Threnodie bestellt…
Klagelied.
Ich weiß nicht, was es bedeutet,
Was unter mir tönt im Parterre:
Die „Klosterglocken“ läutet
Dort ein klavierender Herr.
Mein Nachbar zur Linken vernimmt es,
Will übertönen den Graus,
Ergreift sein Cello und stimmt es
Und bricht in Etüden aus.
Die schönste Jungfrau lauschet
Dort oben im zweiten Stock –
Worauf sie das Sopha vertauschet
Mit des Klavieres Bock;
Sie paukt gleich höllischen Mächten
Und singt ein Lied dabei –
Das hört mein Nachbar zur Rechten
Und flüchtet zu seiner Schalmei.
Mir wird vor den Augen es gelber,
Es packt mich mit Rachbegier –:
Ein Jeder hört nur sich selber –
Ich höre sie alle Vier.
Ich glaube, in solcher Laune
Könnt’ ich ein Verbrechen begehn –
Ich kaufe mir eine – Posaune,
Dann wollen wir weiter sehn!
[47] Ein talentvoller Künstler zeichnet uns aus der gleichen Stimmung heraus eine musikalische Soirée, bei der die Tochter des Hauses auf allgemeines Verlangen irgend etwas Ergreifendes in die Lüfte schmettert. Im Hintergrunde sitzt Pluto, der treue Haushund, und heult bei den schauerlichen Coloraturen des jungen Mädchens pöbelhaft zum Plafond aus. Die Unterschrift aber besteht in dem Stoßseufzer, den ein gepeinigter Gast an den heulenden Pudel richtet, und dieser Stoßseufzer ist die Variation eines bekannten Citats aus Goethe’s Tasso: „Ja, wo der Mensch in seiner Qual verstummt, gab Dir ein Gott zu sagen, was Du leidest!“
Auch die Musik, zu der man geladen wird, involvirt, wie figura zeigt, mitunter eine conventionelle Rücksichtslosigkeit ersten Ranges. Das drolligste Beispiel dieser Art melden uns die römischen Schriftsteller aus der musikalischen Praxis des Kaisers Nero.
Dieser despotische Geist kannte ja überhaupt kein Mitleid: am schnödesten und erbarmungslosesten aber verfuhr er als Dudler. In allen Provinzen des Reichs trug er sein vermeintliches Virtuosenthum und zwang seine Unterthanen zum Anhören ungezählter Gesangs- und Kithara-Stücke. Da nun Viele von den Gemarterten ausrissen, trotz der strengen Befehle des hohen Herrn und trotz der furchtbaren Straf-Exempel, die er schon mehrfach wegen Unbotmäßigkeit im Genießen der kaiserlichen Musik statuirt hatte, so schritt er, als er einst in Neapolis ein Monstre-Concert gab, zu Gewaltmaßregeln. Die Stadtmauern wurden militärisch besetzt; Niemand durfte durch’s Tor, um etwas in Bajä oder in Bauli Schutz zu suchen gegen das schauderhafte imperatorische Erz-Gedudel. – Da kletterten einzelne bedrohte [48] Bürger zur Nachtzeit mit Strickleitern über die Zinnen, und andre stellten sich todt, legten sich in den Sarg und ließen sich so von ihren Sklaven hinausschaffen, — nur um dem schrecklichen Lirum-Larum ihres gekrönten Peinigers zu entgehen, nur um jenseits der Hörweite frei aufatmen zu können!
Auch heutzutage möchte sich der gefolterte Großstädter manchmal im Sarg hinaustragen lassen — aus barer Verzweiflung über das ununterbrochene Heisa-Juchheisa-Dideldum-Dei der Musik-Instrumente. Der Mißstand ist so entsetzlich, daß ein französischer Philosoph, angedonnert von den hunderttausend Akkorden seiner musik-rasenden Nachbarschaft, eine Abhandlung concipirte, die den Titel führt: „Le bonheur d’être sourd“ – „Das Glück, taub zu sein“.
Man hat ein Gesetz gegen die Trunksucht ventilirt. Aber die Trunkenbolde sind im Vergleich mit den tollen Musikbolden harmlose Kinder. Jedenfalls stören mich hundert Personen, die sich außerhalb des von mir bewohnten Hauses bezechen, ganz und gar nicht, während ein einziger Mensch, der sechs Stunden lang mir zu Häupten Mendelsohn’s Andante maëstoso über die Tasten stümpert, mir geistige, gemütliche, leibliche und finanzielle Schädigungen verursacht, die sich nur schwer taxiren lassen.
Im Mittelalter ließ man die Aussätzigen eigene, von der übrigen Menschheit völlig abgesonderte Häuser bewohnen. Und doch waren diese Unglücklichen nicht etwa durch eigenen Entschluß, sondern in Folge eines grauenhaften Verhängnisses aussätzig. Wer nun so unwiderruflich an der Lepra musicalis leidet, daß er alltäglich einen so und so vielstündigen Anfall bekommt, dem alle Symptome der von Paul Heyse [49] gekennzeichneten Gehirnerschlaffung anhaften, warum sollte der nicht auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift auf eine bestimmte Region der Stadt beschränkt werden dürfen? Wie man Coupés für Raucher und für Nichtraucher hat, so könnte man auch musikalische und nichtmusikalische Häuser, Straßen und Stadtviertel haben.
Dem Einwand, daß heutzutage Musik beinahe in allen Familien betrieben wird, daher denn sämmtliche Einwohner sich in das musikalische Viertel zurückziehen müßten, will ich sofort begegnen. Familien, in denen täglich zwei und meinetwegen auch drei Stunden musicirt wird, könnten von der Verbannung in das Musikviertel befreit bleiben, vorausgesetzt, daß diese Musikübung in die Zeit fiele, wo der normale Staatsbürger aufgehört hat zu arbeiten: daß heißt in die Abendstunden. Wer aber am Vormittag über dem Kopf des Gelehrten, des Forschers, dem er dadurch vielleicht die Lösung eines großen Problems verdirbt, Tantam-Schläge riskiren will und Triller und Coloraturen — fort mit dem ins Musikviertel! Er ist ein Schlot-Erbauer, ein qualmender Essenmann, ein trommelfellzermarternder Kupferschmied, ein homo leprosus!
Wenn man bedenkt, daß aller materielle Fortschritt der Menschheit von den geistigen Operationen abhängt, die sich am Schreibtisch, im Laboratorium, im Bibliothekszimmer vollziehen, so wird man sich kaum getrauen, die ungeheure Schädigung abzuschätzen, die der Civilisation lediglich aus der conventionellen Rücksichtslosigkeit der Musik erwachsen. Und nur weil die Rücksichtslosigkeit conventionell, das heißt allgemein gutgenannt und gleichsam heilig und unverletzlich ist, nur deßhalb verschließt sich vielleicht ein Teil unserer Leser gegen die innerliche Berechtigung unserer Attacke. Auch [50] die Bemerkung, die vielleicht manchem aus der Lippe schwebt: nicht alle, die da Musik treiben, seien doch Stümper und schreckenerregende Dilettanten, auch diese Bemerkung schwächt uns die Wucht der musikalischen Vergewaltigung keineswegs ab. Selbst Rubinstein oder Bülow, wenn er das Herrlichste vortrüge, was die gottbegnadetsten Meister deutscher Nation geschaffen haben, würden mich doch nur so lange fesseln, als ich im Stande wäre, ihren künstlerischen Productionen ohne Rückhalt zu lauschen. Sobald ich jedoch lesen, studiren, arbeiten will, muß ich in einem Staate, der seine Bürger gegen die Uebergriffe fremder Interessen schützt, in der Lage sein, diesen Tonwellen zu entfliehen; und wenn Rubinstein oder Bülow über mir wohnte, so würde mir all ihr Talent und alle Großartigkeit der von ihnen gestalteten Schöpfungen nicht über den Jammer hinweghelfen, daß ich der Sklave einer von mir nicht gewollten tumultuarischen Leistung bin, die, wenn ich nicht andächtig zuhören kann, für mich keine Musik mehr ist, sondern ruhestörender Lärm.[2]
„Allerdings gibt es ja Leute“, sagt Schopenhauer, „welche hierüber (d. h. über die Antipathie gegen ruhestörenden Lärm) in souveräner Gleichgültigkeit lächeln; das sind jedoch eben die, welche auch unempfindlich gegen Gründe, gegen Gedanken, gegen Dichtungen und Kunstwerke, kurz, gegen geistige Eindrücke jeder Art sind: denn es liegt an der zähen Beschaffenheit und handfesten Textur ihrer Gehirnmasse. Hingegen finde ich Klagen über die Pein, welche denkenden [51] Menschen der Lärm verursacht, in den Biographieen, oder sonstigen Berichten persönlicher Aeußerungen fast aller großen Schriftsteller, z. B. Kant’s, Goethe’s, Lichtenberg’s, Jean Paul’s; ja, wenn solche bei irgend Einem fehlen sollten, so ist es bloß, weil der Context nicht darauf geführt hat. Ich lege mir die Sache so aus: wie ein großer Diamant, in Stücke zerschnitten, an Werth nur noch ebenso vielen kleinen gleich kommt; oder wie ein Heer, wenn es zersprengt, d. h. in kleine Haufen aufgelöst ist, nichts mehr vermag: so vermag auch ein großer Geist nicht mehr, als ein gewöhnlicher, sobald er unterbrochen, gestört, zerstreut, abgelenkt wird; weil seine Ueberlegenheit dadurch bedingt ist, daß er alle seine Kräfte, wie ein Hohlspiegel alle seine Strahlen, auf einen Punkt und Gegenstand concentrirt; und hieran eben verhindert ihn die lärmende Unterbrechung. Darum also sind die eminenten Geister stets jeder Störung, Unterbrechung und Ablenkung, vor Allem aber der gewaltsamen durch Lärm, so höchst abhold gewesen; während die übrigen dergleichen nicht sonderlich anficht. Die verständigste und geistreichste aller europäischen Nationen hat sogar die Regel: never interrupt! – Du sollst niemals unterbrechen! – das elfte Gebot genannt. Der Lärm aber ist die impertinenteste aller Unterbrechungen, da er sogar unsere eigenen Gedanken unterbricht, ja, zerbricht. Wo jedoch nichts zu unterbrechen ist, da wird er freilich nicht sonderlich empfunden werden.“
Es erübrigt noch eine kurze Bemerkung über die conventionelle Rücksichtslosigkeit, mit der man den Musik-Unterricht um jeden Preis und bei jedem noch so unmusikalisch-veranlagten Individuum in den Lektionsplan hineinpropft, sehr häufig zum Nachtheil der körperlichen, moralischen und wissenschatlichen Entwicklung.
[52] Ein norddeutscher Tourist erzählt uns mit vielem Humor, wie er einmal auf Grund eines törichten Mißverständnisses fern in Spanien verhaftet, vor den Alkalden geführt, und von dem würdigen Caballero zehn Stunden lang in Gewahrsam behalten wurde, bis dann der Irrtum sich aufklärte. Das Gefängniß, in welchem der Herr Alkalde ihn aufhob, war ein getünchtes Stübchen des Obergeschosses, das einen rohgezimmerten Tisch, einen Stuhl und einen Spucknapf enthielt. Die Aussicht ging auf den engen Hof, wo auf der Spartgras-Leine die Hemden der Frau Alkaldin und zwei Unterbeinkleider ihres Gemahls trockneten. Kein grünes Blatt, kein lebendes Wesen, soweit der Blick reichte. Das Gepäck hatte man dem Verhafteten abgenommen; nicht einmal sein Notizbuch steckte mehr in der Brusttasche. Kurz, der Aufenthalt in dem einsamen Spucknapf-Stübchen war von entsetzlicher Langweiligkeit; jede Sekunde schien dreifach durchtränkt von jener weisgetünchten lautlosen süd-andalusischen Oedigkeit, die das Herz zur Verzweiflung bringt und schrecklicher auf die Nerven drückt als die Finsterniß eines mittelalterlich-modrigen Burgverließes.
In dieser furchtbaren Monotonie fand der Vereinsamte einen himmlischen Trost, wenn er sich an die Mittwoch- und Sonnabend-Nachmittage seiner Schulzeit erinnerte.
„Ich stellte mir vor“ — so erzählt uns der Vielgeprüfte — „daß ich an diesem Nachmittage von fünf bis sechs regulariter eine Klavierstunde hatte. Ich war musikalisch-talentlos: aber der Lehrer, obschon er sich eines bedeutenden Ruhmes erfreute, war etwas schlimmeres: er war menschlich-talentlos. Der Mann gab mir nicht Unterricht — nein, er dressirte mich. Die geisttötende Aeußerlichkeit seiner Methode richtete nur meine Finger ab, während das Herz und das Hirn leer [53] blieben. Draußen strömte die Frühlingssonne ihr flüssiges Gold über Thäler und Hügel aus: ich mußte mich abquälen, mein Gemüt zu betäuben und meine Finger nach Möglichkeit zur Maschine zu machen. Und wie mir das jetzt in meiner Haft einfiel, da überkam mich ein himmlisches Wohlbehagen. So langweilig, so geistmordend wie diese Klavierstunden war die starre Beschaulichkeit im Kerkerstübchen des Herrn Alkalden noch lange nicht!“
Unser Tourist sagt hier in etwas hyperbolischer Form, was Tausende von musikalisch talentlosen Schülern tausend und abertausend Mal schon gefühlt und gedacht haben. Es gibt nichts Grausenhafteres für ein empfängliches Kindergemüth als die Zwangsdressur für eine Fertigkeit, zu der die specifischen Anlagen nicht vorhanden sind. Der Klavier-Unterricht wird heutzutage als obligatorisch betrachtet. Es kommt vor, daß eine junge Dame höchst mangelhafte französische Kenntnisse hat; es kommt vor, daß die deutsche Litteratur ihr ein sinnloses Sammelsurium von Zahlen und Namen ist: aber daß ihr Unterrichtsconto nicht mit einer recht stattlichen Summe für erlittene Pianoforte-Lektionen belastet wäre, daß sie nicht par ordre de Mufti zahllose Stunden hindurch Tasten gehämmert und Tonleitern abgepeitscht hätte, das kommt in der guten Gesellschaft beinahe nicht vor. Und doch, welch’ ein Widersinn, welch’ ein unhaltbarer Mißverstand!
Was jedes normal beanlagte Kind lernen sollte, da es zur allgemeinen Bildung gehört, das ist Kenntniß der Noten, Kenntniß der Tonarten und der Tongeschlechter, Kenntniß vom Wesen der einzelnen Toukunstformen, kurz, die musiktheoretischen Elemente, denen bis zu einem gewissen Grad praktische Ausführungen und Erläuterungen parallel gehen [54] müssen. Aber zu fordern, daß Jedermann die Tonkunst auch praktisch executire, das ist nicht wesentlich klüger, als wenn man verlangen wollte, daß Jedermann Zweiradfahrer, Seiltänzer oder Equilibrist sei. Thatsächlich wird diese unberechtigte Anforderung denn auch später, sobald die musikalisch-vergewaltigten Kinder erwachsen sind, durch den naturgemäßen Verlauf der Dinge in ihrer Absurdität enthüllt. Von zehn Kindern, die ihre beste Zeit mit hirnzermarternden Einpaukereien vergeudet haben, bleibt höchstens ein einziges als erwachsener Mensch dem von ihm bearbeiteten Instrument wirklich treu. Auf die Frage: „Spielst du Klavier?“ erhält man fast immer eine geschraubte, ausweichende Antwort, die in korrektes Deutsch übersetzt, lauten würde: „Ich hab’ es gelernt, aber ich kann’s nicht.“
Nun könnte man zwar behaupten: Das Resultat ist allerdings in den meisten Fällen ein negatives, aber der Weg, den man gewandelt ist, hat einen bleibenden Segen gestiftet; man hat marschieren gelernt; die Sache vergleicht sich etwa dem Studium der klassischen Sprachen, die ja gleichfalls später vernachlässigt werden, aber doch während der Tage des Studiums die Seele befruchtet haben ...
Das klingt sehr schön, aber just das Gegenteil ist der Fall. Der musikalisch-talentlose Schüler — und musikalisch talentlos ist die immense Majorität — wird durch den Zwangsunterricht der hier naturgemäß immer Dressur bleibt, keineswegs geistig oder gemütlich veredelt, sondern geschädigt.
Soll die Musik auf das musikalisch-talentlose Kindergemüt veredelnd einwirken, so muß das Kind gute und seinem schlichten Verständniß angepaßte Musikstücke in künstlerischer Ausführung hören. Das selbstthätige Stümpern [55] kann ihm den Genuß der künstlerischen Schöpfung höchstens verleiden. Außerdem kommt aber jene tief wurzelnde Verbitterung hinzu, die jedes empfängliche Herz ergreift, wenn es durch einen fremden Willen genöthigt wird, Zeit und Kraft auf einen Gegenstand zu verschwenden, der ihm innerlich fremd bleibt. Selbst der gefestigte Mann verkümmert in einem Beruf, dem er sich nicht gewachsen fühlt: um wie viel mehr das zartbesaitete, leichtverletzliche Kind!
Unserer Meinung zufolge hätte also die ausübende Tonkunst ihren bisherigen Anspruch auf den Titel eines integrirenden Bestandteil des Jugend-Unterrichts aufzugeben. Nicht allgemeine Wehrpflicht sei die Parole, sondern vereinzelte Aushebung nach strenger, vorurteilsloser Musterung. Das Musik-Talent ist, wie gesagt, etwas ganz Specifisches, das mit der sonstigen intellektuellen Begabung des Menschen nicht das Geringste zu tun hat. Individuen, die an Geist und Gemüt außerordentlich tief stehen, sind häufig nach irgend einer Richtung hin musikalisch veranlagt – und umgekehrt. Die nämliche Melodie, deren tongetreue Reproduktion dem klugen, feinfühligen und hochgebildeten Akademiker aller Bemühungen ungeachtet zum zehnten Male mißglückt, wird von dem flachköpfigen, ganz und gar banal construirten Schusterjungen beim erstern Anhören fehlerlos wieder gegeben. Selbst das kleine, windungsarme Gehirn eines Vogels reicht für diese kaum noch geistig zu nennende Leistung aus; denn Singvögel lernen gewisse Tonfolgen ganz korrekt nachpfeifen. Es handelt sich also hier um eine Specialfähigkeit von engster Umschriebenheit. Der Sprachgebrauch versteht beiläufig bemerkt, unter „musikalisch beanlagt“ sehr verschiedenartige Dinge, die man scharf trennen sollte. Musikalisch [56] beanlagt im höchsten Sinne des Wortes ist natürlich der schöpferische Tondichter. Musikalisch beanlagt aber ist auch der Interpret dieses Tondichters, der vielleicht absolut unschöpferische Virtuose, und nächst ihm der verständnisvoll ausübende Dilettant. Musikalisch beanlagt ist endlich der Zuhörer, der die Vorzüge der Tonschöpfung wie der Interpretation genügend zu würdigen weiß. Man kann jedoch dieses Zuhörertalent in vollstem Maße besitzen, ohne sich für die Erlernung eines musikalischen Instrumentes zu eignen. Gerade auf dem Gebiete der passiven musikalischen Beanlagung gibt es ganz eigenthümliche Varianten. Ich kenne Persönlichkeiten, die mit einem sehr vornehmen musikalischen Geschmack begabt sind, ohne ein sonderlich ausgeprägtes, musikalisches Gehör zu besitzen. Andre hinwider mit brillantem Gehör leiden an einer bedauerlichen Trivialität des Geschmacks. Sehr weit verbreitet ist ferner die Gattung Derer, bei denen die Schärfe des musikalischen Gehörs ganz und gar nicht parallel geht mit der Befähigung, das Gehörte wiederzugeben. Die Meisten, die nach Art des oben erwähnten Akademikers von dem trällernden oder pfeifenden Schusterjungen beschämt werden, gehören in diese Kategorie: sie haben ganz richtig gehört und aufgefaßt, aber sie können das Aufgefaßte nicht wiedergeben. Daß hier nicht etwa ein Defekt des musikalischen Gedächtnisses vorliegt, sondern der Mangel einer ganz specifischen, nicht näher zu definirenden Reproduktionsgabe, wird sofort klar, wenn man bedenkt, daß diese Unfähigkeit den damit Behafteten keineswegs hindert, tausende von Melodieen und Motiven scharf auseinander zu halten, sie nach Jahrzehnten wieder zu erkennen und jeden Mißgriff des Vortragenden heraus zu empfinden. Man sieht, wie verschiedenartige Momente [57] die Alltagssprache hier mit dem nämlichen Wort bezeichnet!
Wenn wir sonach die allgemeine musikalische Wehrpflicht antasten und die These aufstellen, die unbegabte Majorität solle von dem conventionellen Klavier-etc.-Unterrichte befreit bleiben, so wissen wir, daß uns die klassisch gebildeten Musiker mit dem Beispiel des griechischen Alterthums kommen werden, das, dem Zeugniß zahlreicher Schriftsteller zu Folge, nicht nur das musikalische Verständniß, sondern auch die praktische Hebung der Tonkunst als unerläßlichen Faktor der allgemeinen Bildung betrachtete.
Auf diesen Einwurf antworteten wir, daß die Griechen des klassischen Altertum erstens mehr Zeit hatten, als wir Kinder des neunzehnten Jahrhunderts, dieweil die sonstigen Anforderungen an Können und Wissen vergleichsweise sehr gering waren und das Brotstudium keine so grausame Rolle spielte; und daß zweitens der altgriechische Musik-Unterricht sich zu dem unsern verhält, wie ein Waldbach zum Niagara.
Die Griechen unterrichteten ihre Kinder vorzugsweise im Gesang – und nächstdem im Saitenspiel. Dies Saitenspiel war außerordentlich einfach, die Technik durchaus nicht zeitraubend, die ganze Sache wirklich ein Spiel, nicht eine nervenzerfressende Arbeit wie die Bewältigung unsres modernen Klaviers.
Einen Beweis dafür, daß die Erlangung der im Altertum etwa geforderten musikalischen Fertigkeit nicht mit übermäßigen Schwierigkeiten verknüpft war, liefert die Raschheit, mit der selbst mäßig begabte Autodidakten sich dieser Fertigkeit zu bemächtigen wußten.
[58] So schreibt zum Beispiel der jüngere Plinius von seiner liebenswürdigen, aber keineswegs exceptionell veranlagten Gattin Kalpurnia:
„Sie componirt und singt meine Verse zur Kithara, ohne von einem andern Künstler Unterricht erhalten zu haben, als von Amor, der ja von jeher der beste Lehrmeister war.“
Unter solchen Verhältnissen ging das an: wie’s aber jetzt steht, opfert ein unmusikalisches Kind einem fast wertlosen Ziel seine besten Erholungsstunden, beziehungsweise die Zeit, die es aus die Erlernung weit wichtigerer und für seine Zukunft vorteilhafterer Dinge hätte verwenden können.
Und warum? Nur weil es die Mode verlangt, die conventionelle Rücksichtslosigkeit, die uns knechtet, die musikalische Tyrannei, die hier mit einer mächtigen Bundesgenossin, der Eitelkeit, an dem nämlichen Strange zieht. Die Mehrzahl der talentlosen Kinder, die ihre Zeit am Klavier vergeuden, sind Mädchen, — und bei dem schönen Geschlecht ist der Musik-Dilettantismus häufig nur Mittel zum Zweck. Das galt schon im alten Rom, dessen unmusikalisch veranlagte Töchter mit ihrem forcirten Musik-Betrieb vielfach an die ebenso unmusikalisch veranlagten Engländerinnen und Amerikanerinnen von heute erinnern. Das Spielen und Trällern, selbst wenn die Kunst im höheren Sinne dabei zu kurz kam, galt den verfeinerten Spät-Quiritinnen als die Vorbedingung echter Salonfähigkeit. Der Dichter Statius spricht in klangvollen Versen die Hoffnung aus, seine geliebte Tochter werde nun ganz gewiß bald einen Freier bekommen, da sie im Punkte der musikalischen Bildung allen Anforderungen der Neuzeit entspreche. Ich weiß im Augenblick nicht, ob der [59] Mann sich geschnitten hat; das aber weiß ich, daß die intelligenteren Elemente der römischen Kaiserzeit dem conventionellen Lirum-Larum einfach den Rücken kehrten.
Mit schalkhafter Ironie betont uns der Dichter Ovid in der Ars amandi den wahren Zweck dieses musikalischen Bildungs-Triebes…
Schmeichelnd wirkt der Gesang; drum Jungfrau schule dein
Stimmchen!
Oft, wo die Schönheit fehlt, schafft der Gesang den Gemahl;
Mögen entströmen dem Mund Melodieen gehört im Theater,
Oder erotischer Klang fern vom Gestade des Nils.
Der grämliche Frankfurter Philosoph mag freilich zu weit gehen, wenn er alle künstlerischen Bestrebungen der Frauenwelt wie folgt beurteilt:
„Weder für Musik, noch Poesie, noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit; sondern bloße Aefferei, zum Behuf ihrer Gefallsucht, ist es, wenn sie solche affektiren und vorgeben. Das macht, sie sind keines rein objektiven Anteils an irgend etwas fähig, und der Grund hiervon ist, denke ich, folgender. Der Mann strebt in Allem eine direkte Herrschaft über die Dinge an, entweder durch Verstehen, oder durch Bezwingen derselben. Aber das Weib ist immer und überall auf eine bloß indirekte Herrschaft verwiesen, nämlich mittelst des Mannes, als welchen allein es direkt zu beherrschen hat. Darum liegt es in der Weiber Natur, Alles nur als Mittel, den Mann zu gewinnen, anzusehen, und ihr Anteil an irgend etwas Anderem ist immer nur ein simulirter, ein bloßer Umweg, [60] d. h. läuft auf Koketterie und Aefferei hinaus. Daher hat schon Rousseau gesagt: Les femmes, en général, n’aiment aucun art, ne se connoissent à aucun, et n’ont aucun génie (Lettre à d’Alembert, note XX.) Auch wird Jeder, der über den Schein hinaus ist, es schon bemerkt haben.“
Diese ächt Schopenhauer’sche Darlegung mag, wie gesagt, etwas zu weit gehen: aber daß in der That ein erschrecklich hoher Procentsatz des musikalischen Dilettantismus auf Conto dessen gesetzt werden muß, was ein ungalanter Franzose die Jagd auf den Gatten betitelt – sei es nun, daß die musiktreibende Schülerin selbst im Grund ihres heranreifenden Herzens die Jägerin ist, sei es, daß nur die vorschauende Mutter ihre Netze und Speere rüstet – das scheint doch dem unbefangnen Beobachter zweifellos. Ohne inneres Verständnis der Kunst, ohne ernsthafte Neigung wird flott darauf losgepauckt, nur um dereinst im Salon mit irgend einem Bravourstück zu brilliren und brave, heiratsfähige Herzen in glückverheißende Schwingungen zu versetzen. „Nach der Verheirathung,“ sagt Holl, „wird dann die edle Kunst vernachlässigt, und wie ein überflüssiges Hausgeräthe bei Seite gesetzt, – der beste Beweis, daß sie lediglich ein Mittel zum Zweck war.“
Hieraus erklärt es sich auch, warum die halbwüchsigen Mädchen bei aller Talentlosigkeit doch stets fleißiger und ausdauernder sind als die Knaben. In ihrem ahnenden Herzen regt sich eben ein ausreichendes Motiv gegen den Ueberdruß. Diese fleißigen, talentlosen Ueberinnen sind dieselben Geschöpfe, die später mit Todesverachtung die Qualen zu enger Schnürleiber und Ball-Schuhe aushalten, gleichfalls aus Eitelkeit und im Berufe des Männer-Jagens.
[61] Und diejenigen talentlosen Mädchen, die das Netz an die Wand hängen, wenn sie den Fisch glücklich gefangen haben, sind noch die besten. Die da noch weiter dudeln, haben dann nicht genug am Besitz ihres Hechtes, sondern verlangen noch mehr… „Elles aspirent aux adorateurs“ – wie Pascal sagt. Und wie zweckdienlich bietet sich da die executirende Tonkunst! Holl spricht von der elenden Koketterie, die beim musikalischen Vortrag nicht nur in der Gestaltung einer fesselnden Melodie, sondern auch in der zierlichen Bewegung der Glieder, in dem Schlagen und Klappern der Wimpern, in den leise sich rötenden Wangen Mittel besitzt, die Augen auf sich zu ziehen. Er kannte eine sogenannte musikalische Hausfrau, die, wenn sie zu Abend einmal einen Gast erwartete, jedes Mal dann sich ans Klavier setzte, sobald draußen im Vorsaal die Klingel erscholl. Der eintretende Gast, dem gegenüber sie die begeisterte Künstlerin heuchelte, die unverhofft überrascht wird, fand sie dann in den erbaulichsten Posen, den Kopf geneigt, die Blicke nach oben gerichtet, die Hände schlenkernd… Eheu!
Die Römer der guten alten Zeit, die sehr praktische nüchterne Köpfe waren, durchschauten die Beweggründe des Musik-Dilettantismus besser als der Verfasser der „Silvae“. Auch später noch ging der vortreffliche Quintilian, der keineswegs ein Gegner der Tonkunst war, sondern sie dringend empfahl, in seiner Strenge so weit, das viele Kithara-Gedudel der römischen Damen als einfach unmoralisch zu brandmarken, während Sallust die Sempronia, die bekannte Mitwisserin des Catilina, dadurch anrüchig kennzeichnet, daß er ihr eine allzu graziöse Handhabung des Plektrums nachsagt.
Dergleichen heißt ja nun allerdings wohl ein wenig das [62] Kind mit dem Bade ausschütten. Der Grundgedanke aber ist der: Wir durchschauen euch. Neun Zehntel von euch klimpern und trällern im Hinblick auf Dinge, die außerhalb des Rahmens der echten Kunst liegen.
Die Forderungen, die wir aus unserer Darlegung ableiten, resümiren sich also wie folgt:
Es ist notwendig, daß die Suprematie der Musik, die geradezu lächerlich übertriebene Wertschätzung und Erhöhung über die Schwesterkünste, die ihr von Seiten des denkfaulen Publikums — zum großen Teil aus den oben entwickelten Gründen — gezollt wird, durch eine ausgiebigere und selbstbewußtere Pflege der bildenden Künste und der Dichtkunst gebrochen wird.
Es ist notwendig, daß sich, im Anschluß an diese theoretische Emancipation, die künstlerisch genießende Menschheit auch in praxi von dem schädlichen und widersinnigen Zuviel befreit, das gegenwärtig in Gestalt einer musikalischen Sintflut das großstädtische Leben bis zur Bewußtlosigkeit überschwemmt.
Es ist notwendig, daß zur Erreichung der hier angedeuteten Ziele die musikalische Heuchelei[3] und das elende Phrasentum [63] der Musik-Unverständigen schonungslos entlarvt und an den Pranger gestellt wird.
Es ist notwendig, mit den törichten Vorurteilen, die den Musikunterricht gegenwärtig zu einer Tortur für die Mehrheit der Jugend stempeln, ein für alle Mal auszuräumen.
Und es ist notwendig, der musikalischen Vergewaltigung seitens der Klimperer, Kratzer, Dudler und Bläser durch polizeiliche Vorschriften eingreifender Art gründlich das Handwerk zu legen.
Ein Staatsmann, der einen oder den andern dieser Punkte befriedigend zur Erledigung brächte, würde sich um das Vaterland wohl verdient machen. Bis dahin möge der Widerstand gegen die Musiktyrannei wenigstens hier und da den Versuch machen, aus dem Stadium des individuellen Stöhnens und Fäusteballens herauszukommen und sich werkthätig zu organisiren, unbekümmert um das Jammergeheul der oben geschilderten klavierenden Herren und gröhlenden Jungfrauen. Auch die südamerikanischen Sklavenhalter erhoben ein Wutgeschrei, als die Union Anstalten traf, ihnen die menschenzerfressende Peitsche aus den Händen zu reißen. Also mit Gott, ihr längst zur Verzweiflung gebrachten Dulder! Reichen wir uns die rettende Bruderhand zum Befreiungskriege wider das Dudlertum!
[64]
Druck von Greßner & Schramm, Leipzig.
Anmerkungen des Autors
- ↑ Uebersetzung von Leo Berg, Stuttgart 1893, Deutsche Verlags-Anstalt.
- ↑ Der Kaiser Alexander Severus war Dilettant auf der Tuba; aber der Mann besaß soviel Anstandsgefühl, sich stets, wenn er dies schwerdröhnende Instrument bließ, in seine entlegensten Gemächer zurückzuziehen.
- ↑ Ad vocem musikalische Heuchelei hier noch das Nachstehende! „Ich spielte z. B.“ — erzählt Franz Liszt in einem Brief an George Sand — „ein und daselbe Stück, bald als Composition Beethoven’s, bald als die Czerny’s, bald als meine eigene. An dem Tage, an welchem ich sie als mein eigenes Werk vorführte, erntete ich den aufmunderndsten Beifall: „Das sei gar nicht übel für mein Alter!“ sagte man; an dem Tage, an welchem ich sie unter Czerny’s Namen spielte, hörte man mir kaum zu; spielte ich sie aber unter Beethoven’s Autorität, so wußte ich mir die Bravos der ganzen Versammlung zu sichern.“ An einer anderen Stelle berichtet Liszt: „Ohne Benachrichtigung des Publikums wurde ein Trio von Pixis an Stelle eines solchen von Beethoven gespielt. Der Beifall war stürmischer und größer als je; als aber das Trio von Beethoven den ursprünglich für Pixis bestimmten Platz einnahm, fand man es kalt, mittelmäßig und langweilig. Es gab Leute, die davonliefen, indem sie die Zumutung des Herrn Pixis, sein Werk nach dem soeben gehörten Meisterwerk vorzuführen, geradezu für impertinent erklärten!“ – Verlogener Pöbel!
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ fälschlich wiederholend: der