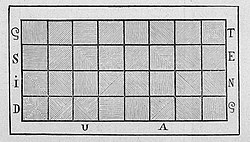Die Gartenlaube (1885)/Heft 8
[125]
| No. 8. | 1885. | |
Illustrirtes Familienblatt. — Begründet von Ernst Keil 1853.
Die Frau mit den Karfunkelsteinen.
Am anderen Morgen hieß es für Grete sich flink auf die Füße
machen und durch die thautriefenden Stoppelfelder hinauswandern
nach Dambach, obgleich der Papa versicherte, daß der
alte Herr Nachmittags hereinkommen und mit ihm auf die Hühnerjagd
gehen wolle.
Und das Wiedersehen draußen war noch viel schöner gewesen, als es sich das junge Mädchen in Berlin ausgemalt hatte. Ja, sie war sein Liebling geblieben! Der prächtige Greis, knorrig von Gestalt und rauh von Wesen, er war ganz mild und weich geworden; er hätte sie am liebsten wie ein Püppchen auf seinen breiten Handteller gesetzt, um sie den herzulaufenden Fabrikleuten zu zeigen. – Sie war über Mittag geblieben, und die Frau Faktorin hatte ihre allerschönsten Eierkuchen backen müssen; aber auf ihren noch berühmteren Kaffee wurde nicht gewartet – pünktlich auf die Minute warf der passionirte alte Jäger Flinte und Büchsenranzen über, dann ging es auf der Chaussee in scharfem Marsche vorwärts.
Drüben zur Seite lag der Prinzenhof. Luft und Beleuchtung waren so klar und scharf, daß man die Blumengruppen auf dem Rasenparterre bunt herüberleuchten sah. Allerdings, hübsch genug
[126] war das Schlößchen geworden! Früher hatte es wie ein verschlafenes Dornröschen zu Füßen des Berges gelegen – halb unter dem schützenden Betthimmel des bergaufkletternden Waldes, den heute schon die gelben und rothen Flammen des Herbstes betupften – ohne Glanz und Farben und wenig beachtet. Jetzt hatte es sich gereckt und gestreckt und die Augen aufgeschlagen; zwischen den dunklen Nußbäumen glitzerte und flimmerte es, als sei eine Hand voll Diamanten dort verstreut worden – die alten, vermorschten und nie geöffneten Jalousien waren verschwunden, und neue, ungebrochene Spiegelscheiben füllten die mächtigen steinernen Fensterrahmen.
„Ja gelt, Gretel, wir sind vornehm geworden hier draußen?“ fragte der Großpapa. Er zeigte mit ausgestrecktem Arm hinüber. Wie ein Recke schritt er dahin, der Siebziger! Unter seinen Tritten krachte das Chausséegeröll, und sein mächtiger weißer Schnauzbart leuchtete wie Silber in dem braunen, kühnen Gesicht, das die breite, einst auf dem Fechtboden geholte Schmarre quer über der Wange von der einen Seite fast furchtgebietend machte. „Ja, vornehm und fremdländisch!“ bekräftigte er weiterstapfend; „wenngleich die Frau Mama eine urdeutsche Pommersche ist und die Tochter auch von väterlicher Seite her Nichts von John Bull oder den ‚Parlez-vous français‘ in den Adern hat – macht nichts! – es wird doch auf englische Art gekocht und gegessen und französisch parlirt nach Noten ... Ja, die alten Nußbäume werden wohl gucken und sich in ihr Herz hinein schämen, daß sie in ihren alten Tagen wie dumme Bauerjungen dastehen und in ihrer Jugend nicht lieber Platanen oder sonst was Vornehmes geworden sind.“
Margarete lachte.
„Ja, da lachst Du, und Dein Großvater lacht auch! – Ich lache über den Staub, den zwei Weiberröcke da herum –“ er beschrieb mit ausgestrecktem Arm einen weiten Bogen über die Gegend hin – „aufwirbeln – die reine Affenkomödie, sag’ ich Dir! ... ‚Warst Du schon im Prinzenhof?‘ heißt’s da, und ‚bist Du schon vorgestellt?‘ dort! Und der Eine grüßt kaum, wenn man nicht, wie er, beim großen Diner gewesen ist, und ein Anderer stiert Einem ganz perplex, wie einem notorisch Verrückten, ins Gesicht, wenn man sagt, daß man sich bedankt hat und lieber in seinen vier Pfählen geblieben ist ... Ja, guck, Gretel, der Mensch lernt nicht aus! Hab’ da gemeint, ich lebe mitten unter lauter Hauptkerlen vom thüringischeu Schlag, von echtem Schrot und Korn, und da quetschen sich jetzt die alten Knasterbärte in den Frack, schütten sich Eau de lavande, oder anderes Riechzeug –“ er unterdrückte nur halb ein energisches „Pfui Teufel!“ – „auf ihre Schnupftücher und schlucken zimperlich eine Tasse Thee mit Butterbemmchen da drüben – sie mögen schön dran würgen, die ausgepichten Burgunderschläuche die!“
Margarete sah ihn von der Seite an; von der betonten Lachlust vermochte sie keine Spur zu finden; wohl aber sprühte ihm der helle, ehrliche Manneszorn unter den weißbuschigen gerunzelten Brauen hervor. Sie hing sich schleunigst an seinen Arm, hob den rechten Fuß und versuchte in seine weiten, militärisch strammen Schritte einzulenken.
Er schmunzelte und schielte seitwärts auf sie herunter. Die winzige Spitze ihres Stiefelchens sah gar zu lächerlich aus neben dem ungeheuren Jagdstiefel. „Was für arme Spazierstöckchen! Und das will sich auch noch mausig machen!“ höhnte er. „Geh, gieb’s auf, Gretel! Da lebt die Junge dort“ – er zeigte nach dem Prinzenhofe zurück – „auf einem anderen Fuße! Sapperlot, da muß man Respekt haben! Freilich, ihr Beide könntet in der Wiege umgetauscht sein – solch ein polizeiwidrig kleines Pedal kommt Dir nicht zu, und bei einer Blaublütigen ist ein großer Fuß allemal nur ein unbegreifliches, boshaftes Naturspiel ... Aber schön ist sie sonst, die junge ‚Gnädige‘ – Alles was wahr ist! Weiß und roth wie Milch und Blut, blond, – Du braunes Maikäferchen mußt Dich daneben verkriechen – groß“ – er hob die Hand fast bis zu seiner Kopfeshöhe – „schwer und drall, echt pommersche Rasse, und gesetzt und pomadig! Solch ein Windspiel, wie eben eines neben mir hertrippelt, kommt da nicht auf.“ –
„Ach Großpapa, das Windspiel freut sich seines Lebens, so wie es ist – darüber lasse Du Dir ja kein graues Haar wachsen!“ lachte das junge Mädchen. „Uebrigens haben die armen Spazierstöckchen schon ganz Respektables geleistet, und es fragt sich noch sehr, ob Dein großer Siebenmeilenstiefel da mit mir Leichtfuß auf den Schweizerbergen konkurriren könnte. Frage nur den Onkel Theobald in Berlin!“
Damit lenkte sie glücklich auf ein anderes Thema über. Der alte Mann war tief ergrimmt und gereizt; er übergoß die zukünftige Schwiegertochter mit der ganzen scharfen Lauge seines Spottes. Seine Beziehungen zu der Großmama mochten deßhalb augenblicklich noch weit weniger friedfertig sein, als gewöhnlich. Und er hatte sicher wieder einmal Recht, sein scharfer Blick trog selten; aber die Enkelin konnte und durfte doch nicht Oel ins Feuer gießen, und so erzählte sie in anschaulicher Weise von dem Hospiz auf dem Sankt Bernhard, wo sie mit Onkel und Tante während eines furchtbaren Schneesturmes übernachtet, von allerhand Erlebnissen in Italien und so weiter; und der alte Herr hörte ganz hingenommen zu, bis der Packhaus-Thorflügel hinter ihnen zufiel und das abgefallene Lindenlaub im Hofe unter ihren Füßen knisternd umherstob.
Sie betraten eben den Flur des Vorderhauses, als ein winzig kleiner Hund, ein Affenpinscher, durch einen schmalen Spalt des Hausthores vom Markte hereinschlüpfte. Er kläffte die Eintretenden mit hoher, scharfer Stimme an.
Margarete kannte das kleine Thier. Vor Jahren war Herr Lenz einmal von einer Reise zurückgekommen und hatte es mitgebracht. Und es hatte ausgesehen, als sei es das Schoßhündchen einer Prinzessin gewesen. Blauseidene Bandschleifen hatten aus seinem zottigen Fell geleuchtet, und an kalten Tagen war es in einer schöngestickten Purpurschabracke auf dem Gange herumgelaufen. Trotz aller Lockungen war es aber nie in den Hof zu den Kindern herabgekommen, die Malersleute hüteten es wie ein Kind.
Nun kam es da hereingelaufen, und gleich darauf wurde der Thorflügel weiter aufgestoßen, und ein Knabe sprang ihm nach. Fast in demselben Momente klirrte aber auch das in den Hausflur mündende Fenster des Komptoirs, und Reinhold’s Kopf fuhr heraus.
„Du infamer Bengel, habe ich Dir nicht verboten, hier durchzugehen?“ schrie er den Knaben an. „Ist etwa der Thorweg im Packhause nicht breit genug für Dich? ... Das ist das Herrschaftshaus, und da hast Du absolut nichts zu suchen, so wenig wie Deine Leute! Habe ich Dir das nicht schon gesagt? Verstehst Du denn nicht Deutsch, einfältiger Junge?“
„Was kann ich denn dafür, wenn Philine mir ausreißt und hier hereinläuft? Ich wollte sie fangen, aber es ging nicht gut, weil ich den Korb am Arme habe!“ entschuldigte sich der Kleine mit einem etwas fremdartigen Accent. „Und Deutsch kann ich sehr gut; ich verstehe Alles, was Sie sagen,“ setzte er gekränkt, aber auch trotzig hinzu. Er war ein bildschönes Kind; ein wahrer kleiner Apollokopf, umringelt von kurzgeschnittenen braunen Locken und strahlend in Frische und Gesundheit, saß fest und hochgetragen auf dem kräftigen Nacken. Aber all diese Lieblichkeit schien nicht vorhanden für den bleichsüchtigen jungen Menschen mit dem tödlich kalten Blick und der keifenden Stimme, der am Komptoirfenster stand.
Und nun ließ sich die entwischte Philine auch noch einfallen, die nach der Wohnstube führenden Stufen hinaufzuspringen, als sei sie da zu Hause.
Reinhold stampfte mit dem Fuße auf, während der Knabe ängstlich der kläffenden Missethäterin um einige Schritte nachlief.
„Nun mache Dich nur schleunigst aus dem Staube, Junge,“ scholl es erbittert aus dem Fenster, „oder ich komme hinaus und schlage Dich und Deinen Köter windelweich –“
„Na na, das wollen wir erst ’mal sehen, Verehrtester! Da sind auch noch andere Leute da, die das zu verhindern wissen!“ sagte der alte Amtsrath und stand mit zwei Schritten vor dem Fenster.
Reinhold duckte sich unwillkürlich vor der plötzlichen, gewaltigen Erscheinung des Großvaters.
„Bist mir ja ein schöner Kerl!“ höhnte der alte Herr – Aerger und Sarkasmns stritten in seiner Stimme. „Keifst wie ein Waschweib und machst Dich mausig in Deines Vaters Hause, als hättest Du den Hauptsitz in der Schreibstube. Geh’, laß Dir erst die Federn wachsen und den Schnabel putzen! ... Warum soll denn das Bürschchen da nicht durchgehen, he? Meinst vielleicht, er tritt Euch von dem kostbaren Steinpflaster da ’was herunter?“
[127] „Ich – ich kann das Kläffen nicht vertragen, es greift mir die Nerven an -“
„Hör’ mir auf mit Deinen Nerven, Junge! Mir wird ganz übel bei dem Gewinsel! Schämst Du Dich denn nicht, zu thun, als hätten sie Dich im Altweiberspittel erzogen? ‚Meine Nerven!‘“ ahmte er ihm zornig nach. „I, da soll doch –“ er verschluckte den Rest des Donnerwetters, zerrte an seinem Flintenriemen und drückte sich den Hut mit der Spielhahnfeder fester in die Stirn.
Inzwischen war auch Margarete näher getreten. „Aber Reinhold,“ sagte sie vorwurfsvoll, „was hat Dir denn der Kleine gethan –“
„Der? Mir?“ unterbrach er sie höhnisch – die Kourage war ihm zurückgekehrt. „Na wirklich, das hätte noch gefehlt, daß uns die Leute aus dem Hinterhause auch noch direkt zu Leibe gingen! ... Sei Du nur erst ein paar Wochen hier, Grete, da wird es Dir gerade so gehen wie mir, da wirst Du Dich umgucken, Jungfer Weisheit! Wenn wir die Augen nicht offen halten, da wird bald kein Fleckchen mehr im Hause sein, wo der Bursche dort“ – er zeigte nach dem Knaben, der eben seinen Handkorb auf den Boden setzte, um den widerspenstigen Hund besser greifen zu können – „nicht Fuß faßt! ... Der Papa ist ganz unbegreiflich indolent und nachsichtig geworden. Er leidet’s, daß der Junge in unserem Hofe herumtollt und sich mit seinen Schreibeheften unter den Linden breit macht - auf unserem Lieblingsplatz, Grete, wo wir, seine eigenen Kinder, unsere Schularbeiten gemacht haben! Und vor ein paar Tagen habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie er ihm im Vorübergehen ein neues Buch auf den Tisch gelegt hat –“
„Neidhammel!“ brummte der Amtsrath unwillig.
„Denke was Du willst, Großpapa!“ platzte der sichtlich Erbitterte heraus. „Aber ich bin sparsam wie alle früheren Vertreter unserer Firma, und über hinausgeworfenes Geld kann ich mich wüthend ärgern. Man schenkt nicht auch noch Leuten, die Einem ohnehin auf der Tasche liegen. Jetzt, wo mir die Bücher vorliegen, jetzt weiß ich, daß der alte Lenz nie auch nur einen Pfennig Miethzins für das Packhaus gezahlt hat. Dabei ist er ein so langsamer Arbeiter, daß er kaum das Salz verdient. Er müßte nothwendig per Stück bezahlt werden, aber da giebt ihm der Papa jahraus, jahrein seine dreihundert Thaler, ganz einerlei, ob er auch nur einen Teller einliefert oder nicht, und das Geschäft hat den bittersten Schaden ... Ich sollte nur einen einzigen Tag die Macht haben, da sollte aber Ordnung werden, da würde aufgeräumt mit dem alten Schlendrian –“
„Na, dann ist’s ja ein wahres Glück, daß solche Grünschnäbel kuschen müssen, bis –“
„Ja, bis der Hauptsitz in der Schreibstube leer geworden ist,“ ergänzte der Kommerzienrath, der plötzlich dazwischen trat. Wahrscheinlicher Weise hatte er Schwiegervater und Tochter über den Hof her kommen sehen und sich schleunigst fertig gemacht, um den pünktlichen alten Herrn drunten nicht warten zu lassen. Er war im Jagdanzuge und mochte wohl im Herabkommen den größten Theil des Wortwechsels am Komptoirfenster mit angehört haben – es lag etwas Ungestümes in seinem plötzlichen Hervortreten, und Margarete sah, wie ihm beim Sprechen die Unterlippe nervös bebte. Er streifte übrigens das Fenster mit keinem Blicke, er zuckte nur die Achseln und sagte ganz obenhin, in fast jovialem Tone: „Leider hat diesen Hauptsitz der Papa noch inne, und da wird sich das sehr weise Söhnlein das Aufräumen für vielleicht noch recht lange Zeit vergehen lassen müssen.“
Damit reichte er begrüßend seinem Schwiegervater die Hand hin.
Das Fenster wurde geräuschlos zugedrückt. und gleich darauf hing der dunkle Wollvorhang so bewegungslos dahinter, als sei auch nicht der Schatten eines Menschen daran hingestrichen. Der junge Heißsporn mochte sich in Nummer Sicher hinter seinen Schreibtisch zurückgezogen haben.
Unterdessen war es dem Knaben gelungen, die eigenwillige Philine einzufangen; Tante Sophie, die eben mit einem Porcellankörbchen voll Gebäck aus der Wohnstube kam, hatte ihm geholfen, indem sie sich breit über den Weg gestellt. Nun klapperten seine kleinen Absätze die Stufen herab, auf einem Arme hatte er den Hund, und an den anderen hing er wieder seinen Korb – sein Gesichtchen sah ganz alterirt aus.
„Hast Du geweint, mein Kleiner?“ fragte der Kommerzienrath und bog sich zu ihm nieder. Margarete meinte, sie habe noch nie diese Stimme so weich und innig gehört, wie bei der theilnehmenden Frage, die dem sonst so kalt seinen Weg gehenden, vornehm zurückhaltenden Mann gleichsam entschlüpfte.
„Ich? – was denken Sie denn?“ entgegnete der Kleine. ganz beleidigt. „Ein richtiger Junge heult doch nicht!“
„Bravo! Recht so, mein Junge!“ lachte der Amtsrath überrascht auf. „Du bist ja ein Prachtkerl!“
Der Kommerzienrath ergriff den Hund, der alle Anstrengungen machte, sich zu befreien, und stellte ihn auf die Beine. „Er wird Dir schon nachlaufen, wenn Du über den Hof gehst,“ sagte er beruhigend zu dem Kinde. „Aber an Deiner Stelle würde ich mich doch schämen, mit dem Korbe über die Straße zu gehen;“ – er sah finster auf das Anhängsel an dem kleinen Arme, als ärgere er sich, die ideale Gestalt dadurch entstellt zu sehen – „für einen Gymnasiasten paßt das nicht – Deine Kameraden werden Dich auslachen.“
„O – das sollen sie nur probiren!“ Er wurde ganz roth im Gesicht und hob den schönen Kopf keck und energisch wie ein Kampfhähnchen. „Ich werde doch für meine Großmama Semmeln holen dürfen? Unsere Aufwartfrau ist krank, und die Großmama hat einen schlimmen Fuß, und wenn ich nicht gehe, da hat sie nichts zu ihrem Kaffee, und da frage ich viel nach den dummen Jungen!“
„Das ist hübsch von Dir, Max,“ sagte Tante Sophie. Sie nahm eine Handvoll Mandelgebäck aus ihrem Körbchen und reichte sie ihm hin.
Er sah freundlich zu ihr auf, aber er griff nicht zu. „Ich danke, ich danke sehr, Fräulein!“ sagte er und fuhr sich, selbst verlegen über seine Abweisung, mit der Hand in die Locken. „Aber wissen Sie, Süßes esse ich niemals – das ist nur für Mädchen!“
Der Amtsrath brach in ein lautes Gelächter aus, sein ganzes Gesicht strahlte, und plötzlich hob er das Kind sammt seinem Korb hoch vom Boden auf und küßte es herzhaft auf die blühende Wange. „Ja, der ist freilich aus einem anderen Holze! Sackerlot, das wär’ Einer nach meinem Sinn!“ rief er, indem er den Knaben wieder aus seinen gewaltigen, kraftvollen Händen entließ. „Wie kommt denn das kleine Weltwunder in die Rumpelkammer, in das alte Packhaus?“
„'S ist ein kleiner Franzose,“ sagte Tante Sophie. „Gelt, in Paris bist Du eigentlich zu Hause?“ fragte sie den Kleinen.
„Ja. Aber die Mama ist gestorben und –“
„Sieh doch – Deine Philine ist schon wieder echappirt!“ rief der Kommerzienrath. „Lauf’ ihr nach! Sie ist im Stande und rennt bis hinauf zu der alten Dame, die oben wohnt!“
Der Kleine sprang die Stufen hinauf.
„Ja, seine Eltern sollen beide gestorben sein,“ sagte Tante Sophie halblaut zu dem alten Herrn.
„Das ist ja aber gar nicht wahr!“ protestirte der Knabe von der Treppe herab. „Mein Papa ist nicht todt, nur weit fort, sagte die Mama immer – ich glaube, weit über dem Meer drüben.“
„Und sehnst Du Dich denn nicht nach ihm?“ fragte Margarete.
„Ich habe ihn ja doch noch niemals gesehen, den Papa,“ antwortete er halb trocken, halb im Ton naiver Verwunderung darüber, daß er sich nach Etwas sehnen sollte, wovon er keine Vorstellung hatte.
„Das ist ja eine närrische Geschichte! Den Teufel auch! Hm!“ brummte der Amtsrath fast betreten und schlenkerte die Finger der rechten Hand, als habe er sich an Etwas verbrannt. „Da ist er ja wohl gar von einer Lenz’schen Tochter?“
„Kann ich nicht sagen – so viel ich weiß, ist nur eine da,“ versetzte Tante Sophie. „Wie hat denn Deine Mutter geheißen, Jüngelchen?“
„Mama und Apolline hat sie geheißen,“ antwortete der Knabe kurz. Er war des Ausfragens sichtlich müde und strebte an den Umstehenden vorüber zu kommen. Philine hatte sich endlich bequemt, den richtigen Ausgang zu suchen, und war bellend in den Hof hinausgelaufen
„Nun springe aber, Kleiner!“ sagte der Kommerzienrath, der währenddem schweigend, aber mit einer Ungeduld zwischen Haus- und Hofthür hin- und hergegangen war, als brenne ihm der Boden unter den Sohlen, und fürchte er, etwas von seinem Jagdvergnügen einzubüßen. „Paß auf, Deine Semmeln kommen zu spät – der Kaffee wird längst getrunken sein!“
[128] „Ach, der ist ja noch gar nicht gekocht!“ lachte der Kleine. „Ich muß doch erst Späne vom Boden herunterholen und klein machen.“
„Mir scheint, sie machen Dich zum Aschenputtel da drüben,“ sagte der Kommerzienrath, indem seine dunklen Augen aufblitzend das Packhaus suchten.
„Meinst Du, das schade dem Bürschchen?“ fragte sein Schwiegervater. „Ich habe auch als neunjährige kleine Krabbe Holz für die Küche klein gemacht und bin in Feld und Stall zur Hand gewesen, wie ein Hirtenjunge – bleibt das etwa an dem Manne kleben? ... Was hat denn solch ein armer kleiner Schlucker für eine Zukunft? – Da ist Etwas faul und nicht in der Ordnung, so viel merk’ ich, und ob man je über das Meer wiederkommen und seine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit thun wird, das fragt sich – mit dem Worthalten in solchen Dingen ist heutzutage nicht viel los. Na, und der Alte dort –“ er zeigte nach dem Packhause – „der wird gerade auch nicht schwer an seinem Geldkasten zu schleppen haben; da heißt’s einmal für den Mosje da, sich durchschlagen und alle Kraft aufwenden, daß im großen Weltgetriebe der Kopf oben bleibt –“
„Ich will ihn später ins Komptoir nehmen,“ fiel der Kommerzienrath ein; er legte dabei seine Hand wie unwillkürlich schützend auf den braunen Lockenkopf, als gehe ihm der Gedanke, daß dieses prächtige Kind im Kampf ums Dasein untergehen könne, ans Herz.
„Na, das ist ein Wort, Balduin, das freut mich! Dann zieh’ Dir aber auch den da drin –“ er neigte den Kopf nach dem Komptoirfenster, hinter welchem sich eben wieder die Vorhangsfalten verrätherisch bewegten – „erst besser, sonst giebt’s Mord und Todtschlag.“
Er klopfte seiner Enkelin zärtlich die Wange und reichte Tante Sophie abschiednehmend die Hand. „Auf Wiedersehen, Base Sophie!“ – er nannte sie stets so – „Ich werde diese Nacht wieder einmal in meiner Stadtkoje logiren – möchte gern einen Abend mit Herbert und der Gretel zusammen sein. Bitte, es droben bei der Gestrengen allerunterthänigst zu vermelden!“ setzte er mit einer ironisch feierlichen Verbeugung hinzu und trat hinaus auf den Marktplatz.
Der Kommerzienrath blieb noch einen Moment wie angefesselt stehen. Er sah, zurückgewendet, wie seine Tochter dem fortstürmenden Knaben bis weit in den Hof hinein nachflog, ihm mit beiden Händen in das reiche Lockenhaar fuhr und den lachenden kleinen Bengel küßte. Das war ein liebliches Bild, anziehend genug, um wohl einen Jeden das Fortgehen vergessen zu machen ...
„Na, da hat sie ihn ja schon beim Schlafittchen!“ sagte Bärbe, die am Küchenfenster hantirte und schräg hinaus die Gruppe im Hofe auch sehen konnte, schmunzelnd zu der Hausmagd. „Dachte mirs doch gleich, daß unser braves Gretel mit dem Reinhold und der im oberen Stocke nicht in ein Horn blasen würde. Der kleine Schlingel mit seinem schönen Krauskopfe thuts ja einem Jeden an, der ein Herz und keinen Stein in der Brust hat ... Da läuft er hin und will sich ausschütten vor Lachen über den Spaß, daß ihn das schöne Mädchen bei den Haaren erwischt hat! ’S ist doch ’was Schönes um die liebe Jugend! Das mußt Du doch selbst sagen, Jette – ’s ist gleich ein ganz anderes Leben, wenn so ein junges Blut unter uns alte Husaren kommt! Das frischt auf!“
Und sie that ein paar kräftige Züge aus dem geliebten Kaffetopfe und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war heiß in der Küche. Der mächtige Brat- und Backherd glühte, und liebliche Küchendüfte schwebten in die sonnendurchfunkelte Herbstluft hinaus – es wurde gebacken, als solle eine ganze Kompagnie heißhungeriger Soldaten vom Manöver einrücken; war aber Alles nur der einzigen heimgekehrten Tochter des Hauses zu Ehren ...
„Aber wahr ists, Gretel – bist doch noch genau derselbige Kindskopf, wie dazumal, wo Du mir auf Tritt und Schritt nachgelaufen bist, beide Hände an meinen Rockfalten, ganz einerlei, ob’s auf den Boden oder in den Keller ging!“ sagte Tante Sophie halb lachend, halb ärgerlich in einer der späteren Nachmittagsstunden des anderen Tages. Sie stand im rothen Salon der Beletage, und der Hausknecht reichte ihr die Bilder von den Wänden herab. Alle nach dem Flursaal mündenden Thüren der Zimmerreihe standen offen; das Tageslicht fiel durch lauter vorhangentblößte Fenster, und aufgescheuchte Staubwölkchen flirrten und tanzten lustig in den Flursaal hinaus. Neue Tapeten, neue Gardinen, Portieren und Teppiche sollten für die voraussichtlich glänzende, gesellschaftlich belebte Wintersaison in die Zimmer kommen – das gab auf Wochen hinaus einen fürchterlichen Rumor.
„Hier oben ist nichts für Dich, Gretel, Trotzkopf!“ wiederholte die Tante nachdrücklicher und winkte abwehrend dem jungen Mädchen, das lachend nun erst recht auf der Schwelle Posto faßte. „Es zieht und stäubt – ganz unverschämt stäubt’s, sag’ ich Dir! Möchte nur wissen wo er immer wieder herkommt, der verflixte graue Puder! Da rennt man das ganze Jahr durch mit Wischtuch und Staubwedel hier oben herum, als wenns extra bezahlt würde – und nun solche Wolken! Die Alten da oben“ – sie zeigte auf verschiedene, noch hängende Oelbilder längst vermoderter Geschlechter – „müssen sie geradezu aus ihren Perücken und Haarbeuteln schütteln ... und Dein Pudelkopf wird davon gerade auch nicht schöner werden, Gretel!“
„Schadet nichts, Tante! Ich bleibe da, und ehe Du Dich versiehst, hast Du auch meine beiden Hände wieder an Deinen Rockfalten. Es ist eine gar verwirrte Zeit, in der wir leben, der moderne Thurmbau zu Babel – nur umgekehrt – wir bauen nach unten, in die stockdunkle Nacht hinein. Man weiß kaum noch, was recht, was schlecht, was krumm oder gerade, erlaubt oder verpönt ist, einen solchen Mischmasch der Begriffe haben die famosen ‚Baubeflissenen nach unten‘ zu Stande gebracht. Und da muß ein junges Ding wie ich froh sein, wenn es sich an einen richtigen Steuermann festklammern kann – und der bist Du, Tante!“
„Geh weg! Ich dächte doch, gerade Du hättest Dein Köpfchen für Dich und ließest Dir nicht so leicht ein X für ein U vormachen ... Da, hilf mir – wenn Du denn durchaus nicht fortzubringen bist – nimm sie am anderen Ende, ich kann sie nicht allein schleppen, die schöne Dore!“
Und Margarete ergriff das eben von der Wand gehobene Bild und half es über den Flursaal hinweg in den spukhaften Gang tragen, dessen Thür heute weit zurückgeschlagen war. Dort lehnte schon eine ganze Reihe abgenommener Bilder an den Wänden; da standen sie geschützt: kein vorübergehender Fuß berührte sie, und nicht ein zudringlicher Sonnenstrahl schädigte ihre Farben.
Sie war in der That schwer, die Frau mit den Karfunkelsteinen. Sie stand in einem geschnitzten, reichvergoldeten, wenn auch nahezu erblindeten Rahmen, der eine von breitem Band umwundene Rosen- und Myrthenguirlande bildete. Die Frau hielt ja auch ein paar Myrthenzweiglein lässig zwischen den schlanken Fingern – so war sie jedenfalls als Braut gemalt. Das Bild war ein Kniestück, das junge Weib in smaragdfarbener, mit Silberblumen durchwirkter Brokatrobe darstellend – aber was für ein Weib war das!
Margarete hatte oft in kindlicher Neugier zu dem Bilde aufgeblickt; aber was hatte sie damals von der Beseelung einer Gestalt, von der Darstellungskraft des Pinsels verstanden? Es war ihr immer nur aufgefallen, daß die hohe Frisur, die bei all den anderen Lamprecht’schen Hausfrauen und Töchtern schneeweißer Puder bestäubte, ihre tiefe Schwärze behauptet hatte. Jetzt kniete das junge Mädchen auf den Dielen vor dem Bilde und sagte sich angesichts dieser erstaunlichen Haarfülle, aus deren nachtdunklem Geschlinge die täuschend gemalten fünf Rubinensterne förmlich glitzerte, und von welchem einzelne gelöste Ringel schlangenhaft weich auch über die zarte Brustwölbung hinabsanken, daß diese Frau sich kühn und energisch gegen die herrschende Mode und die Verunglimpfung ihres stolzesten Schmuckes verwahrt habe. Jetzt war es auch begreiflich, daß ihr der Volksmund das Wandern nach dem Tode angedichtet. Ihre Zeitgenossen, welche das Feuer aus diesen mächtigen dunklen Augen in Wirklichkeit hatten sprühen sehen, und vor welchen die zarte, bis in die graziös gebogenen Fingerspitzen hinein beseelte Erscheinung leibhaftig gewandelt und geathmet, sie hatten an ein wirkliches Sterben und Erlöschen solchen Zaubers nicht glauben können.
Es war doch etwas Wunderbares um so ein urdeutsches, altes Haus mit seinen Traditionen, die sich an das altfränkische
[129][130] Geräth knüpften und jeden Winkel belebten! Nur feierlicher, aber geheimnißvoller gewiß nicht war ihr beim Beschreiten der marmorbelegten Korridore alter venezianischer Paläste zu Muthe gewesen, als jetzt im Vaterhause, wo die Gangdielen unter ihren Tritten seufzten und die Gestalten der alten Leinenhändler die Wand entlang mit gespenstigem Leben aus dem Halbdunkel auftauchten, in ihrer Reihe immer nur von einer der stummen, geschlossenen Thüren unterbrochen, hinter denen so manches Geheimniß schlafen mochte.
Wohl hatte der Papa einst das hier seit vielen Jahren herrschende Schweigen gestört und sich in den verrufenen Zimmern einquartiert, um das abergläubische Gesinde von seiner Gespensterfurcht zu kuriren, er war auch bei seiner jedesmaligen Heimkehr, die zu jener Zeit stets nur für wenige Wochen seine Reisen unterbrach, mit Vorliebe in diesem seinem „Tusculum“ verblieben. Aber schon nach zwei Jahren hatte sich das geändert; der Ausblick in den stillen Hof mochte ihm doch auf die Dauer nicht behagt haben. Nach einer fast halbjährigen Abwesenheit hatte er eines Tages von der Schweiz aus angeordnet, daß das ehemalige Boudoir seiner verstorbenen Frau wieder für ihn hergerichtet werde. Margarete erinnerte sich noch, daß damals zu ihrer Betrübniß die rosenfarbene Polstereinrichtung, die Aquarelle und Rosenholzmöbel in ein anderes Zimmer geschafft und durch ein dunkles Meublement ersetzt worden waren. Und als er nach Hause gekommen, da hatte er das große Oelbild seiner verstorbenen Frau, das einzige, welches seinen Platz an der Wand behauptet, sofort in den anstoßenden Salon hängen lassen; der Anblick des Bildes, ebenso wie die ganze Einrichtung scheine ihm neuerdings die alte Wunde aufzureißen, hatte die Großmama gemeint und deßhalb das Arrangement vollkommen gebilligt. Die Zimmer im Seitenflügel aber waren unter seiner speciellen Aufsicht wieder in den früheren Stand versetzt worden – auch nicht der geringste Gegenstand der modernen Einrichtung war darin verblieben – dann hatte er lüften und scheuern lassen, hatte eigenhändig die Vorhänge zugezogen und den Schlüssel, wie früher auch, an sich genommen. –
Margarete bückte sich und sah durch das weite Schlüsselloch in das Zimmer mit dem herrlichen Deckengemälde. Wie Kirchenluft wehte es sie an, und die abgeblaßten, transparenten Klatschblumenbouqetts der Seidengardinen hauchten drinnen über Dielen und Wände einen schwach röthlichen Schein. Arme, schöne Dore! In ihrem kurzen Leben angebetet, auf den Händen getragen, hatte sie ihr ertrotztes Glück mit einem frühen Tode gebüßt, und nun sollten der Psyche auch noch bis in alle Ewigkeit die Flügel geknebelt sein, auf daß sie immer wieder angstvoll gegen die zwei engen Wände des düsteren Ganges aufflattern müsse!
Wie durch fernes Nebelgewoge dämmerte in dem jungen Mädchen die Erinnerung an die Weißverschleierte auf. Die mächtigen Reise-Eindrücke, die sie draußen in der Welt empfangen, das hochgesteigerte geistige Leben im Hause des berühmten Onkels hatten diese Episode ihrer Kinderzeit ziemlich in ihrem Gedächtniß verwischt, so zwar, daß sie schließlich selbst oft gemeint, der ganze seltsame Vorfall sei doch wohl auf den Ausbruch ihrer damaligen schweren Nervenkrankheit zurückzuführen. In diesem Augenblicke jedoch, wo sie wieder vor derselben Thür stand, aus welcher „das Huschende“ damals gekommen war, und schräg gegenüber den riesigen Kleiderschrank stehen sah, hinter welchen sie sich versteckt, da gewann der Vorgang wieder schärfere Umrisse, und es war ihr plötzlich, als müsse sie auch jetzt, wie in jenem Moment, das Geklapper der forteilenden kleinen Absätze wieder hören.
Deutsches Frauenlos im Ausland.
Ganz Wien sprach unlängst kurze Zeit hindurch vom menschlichen Elend im Allgemeinen und Studentenelend im Besonderen. Ein ergreifender Fall hatte alle Herzen gerührt. Vor Gericht war ein junger Student erschienen, welchen die Polizeimannschaft in der Nacht auf der Straße halberfroren aufgegriffen hatte. Der junge Mann war heimlich aus seiner ärmlichen Kammer gegangen, weil er seiner Wirthin, einer armen Wittwe, gegen 25 Mark schuldig geworden war, ohne zahlen zu können. Es war ihm nicht gelungen, Beschäftigung in Nachhilfestunden oder dergleichen zu finden und sich so etwas Geld zu verdienen; er hatte fast Alles, was er sein Eigen nannte, selbst seine besseren Kleider, verkauft. Keine Hoffnung bot sich ihm, überall wurde er abgewiesen. Da faßte er in seiner Verzweiflung den Entschluß, sich das Leben zu nehmen, und einige Stationen vor Wien legte er sich auf die Schienen, um sich von einem daherkommenden Eisenbahnzuge überfahren zu lassen. Allein man bemerkte glücklicher Weise sein Vorhaben, und um nicht von dem Bahnwärter festgenommen zu werden, flüchtete er nach Wien zurück. Vor Hunger und Müdigkeit fiel er endlich zusammen und wurde so aufgefunden.
Nun stand er vor Gericht unter der Anklage des Betruges an seiner Wirthin. Doch er wurde freigesprochen, da die wackere Frau in der Zuversicht, von dem ihr als fleißig bekannten jungen Mann früher oder später einmal das Geld zu erhalten, dabei beharrte, nicht beschädigt worden zu sein.
Mit warmen Worten der Theilnahme und des Bedauerns mußte der Richter indessen dem Studenten ankündigen, daß ihm wegen gänzlicher Mittellosigkeit die Abschiebung von Wien nach der Heimath bevorstehe. Als am Tage darauf aber durch die Zeitungen der Bericht über diese Gerichtsverhandlung bekannt wurde, da liefen für den armen Studenten alsbald, theils sogar auf telegraphischem Wege, so zahlreiche Spenden von den verschiedensten Seiten ein, daß der junge Mann auf der Polizei erschien um zu bitten, es möchten keine Gaben mehr für ihn angenommen werden, da er Unterstützung und namentlich Verdienst durch Privatstunden vollauf erhalten habe, um seine Studien fortsetzen zu können, und er sprach den Wunsch aus, daß weitere Spenden anderen Studenten, welche hilfsbedürftiger seien, als er jetzt, zugewendet werden möchten.
Wie seltsam ist es doch um das menschliche Herz bestellt! So warm und erregbar es auch empfinden mag, wird es doch inmitten der Hast des modernen Erwerbs- und Verkehrslebens und bei den Tag für Tag sich häufenden Berichten über Verbrechen, Selbstmorde und andere traurige Ausgänge menschlichen Elends in seinem Mitgefühle abgestumpft und scheinbar theilnahmlos für das Geschick der Unglücklichen. Das ist um so beklagenswerther, als der Kampf ums Dasein härter und schwieriger geworden ist denn je zuvor und den Einzelnen zwingt, möglichst ausschließlich das eigene Schicksal im Auge zu behalten. Was Uhland einst vom Kriege gedichtet:
„Ihn hat es weggerissen,
Er liegt mir vor den Füßen,
Als wärs ein Sttttk von mir.
– – – – – – –
Kann dir die Hand nicht geben“ –
gilt leider in der Gegenwart auch vom Frieden, wenn nicht einmal zufällig der Einzelne aus der Masse „den guten Kameraden“ vor sich liegen sieht und unmittelbar im Angesichte der Noth ihm die Hand reicht. Die das am ehesten können, stehen aber selten an Stellen, wo die Kugeln des Schicksals pfeifen und treffen.
Ein Zufall hat es gefügt, daß im Lichte der Oeffentlichkeit viele tausend Menschen jenen armen braven Studenten haben fallen sehen, daß sie sich beeilten, ihm die Hand zu reichen. Hätte den jungen Mann die Lokomotive erfaßt und getödtet, so hätte man weiter kein Wort gesagt, und nur die Zahl der Selbstmorde wäre um einen Fall vergrößert worden.
Dem armen Studenten ist geholfen worden und mit ihm vielen seiner Leidensgenossen. Es giebt indessen noch andere schicksalsverwandte Kreise, denen Hilfe und Rath nicht minder nöthig sind und – wenn rechtzeitig gebracht – nicht minder wirksam kommen würden. Hierzu gehören in erster Reihe die deutschen Gouvernanten, Erzieherinnen, Gesellschafterinnen etc. im Auslande. Wo da die Noth eintritt, sollte vor Allem geholfen werden, denn dieselbe ist stets mit besonderen Gefahren verbunden, und so organisirt sollte diese Hilfe werden, daß sie zu rechter Zeit und an richtiger Stelle gespendet wird.
Unglück zu ertragen ist hart für einen Mann, härter noch für eine Frau, aber am härtesten für Diejenigen, welche davon [131] in der Fremde, fern von der Heimath, betroffen werden. Da wird oft schon der bloße Mangel an Glück zum trostlosen Mißgeschick, das Unglück aber nicht selten zum sittlichen und geistigen Tod für jene deutschen Mädchen, welche durch ihre Verhältnisse gezwungen werden, sich mit Hilfe ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten im Auslande ihr Brot zu verdienen.
Zahlreiche tüchtige und befähigte deutsche Reichsangehörige finden im Auslande lohnende Beschäftigung. Stockt es damit, so wird der Einzelne bemüht sein, wozu er ja auch in der Heimath genöthigt ist, sich nach einer neuen Stellung umzuschauen. Da muß sich der Mann, mehr oder minder gerüstet und erfahren in den Wechselfällen des Lebens, selbst zu helfen wissen, so gut und so schlecht es eben geht. Aeußersten Falles mag er sich an die deutschen Konsulate und Hilfsvereine wenden, etwa zur Erleichterung der Rückkehr ins Vaterland.
Das genügt dem deutschen Manne, nicht aber auch der deutschen Frau im Auslande, am wenigsten den armen deutschen Mädchen in jüngeren Jahren, welche als Gouvernanten, Erzieherinnen oder Gesellschafterinnen im Auslande stellenlos geworden sind und zeitweise verlassen dastehen.
Man sollte meinen, es sei nicht nöthig, die schwankende gefährliche und bedenkliche Lage dieser Armen mit allen ihren besonderen Anfechtungen zu schildern, dennoch ist es nothwendig, weil es vorerst an jeder organisirten Hilfe dagegen fehlt. Und so mag denn die Wirklichkeit reden, wo die Phantasie schweigt.
Anna B. war ein schönes Mädchen aus Franken, von tüchtiger Schulbildung und musikalischem Talente. Mit Rücksicht auf die dürftige Lage ihrer Mutter hatte sie sich unter Einsendung ihrer Photographie um eine Stelle als Gesellschafterin bemüht und durch ein Wiener Vermittelungs-Bureau so verheißende Zusagen erhalten, daß sie die Reise nach Wien antrat, um dort arg enttäuscht zu werden, denn das Vermittelungs-Bureau erwies sich als ein zweideutiges. Allein Anna hatte Muth und Charakter, blieb allen Verlockungen gegenüber fest und fand endlich eine vortreffliche Stelle als Verkäuferin in einem großen Geschäfte. Hier verliebte sich der Sohn des Hauses so ernstlich in sie, daß dessen Eltern, welche andere Pläne mit ihm hatten, die neue Verkäuferin entließen. Zwar fand sie ein anderes leidliches Unterkommen in ähnlicher Stellung, allein ohne ihr Zuthun verfolgte sie der Sohn jenes ersten Hauses auch dorthin und war auf dem Wege, sich mit seinen Eltern zu entzweien.
Da griffen diese, einflußreich wegen ihres Geldes, wie sie waren, um Anna B. aus Wien zu entfernen, zu folgendem Mittel: Auf Veranlassung dieser Leute wurde Anna B. zunächst aus ihrer neuen Stellung entlassen, sodann der Polizei als unterkunfts- und erwerbslos denuncirt und deßhalb wirklich, auf Grund des sogenannten Schubverfahrens, zur zwangsweisen Abschiebung von Wien verurtheilt. Angesichts der ihr bevorstehenden Schmach, schuldlos inmitten von Vagabunden und Verbrechern nach Deutschland geschickt zu werden, hat sich das schöne, muthige, begabte Mädchen getödtet.
Ist es nicht herzzerreißend, so schuldlos und so jämmerlich in der Fremde zu Grunde gehen zu müssen? Wahrlich, schon um solchen beklagenswerthen Fällen vorzubeugen, allein um dieses armen deutschen Mädchens willen wäre die Errichtung eines allseitig nach außen hin schützenden deutschen Heims für stellenlose und stellensuchende deutsche Erzieherinnen, Lehrerinnen etc. dringend zu fordern.
Doch sehen wir uns noch weiter um!
Bertha D. war die Tochter eines Berliner Großkaufmanns. In glänzenden Verhältnissen aufgewachsen, war sie nicht vorbereitet worden, einen Kampf ums Dasein zu kämpfen, wie er ihr bevorstand, als das alte von findigeren Konkurrenten überflügelte Geschäft ihres Vaters zusammenstürzte. Bertha wollte weit von der Heimath und ihren gewohnten Verhältnissen fort. Zunächst ging sie nach Wien, um eine Stellung zu suchen. Für ein junges, hübsches, alleinstehendes Mädchen ist Wien ein gefährlicher Ort, weit gefährlicher als Paris oder irgend eine andere ausländische Stadt, wo doch schon die fremde Sprache zu größerer Vorsicht mahnt.
Wer das verlockende Leben und Treiben einer Großstadt ein wenig kennt und dazu die Unerfahrenheit und Schwäche eines jungen Mädchens von Berthas Lebensgang in Betracht zieht, wird voraussehen, was da eintreten mußte, als Bertha während ihres Aufenthaltes in Wien zufällig die Bekanntschaft eines gewissenlosen Lebemannes machte. – Allein, ohne Stütze, unter fremden Leuten, anstatt eines wohlwollenden und uneigennützigen einen verführenden falschen Rath, ist Bertha untergegangen in dem Schlamm der äußerlich so schönen Kaiserstadt wie so manche ihrer armen bedauernswerthen Mitschwestern, denen zunächst kein anderer Vorwurf als der allzugroßer Leichtgläubigkeit zu machen ist. – Wir könnten noch eine Menge solcher Beispiele anführen, doch mögen diese wenigen genügen!
Was ist nun in solchen und ähnlichen Fällen, welche weit häufiger vorkommen, als gemeinhin angenommen wird, zu thun, um ihnen nach Möglichkeit vorzubeugen?
Diese Frage ist bereits ebenso zutreffend als glücklich beantwortet worden von den deutschen Gouvernanten und Erzieherinnen in England. Dieselben haben im Jahre 1877 einen Verein gebildet, um sich gegenseitig zu helfen, vor Allem durch die Einrichtung eines eigenen Heims in London in Verbindung mit einem selbständigen uneigennützigen Stellenvermittelungs-Bureau. Für diesen Zweck gingen von den Deutschen in England, besonders aber von den deutschen Fürsten und Städten, so reichliche Spenden ein, daß schon am 1. Juli 1879 in London 16 Wyndham Place das erste deutsche Frauenheim für deutsche Erzieherinnen eröffnet werden konnte.[1]
Was in London so glücklich ausgeführt worden ist, soll nun auch in Wien angestrebt werden. Wie London, so ist Wien ein vielberührter Durchgangspunkt für deutsche Erzieherinnen etc., da über Wien sowohl in Betreff der Reise wie auch der Vermittelung der Weg nach Südrußland, Ungarn, Rumänien, Griechenland und dem Orient führt. So weit von Wien aus über eine kleine Welt zerstreut, können sich die deutschen Mädchen nicht selbst helfen und Vereine organisiren, wie sie es in England gethan, und doch wäre ein fester Rückhalt für dieselben gerade dort ungleich nothwendiger als in England, weil in den genannten Ländern bis in den Orient hinein das alleinstehende Weib überhaupt in Folge der gesellschaftlichen Ueberlieferungen und Anschauungen schutzloser dasteht und sittlichen Gefährdungen leichter und häufiger ausgesetzt ist. Ein junges Mädchen kann eher unangefochten durch ganz England reisen, als z. B. in Bukarest oder Odessa über die Straße gehen. Auch mit dieser noch nicht genügend gewürdigten Thatsache ist zu rechnen.
So ist es denn mit Freuden zu begrüßen, daß der Deutsche Hilfsverein in Wien, welcher unter dem Protektorat des deutschen Botschafters, des Prinzen Heinrich VII. Reuß steht, die Gründung eines „Deutschen Frauenheims in Wien“ in Anregung gebracht hat. In diesem Frauenheim sollen alle Gouvernanten, Erzieherinnen, Bonnen etc. aus Deutschland, welche durch Zufall oder besondere Verhältnisse nach Wien gelangt sind, in den sorgenvollen Tagen der Stellenlosigkeit eine Zufluchtsstätte finden, welche ihnen vorübergehende wohlfeile Unterkunft sichert und zugleich durch ein eigenes kostenfreies Stellenvermittelungs-Bureau unter Leitung der Vorsteherin den Stellenlosen die Aussicht bietet, in achtbaren Familien neues Unterkommen zu finden.
Bereits ist die Organisation des Deutschen Frauenheims in Wien im Einzelnen ausgearbeitet worden. Es fehlt nur noch an den erforderlichen Geldmitteln. Alles in Allem sind zur Einrichtung des Frauenheims vorerst für zehn Personen sowie für den Betrieb desselben zunächst auf drei Jahre etwa 25000 Mark nothwendig, welcher Betrag wesentlich durch freiwillige Gaben aufgebracht werden müßte. Sollte es daran fehlen? Sollte hierfür vergebens an edle Herzen appellirt werden?[2]
Nein, das kann nicht sein, darf nicht sein! Deutsche in unserm schönen und großen Vaterlande, gedenket stets in Freundlichkeit der Landsleute im Auslande, ihrer schwierigen Stellung und Eurer nationalen Pflicht, ihnen das Gefühl der Zusammengehörigkeit und des wirksamen Schutzes der Heimath zu erhalten und zu heben. Namentlich der deutschen Frau im Auslande gegenüber muß dies Bestreben hervortreten, und wo ein Mißgeschick sie gebeugt, da sollte sie Schutz finden, um nicht zu fallen. Diesen zu gewähren, liegt sowohl im Interesse als in den Pflichten der
deutschen Nation.
- ↑ Vergl. Nr. 13, Jahrg. 1882 der „Gartenlaube“.
- ↑ Die Centralsammelstelle für gütige Spenden befindet sich bei dem deutschen Generalkonsul Ritter von Mallmann in Wien, dem Schatzmeister des „Deutschen Hilfsvereins“.
Steirische Eisenhämmer.
Die Vierziger Jahre hatten strenge Winter. Im März aber kam stets plötzlich der Föhn und schmolz den Schnee in wenig Tagen. Wir freuten uns des wieder enthüllten Rasens, der alsbald zu grünen begann; aber damit war die leichtlebige, heitere Wintersrast dahin, und die wachsenden Tage brachten arbeitsschwere Zeit des Pfluges und der Egge, der Sichel und der Sense. Diese Zeit der blinkenden Werkzeuge hatte einst ein kleines Vorspiel.
Noch tief in der Nacht weckte mich an einem Frühlingsmorgen mein Vater und sagte, er gehe heute in das Mürzthal. Wenn ich mitgehen wolle, so möge ich mich eilig zusammenthun, aber die scharfbenagelten Winterschuhe anziehen, es sei der Weg noch eisig.
Sonst, wenn ich in früherer Stunde zur Alltäglichkeit geweckt wurde, bedurfte es allerlei Anstrengungen außer und in mir, bis ich die Augen zur Noth aufbrachte, um sie doch wieder auf etliche Minuten zufallen zu lassen, denn meine alte Ahne war der Meinung, ein allzurasches Aus-dem-Schlaf-springen mache Kopfweh. Heute war ich mit einem Ruck munter, denn ins Mürzthal mitgehen, das war in meiner Kindheit das Herrlichste, was mir passiren konnte. Wir waren bald reisefertig, der Vater nahm seinen großen Stock, ich meinen kleinen; die Laterne nahmen wir nicht, weil es sternhell war – und so gingen wir davon. Die erste halbe Stunde war es wie allemal, wenn ich früh Morgens mit dem Vater ging, wir schwiegen still und beteten während des Gehens jeder für sich das Morgengebet. Wir hatten wohl so ziemlich das gleiche, aber ich wurde immer ein gut Theil früher fertig als er und mußte mich dann still gedulden, bis er den Hut aufsetzte und sich räusperte. Das war das Zeichen, daß ich ein Gespräch beginnen durfte, denn ich war fortwährend voll von Fragen und Phantastereien, auf die der Vater bisweilen derart einging, daß Alles noch räthelhafter und noch phantastischer wurde. Gewöhnlich aber unterrichtete er mich in seiner gütigen und klaren Weise, daß ich Alles wohl verstand.
Nachdem wir an diesem Frühmorgen etwa zwei Stunden gegangen und hinausgekommen waren über die entwaldete Berghöhe, lag vor uns das weite Thal der Mürz. Von Mürzzuschlag bis Kapfenberg dehnte es sich stundenlang, und wenn ich es sonst im Morgengrauen sah, lag im Thale der Nebel wie ein grauer See, aus welchem einzelne Höhen und die jenseitigen Berge blauduftig emporragten. Heute war es anders und heiß erschrak ich vor dem, was ich sah. War denn der Franzose wieder im Land? Oder gar der Türk’? In Kindberg, das tief unter uns lag, lohte an vielen Stellen glührothes Feuer auf. Auch im oberen Thal, über Mitterdorf, bei Krieglach und Feistritz, und gen Mürzzuschlag hin waren rothe Feuersäulen; im nahen Kinthal sprühten mächtige Garben von Funken empor.
„Närrlein, Du kleines!“ sagte mein Vater, als ich mich mit beiden Fäusten krampfhaft an seinen Rock hielt, „das ist ja nichts. Das sind ja nur die Eisenhämmer. Lauter Schmiede-Rauchfänge, aus denen Funken springen. Hörst denn nicht das Pochen und das Klappern der Hämmer?“
„Ich höre es wohl, aber ich habe gedacht, das wären die Kanonen und Kugelstutzen,“ versetzte ich aufathmend.
„Kind, wo käme denn jetzt der Feind her? Der liebe Herrgott hüte unser Steirerland!“
„Aber wie ist es denn,“ fragte ich, „daß die Dächer nicht brennend werden, wenn so viel Feuer herumfliegt?“
„Die Dächer sind voller Staub und Asche, das brennt nicht. Und dieses Feuer, das so schreckbar wild aussieht, es ist nicht so arg, es ist auch nur glühende Asche, Ruß und Geschlack, wie es aus der Esse aussprüht, wenn der Blasebalg dreinbläst.“
„Und warnm sprüht es denn just in der Nacht so?“ fragte ich.
„Es sprüht auch beim Tag so,“ antwortete der Vater lächelnd, „aber gegen das Sonnenlicht kommt dieser Schein nicht auf, und was jetzt so blutroth leuchtet, das ist bei Tag nur der rußige Rauch, der aus dem Schornsteine aufsteigt.“
„Thun sie denn in den Schmieden nicht schlafen?“
„Das wohl, aber sie stehen sehr früh auf, oder lassen in den größeren Essen gar das Feuer nicht ausgehen, weil es sonst schwer ist und viel Kohlen braucht, bis die Hitze wieder erzeugt wird. Da wachen und arbeiten die einen Schmiede, während die anderen schlafen.“
„Giebt's denn so viel Ochsen zu behufen im Mürzthal?“ war meine Frage, denn ich hatte einmal dem Hufschmied zu Haustein zugeschaut, wie er einem Zugochsen Hufeisen an die Klauen nagelte.
„O Knäblein, Knäblein!“ rief mein Vater, „die Schmiede haben noch ein wenig mehr zu thun auf der Welt, als wie zu hufen. Du bist ein Steierer; wenn wir auf unserem Gebirge auch nichts haben, als Feld und Alm und Wald, solltest Du doch schon wissen, wozu die vielen hundert Krippen von Holzkohlen verwendet werden, die unsere Nachbarn Jahr für Jahr ins Thal hinaus führen. Solltest auch wissen, daß Dein Heimathland Steiermark das Land der Hammerschmiede ist. Wenn Du jetzt, bevor der Tag aufgeht, vom hohen Himmel mit sehr guten Augen herabschauen könntest auf unsere Steiermark, so würdest Du, besonders im Oberland, auch alle anderen Thäler so sprühen und leuchten sehen, wie hier das Mürzthal. Es sprüht in Neuberg und bei Mariazell und an der Veitsch, es sprüht im Ennsthal und im Murthal, an der Feistritz, an der Kainach, an der Sulm und an der Sann, wo die Leut’ gar nicht mehr deutsch sprechen, aber sprühen thut’s doch. In Vordernberg, in Eisenerz, in Hiflau sollst es erst sehen, und überall, wo Hochöfen sind. In den Hochöfen wird das Erz, das sie aus dem Gebirg graben, geschmolzen, daß das Eisen herausrinnt wie ein hellglühender Mühlbach. Da sprüht’s auch, mein Bübel! Da sind - wenn ihrer zwei, drei Hochöfen neben einander stehen – in der Nacht schier die Felsberge roth vor lauter Schein. Und schaust in den Ofen, so siehst ein schneeweißes Licht, blendend wie die Sonne. Das ist ein anderes Feuer, als daheim bei unserem Hofschmied. Das Erz graben sie aus dem Erzberg, der weit drinnen im Gebirg steht und mehr werth ist, als alles Gold und Silber in Oesterreich. Das Eisen, das im Hochofen aus dem Erz rinnt, erstarrt in der freien Luft sogleich, wird nachher mit Hämmern zerschlagen und in schweren Schollen durch das ganze Land verführt, zu jedem Eisenhammer hin, wo sie aus diesem Roheisen immer feineres Eisen, das Schmiede-Eisen, den Stahl und daraus allerhand Geräthe und Werkzeuge machen.“
[133]
[134] „Auch Schuhnägel vielleicht?“ fragte ich, weil mich einer davon durch die Schuhsohle in die Ferse stach.
„Schuhnägel, Messer, Stifte und Eisendrähte, das machen sie draußen bei Stadt Steier herum. Bei uns im Land machen sie in den Eisenhämmern Pflugscharen, Eggenzähne, Strohschneidemesser, Hacken, Aexte, Drähte, Nägel, Schlösser, Ketten, Pfannen und Allerlei, was Du aus Eisen an den Häusern und Werkstätten nur sehen und denken magst. Die kleineren Schmiede, die fahren damit auf die Jahrmärkte. Größere Hämmer giebt’s, die auch Zeug zum Leuteumbringen machen – mußt Du wissen. Das Wichtigste aber, was in den steirischen Hammerwerken gemacht und auch weit in fremde Länder verführt wird, sind Sensen und Sicheln. Millionen Stück werden Dir verschickt alle Jahr, und darum können die Hammerherren mit ihren Frauen so vornehm herumfahren mit flinken Rößlein. Und mit dem Geld prahlen sie, daß es nur so prasselt im Land, und wo ein übermüthig Stückel aufgeführt wird, da ist gewiß ein Hammerherr dabei. Ist ja alleweil so gewesen im Land: wo der Hammerschmied, dort gilt der Bauer nit. – Wird auch einmal besser werden, verhoff’ ich. Jetzt müssen wir noch froh sein, daß wir unsere Kohlen zu Geld machen können. Gar zu Gescheite sind gewesen, haben es mit Steinkohlen probirt, die thun’s aber nicht; das rechte Eisen muß mit Holzkohlenfeuer gearbeitet werden, sonst ist’s nichts nutz. Die Holzkohlen, die wir Bauern liefern, die machen es ja, daß steirisch Eisen in der Welt so gut estimirt wird. Kommen halt die polnischen und russischen Juden und türkischen Händler aus Ungarn und Böhmen, werden von den Hammerherren brav bewirthet und kaufen ihnen die Eisenwaaren ab, oft zu tausend Gulden auf einmal. Sollen da draußen in einer großen Stadt die Schmiede von der ganzen Welt einmal zusammengekommen sein um einen eisernen Tisch, und Jeder wollt’ die schärfsten Sensen haben, den feinsten Stahl drinn. Der steirische Schmied hat nicht mitgestritten, sondern soll zuletzt mit seiner Sense den eisernen Tisch mitten aus einander gehauen haben.“
„Wird sie wohl schartig worden sein, die Sense. Nicht?“
Ohne auf diese müßige Frage Antwort zu geben, fuhr der Vater – indem wir im Morgengrauen sachte thalab stiegen – fort zu sprechen:
„Wie die Anzeichen sind, wird’s nicht immer so dauern mit den Eisenhämmern. Man hört allerlei Sachen. Merkwürdige Sachen, mein Bübel, wie sie unsere Vorfahren nicht gehört haben. Da draußen auf dem flachen Land irgendwo – sie sagen im Mährischen oder wo – da bauen sie eine Eisenbahn.“
„Eine Eisenbahn? Was ist das?“
„Da legen sie auf der Straße hin und hin zwei eiserne Leisten, daß darauf die Wagenräder recht glatt und eben gehen können. Auf diese Weise sollen ein Paar Rösser schwere Wagen fünf und sechs auf einmal ziehen können. Es wird auch gelogen über die Sach’, daß sie eine Maschine erfunden hätten, die das Feuer treibt, anstatt der Fuhrmann, und die vor die Wägen gespannt wird und wie ein Roß ziehen kann. Sind dumme Sachen, ich sag’ Dir’s nur, daß Du’s nicht glauben sollst, wenn Du davon hörst.“
Siebenunddreißig Jahr ist es her, seit von einem zwar einfachen, aber vernünftigen Mann diese Worte gesprochen worden sind in Steiermark, wenige Stunden vom Semmering.
„Nein, Vater,“ antwortete ich, „das werde ich gewiß nicht glauben.“
„Aber das ist wahr,“ fuhr er fort, „daß sie jetzt viel mehr Eisen brauchen in der Welt, als vor Zeiten. Es werden da und dort auch schon große Eisenhämmer gebaut, wo mehr als hundert Schmiede beschäftigt sind, und wo sie extra noch mit Wasserdampf arbeiten sollen, was weiß ich, wie! In diesen großen Werken machen sie Alles, und weit wohlfeiler, als in den kleinen, und deßweg wird’s ein rechter Schade sein für unsere Eisenhämmer, und hört man, etliche sollen schon keine Arbeit mehr haben, zugesperrt oder an die großen Werke verkauft werden. Nachher ist’s traurig um uns. Weiß Gott, wie’s noch wird mit der Welt!“[1]
Mittlerweile war es licht geworden, und wo früher die feurigen Springbrunnen aus den Schornsteinen gestiegen waren, da flog jetzt dünner, brauner Rauch auf. Wir waren in das Thal gekommen, gingen an einem überquellenden Hammerbachfloß entlang und auf glattem kohlschwarzen Wege einer der Hämmerhütten zu, aus deren offenem Thor uns greller Gluthschein entgegenleuchtete.
Ueber dem Thore war das Bergmannszeichen, die gekreuzten Hämmer und Schlägel, über dem schwarzen Dache ragten die weißgetünchten Schornsteine auf, die an ihrer Mündung mit lenkbaren Klappen versehen waren, womit man, wie der Vater belehrte, den Luftzug regeln könne.
So waren wir der Schmiede ganz nahe gekommen. Ich sagte nichts, denn ich wollte in die Schmiede gehen und hatte doch Angst vor dem Lärm, der drinnen war, und vor den Funken, die durch die finsteren Räume flogen. Mein Vater sagte auch nichts, sondern führte mich hinein. Vor dem Thore hatte eine Tafel gestanden: „Fremden ist der Eintritt nicht gestattet!“ aber ein Mann, den mein Vater fragend angeblickt, sagte: „Nur zu!“
Was ich zuerst sah, das war ein sprühendes Stück Sonne, das von der brüllenden Esse mit Schwung herbeigebracht wurde und auf den Amboß geworfen, tonlos, als wäre es von Teig. Jetzt hob sich auf massigem Hebelbaume der Hammer und fiel nieder in die weiche Masse, daß ein Meer von Funken durch die Hütte schoß. Ich barg mich vor Schreck und Angst hinter den Rücken meines Vaters, aber die Funken waren bereits angeflogen an mein Leiblein, und ich war nur höchlich überrascht, daß ich nicht lichterloh brannte, ja nicht einmal einen Schmerz wahrnahm an den Händen, an welche die feurigen Mücken gesaust waren. Auch der zweite und dritte Hammerschlag jagte ein Heer von Schlacken und Funken hinaus, aber je platter das Eisenstück geschlagen wurde, je rascher der Hammer darauf niederfiel, desto weniger sprühte es. Ein Schmied stand da, der wandte mit langer Zange das Eisenstück hin und her, bis das Geschlacke von allen Seiten herausgehämmert war. Das weiße Glühen war immer rother und matter geworden, und endlich hatte das Stück nur mehr die graue Farbe des Eisens. Es wurde hingeschleudert, der Hammer stand still.
Ich war ein wenig dreister geworden und besah mir jetzt die Dinge, obwohl es ganz dunkel war, wenn das Feuer nicht leuchtete. Vor Allem fiel mir ein großer Lederkasten auf, der Athem schöpfte. Der Blasebalg war’s, welcher, von Wasserkraft aufgezogen, durch Röhren in die Essen blies. Auf der Erde lag allerlei altes Eisen umher. An den Wänden lehnten und hingen in ganzen Reihen Zangen, Hämmer, Schlägel, Feilen, Hacken, Beile und anderlei, was ich gar nicht kannte. Jetzt erst fielen mir auch die Schmiede auf, über deren rußige Gesichter und entblößte Brust die Schweißtropfen rannen. Wir gingen weiter und kamen zu anderen Essen, wo die Schmiede mit Eisenschaufeln Kohleu in die Gluth warfen, die sofort mit glanzloser, blauer Flamme grollend zu brennen begannen. In einer Esse glühte man Eisenstücke, die hernach unter kleinere, rascher pochende Hämmer kamen. Hier wurden sie – wie sie der Schmied wendete und drehte – in längliche Formen gehämmert, an denen ich nach und nach die Gestalt der Sense erkannte. Weil das Eisen bald kühlte und noch unrein war, so mußte es immer wieder in die Esse, aus der es glühend und sprühend hervorkam. So wiederholte sich’s, bis der Hammer und das kleine Handgehämmer der Schmiede endlich eine vollkommene Sense zuwege gebracht hatte, die dann schrillend auf einen Haufen von Sensen hinfiel.
War der Lärm in der Schmiede auf einen Augenblick verstummt, so hörte man von draußen das Rauschen des Wassers, das von hohem Floß auf die Räder niederstürzte. Aber der Lärm ging immer von Neuem los, und es geschah an den Essen und Hämmern immer dasselbe. Auch meine Sense, die ich werden sah, war lange noch nicht fertig. Sie wurde neuerdings geglüht [135] und kam unter die Handhämmer der Schmiede, die sie feiner formend in gleichem Takte bearbeiteten, bis der Henkel und der Rückenrand und die Schneide und die Spitze fertig waren. Sie hatte nun eine Reihe von kleinen Narben bis zur Spitze hinaus und war überlaufen mit einem schönen violetten Blau.
Mir fielen aber die Schmiede auf. Warum sie allemal noch einen leeren Schlag auf den Amboß machen, wenn die Sense schon weggezogen ist? so fragte ich. Mein Vater antwortete: „Das thun die Schmiede überall; mit dem Schlage auf den Amboß schmieden sie die Kette fester, mit welcher der höllische Drach’ gefesselt ist; sonst thät’ sie endlich brechen und der böse Feind wär’ los und ledig.“
Nun kam die Sense noch auf einen Schleifstein; der ging so scharf, daß die Stahlschneide, die fest auf ihn gedrückt lag, unter ohrenzerreißendem Geschrille beständig einen hellen Blitzschein von sich gab, was noch das Allerschönste war in der ganzen Schmiede.
Wollte ich’s genau nehmen, so müßte ich auch das Personal aufzählen, durch dessen Hände ein Stück Eisen geht, bis es Sense ist, ich müßte den Kohlenbuben, Strecker, Breitenheizer, Abschinner und Kramrichter nennen und vor Allem den Obersten, den Essemeister. Ich müßte auch den Streckhammer, den Breithammer und den Kleinhammer genauer beschreiben, endlich das Abschinnern (Abschaben) der fertigen Sense, und das Stempeln mit dem Firmazeichen und das Kramrichten (das in den Kram-, ins Magazin- Bringen der Waare).
Ich bin aber kein gelernter Schmiedegeselle und werde wohl manche Handgriffe und Vorgänge übersehen haben, bis das Werkzeug des Mähders fertig war. – Aehnlich, sagte mein Vater, würden auch die Sicheln gemacht, aber ganz anders die Messer und alle Schneidewerkzeuge, die einen federigen Stahl haben.
„Glückauf!“ rief mein Vater den Schmieden zu. Diese hörten nichts. Wir gingen – stets angefochten von sprühenden Funken – ins Freie. Dort war es freilich noch schöner; wir gingen unter Pappeln hin und hörten noch lange das dumpfe Hammerpochen und das Wasserrauschen hinter uns.
Ich hatte ein blauschimmerndes Stück Schlacke mit mir genommen und betrachtete es jetzt wie einen errungenen Schatz.
„Das ist nichts,“ sagte mein Vater und zog ein Schöllchen Roheisen aus dem Sacke. Das war rostfarbig und durchlöchert wie ein Schweizerkäse. „Wenn’s auch nicht so glänzt wie das Deinige, es ist doch mehr. Aus diesem Ding – heb’ einmal, wie schwer es ist! – kann man feine Werkzeuge machen, die wie Spiegel funkeln. Du sollst mir auch noch das Tüchtige vom Schimmernden unterscheiden lernen.“
Nun gingen wir in den Marktflecken Kindberg hinein. Auch hier hörten wir an allen Ecken die Hämmer pochen, und auf der Straße fuhren schwarze Kohlen- und Roheisenwagen, aber auch fertige Eisenwaaren in Kisten, Fässern und Strohgewinden sahen wir schleppen die weiße Reichsstraße entlang gegen Graz und gegen Wien.
Im Brauhause bekränzten sie das bogenförmige Einfahrtsthor mit Tannenreisig und schmückten es mit Fahnen, mit Hämmern, Hacken und Zangen. Mein Vater fragte, was das bedeute? Ja, morgen hätten die Schmiede hier einen Ball, sagte der Brauknecht.
„Den eigentlichen Ehrentag des Schmiedehandwerks, den feierten sie doch erst zu Jakobi!“ meinte mein Vater.
Das sei schon richtig – doch zur selben Zeit sei etwas Anderes, da hätten die Schmiede einen zwei Wochen langen Feiertag, da thäten sie nichts, als gut essen und trinken, tanzen und Scheibenschießen, und da kämen die Hammerherren von weit und breit, um Schmiede zu werben für das nächste Jahr. Die Geworbenen kriegen den Leihkauf auf die Hand und werden zum nächsten Sylvester durch aufgeputzte Wagen oder Boten an ihren neuen Werksort gebracht. Vom Werksherrn kriegen sie nebst dem vereinbarten Jahrlohne auch die Kost; der Essemeister speist gar mit der Herrschaft.
„Ich weiß das Alles,“ versetzte mein Vater dem gesprächigen Brauknecht, „aber meines Buben wegen ist’s mir lieb, daß Du’s erzählst, der ist schon alt genug, und wenn er gleich Bauer bleiben wird, so schadet es ihm nicht, daß er auch anderer Stände Arbeit und Brauch kennen lernt. Ich hab’ ihn darum vom Berge herabgeführt.“
„Und bei solchem Schmiedefeste,“ erzählte der Mann weiter, „da kommen sie halt zusammen, Jeder, der’s hat, im Steirergewand, Jeder eine kecke Feder oder Gemsbart am Hute, Jeder eine schwersilberne Uhrkette mit Thalerbehängseln an der Brust, Jeder eine volle Geldtasche im Sacke, Jeder sein Mädel am Arme. Schmetternde und trommelnde Spielleute voran, so ziehen sie ins Wirthshaus zum Trunk, zum Tanz und zu anderer Lustbarkeit. Da darf sich kein Bürgerssohn, kein Bauernbursch, kein Holzknecht blicken lassen, er würde zur Thür hinausgeworfen; denn diese Eindringlinge werden bald frech, spotten die Schmiede ob ihrer Schwerhörigkeit, ob ihrer Kröpfe und dergleichen und ihr Trachten geht dahin, den Hammerschmieden die Dirndlein wegzunehmen. Da kann mit Messern gerauft werden! Den Schmieden gehört der Tag, und der Marktflecken und die Leute lassen sich’s gefallen – es springt Geld um.
„So kohlrabenschwarz sie am Werktag sind, die Schmiede,“ schloß der Brauknecht, „am Sonntag giebt’s keine hochmüthigeren Menschen als diese Rußteufel. Und sind doch so viel Gaggen (Halbkretins) dabei!“
Schon jetzt, als wir dastanden und das geschmückte Hausthor bewunderten, kamen sie herbei von den unteren und oberen Hämmern, um nachzusehen, wie weit die Vorbereitungen gediehen seien, und ein Glas Bier durch die Gurgel zu sprengen.
Da kam plötzlich ein Bote gelaufen, rußig im Gesicht, aber weiß vor Straßenstaub an den Beinen. Einen Sturmhut hatte er auf, wie Landwehrmänner zu Kriegszeiten. Ein langes Messer hatte er an der Seite baumeln, und schier athemlos war er, als er rief. „Kameraden! Kameraden!“
„Was giebt’s?“ fragten sie ihm entgegen.
„Keinen Schmiedball giebt’s! Kein Flaniren und Karessiren giebt’s! Jetzt heißt’s Messer, Spieß und Säbel schmieden, Kanonen, Kugeln gießen!“
„Ja,“ sagten sie, „wer giebt uns dazu das Privileg?“
„Ich!“ rief der Bote. „Denn der Kaiser Ferdinand ist fort. In Wien ist Revolution!“
Der bunte Zelter.
von Wilhelm Hertz.
Dereinst im Land Champagne lebte
Ein Ritter, der nach Ehren strebte,
Von hohem Sinn und kühnem Muth,
Am Herzen reich, doch arm an Gut.
Hätt’ ihm das Glück solch Gut bescheert,
Als er fürwahr an innrem Werth
Vor allen andern war erlesen,
Wär’ seinesgleichen nicht gewesen.
Herr Wilhelm hieß der junge Held.
So freudig pries ihn alle Welt,
Daß auch, wer ihn nicht selber kannte,
Gern den berühmten Namen nannte.
Barg er im Helm sein Angesicht
Beim Waffenspiel, so dacht er nicht,
Zur Schau der Damen sich zu schmücken
Und heimlich aus dem Kampf zu drücken:
Nein, wo am stärksten das Gedränge,
Stürzt er mit Wucht sich in die Menge.
Er trug im Herzen treu gesinnt
Ein schönes junges Herrscherkind,
Von hoher Art und viel umworben,
Die Mutter war ihr früh gestorben;
Ihr Vater, reich an Land und Macht,
Hielt eifersüchtig sie bewacht
Als seines Stammes letzten Sproß.
Im tiefen Walde lag sein Schloß,
Der damals weithin sich erstreckte
Und schattend rings das Land bedeckte,
Wild war der Tann und schwarz und dicht,
Doch treue Liebe schied er nicht.
Der junge Held fand guten Rath:
Er brach zu ihr sich einen Pfad
Von seinem Haus zwei Meilen weit
Durch tiefste Waldeseinsamkeit.
Kein lebend Wesen in der Runde
Erhielt von diesem Schleichweg Kunde
Als nur sein einziger Genoß:
Das war sein schönes edles Roß,
Ein Zelter schillernd bunt und fein;
Kein Farbenspiel, kein Blumenschein
War seinem Glanze zu vergleichen,
Kein schönres war in allen Reichen.
Es ging so sanft; er hätt’s im Leben
Um alles Gold nicht hingegeben.
Gar oftmals trug dies treue Roß
Ihn heimlich nach der Liebsten Schloß,
Die er doch nur von weitem sah.
Sie kamen nie einander nah;
Stets waren vor des Thores Bogen
Die Eingangsbrücken aufgezogen;
Ein Graben lief um’s Felsenhaus.
Nur durch die Blanken des Verhaus
Besprach das Paar sich scheu von fern
In Aengsten vor dem alten Herrn.
Denn der war klug und vielerfahren,
Und da ein Weg bei seinen Jahren
Ihm schwer ward, ritt er selten aus
Und hielt sich ruhig meist zu Haus.
Die Tochter mußte bei ihm bleiben,
Um ihm die Stunden zu vertreiben,
Indeß ihr Sinn in’s Weite ging
Und trauernd am Geliebten hing.
So brannten in der Sehnsucht Leid
Die jungen Herzen lange Zeit
Im ungeduldigen Verlangen
Nach Kuß und zärtlichem Umfangen.
Der Ritter dachte hin und her;
Doch endlich litt er’s nimmermehr:
Er kam zum alten Herrn geritten,
Um seine Tochter ihn zu bitten.
Mit Ehren ward er aufgenommen.
Herr, hub er an, ich bin gekommen
Vertrauend Eurer Gnad’ und Huld.
Hört meine Bitte mit Geduld,
Und was mein Herz von Euch begehrt,
Gott gebe, daß Ihr mir’s gewährt! –
Der Alte sah ihn forschend an
Und sprach: Gern thu ich’s, wenn ich kann.
Fürwahr, vergönnt’s die Ehre mir,
Ich helf’ Euch! Sagt, was wünschet Ihr? –
So hört mich, Herr! Euch sind mein Stand
Und meine Ahnen wohlbekannt
Und was ich habe, was ich treibe:
Gebt Eure Tochter mir zum Weibe!
Ich hörte stets, daß, wer sie kennt,
Sie nur mit Lob und Liebe nennt.
Schenkt mir dies Glück! Laßt Euch erweichen!
Auf Erden lebt nicht ihresgleichen. –
Der Greis vernahm’s zum Wort bereit;
Er sann nicht lang auf den Bescheid:
Ich weiß zu würd’gen, was Ihr sprecht.
Ja, meine Tochter, Ihr habt Recht,
Sie ist so jung und schön und gut,
Ein magdlich Kind von Fürstenblut.
Ich selbst bin reich, von hohen Ahnen,
Die stolz mich alter Ehren mahnen,
Und weithin ist mein Adel kund,
Mein Land trägt jährlich tausend Pfund.
Ich müßte doch von Sinnen sein,
Wollt’ ich sie einem Ritter frein,
Der zum Turnier nach Beute fährt
Und sich vom Lanzenbrechen nährt.
Ich hab’ nur sie; nach meinem Sterben
Wird sie, was mein ist, alles erben.
Kein Fürst im Reich braucht sich zu schämen,
Will er mein Kind zur Gattin nehmen. –
Der junge Ritter stand befangen;
Er schied mit schamerglühten Wangen.
Verwirrt ritt er davon und stahl
Zur Liebsten sich voll Seelenqual
Und bracht’ ihr klagend den Bescheid:
Ach, edles Fräulein, süße Maid,
Was soll ich thun? Ich muß Euch fliehn
Und will in weite Ferne ziehn.
Verlorner Wahn, wie warst du hold!
Weh über das verhaßte Gold,
Das Eures Vaters Herz bethört!
Sonst hätt’ er mich gewiß erhört. –
Glaubt, sprach sie, gings nach meinem Sinn,
Wie gerne gäb’ ich alles hin!
Fürwahr, den besten Theil vergißt,
Wer Euch nur nach der Habe mißt.
Wollt’ Euren Heldenwerth dagegen
Mein Vater auf die Wage legen,
Er schaute froh, was er gewinnt,
Doch Stolz des Reichthums macht ihn blind.
Mein Sehnen stört ihm nie den Schlummer;
Was fragt er je nach meinem Kummer?
Ein altes Herz versteht nicht mehr
Der Jugend Sinnen und Begehr.
Doch laßt Euch rathen! Hört mich an!
Ich weiß, was uns noch helfen kann. –
Ja, sprach er, sagt mir Euren willen! –
Ich sann darüber längst im Stillen:
Euch lebt ein Oheim groß und reich,
An Macht wohl meinem Vater gleich.
Er hat nicht Weib, er hat nicht Kind,
Noch Sippen, die ihm lieber sind
Als Ihr, der nächste seines Blutes.
Ihr seid der Erbe seines Gutes.
Geht hin und sagt ihm, was geschehn,
Und bittet ihn, Euch beizustehn,
Da schwerlich Euer Wunsch gedeihe,
Wenn er nicht seine Hilfe leihe.
Die beiden Alten schätzen sich Als Ehrenmänner inniglich, Vertraun einander als Berather. Sagt Euer Ohm zu meinem Vater: „Vereinen wir das junge Paar! Ich geb’ dem Neffen jedes Jahr Von meinem Land dreihundert Pfund“, So willigt er in unsern Bund. Und ist besiegelt unser Glück, So gebt dem Ohm sein Gut zurück. Reich wär’ ich, wenn mir nichts verbliebe Als Ihr allein und Eure Liebe. – Er folgte freudig ihrem Rath Und ritt auf grünem waldespfad Zum Oheim, der ihn wohl empfing Und mit ihm fern von Zeugen ging. Hoch überm Thor auf dem Altan Besprachen sie des Ritters Plan. Der Alte stimmte willig ein: Du kannst um keine Bessre frein, Mit Freuden biet ich meine Hand, Bei meinem Haupt! ich brings zustand. – Ach, sprach er, liebster Ohm, das thut! Führt meine Sache rasch und gut! Ich fahre jetzt in voller Zier Nach Gallardon auf ein Turnier. Gott geb’, daß ich in Siegesehre Zu meiner Hochzeit heimwärtskehre! – In Eile schied er wie verzückt, Von neuer Hoffnung hochbeglückt: Er sah so nah sein holdes Ziel. So sprengt er froh zum Waffenspiel.
Jedoch der Ohm, dem er vertraut, Der war in Lug und Trug ergraut, In erster Früh’ am andern Tag Ritt schon der Falsche durch den Hag Und kehrte noch bei Morgenschein Am Hof des reichen Nachbars ein. Zum Willkomm lief der alte Degen Erfreut dem werthen Gast entgegen Und führt ihn festlich in sein Haus. Gerüstet ward ein großer Schmaus. Sie saßen lang im hohen Saal Und sprachen heiter nach dem Mahl Von ihrer Jugendzeit und nannten Die alten Freunde und Bekannten. Sie tauschten manche lustge Mähr, Drin klang’s von Schwert und Schild und Speer, Bis endlich nun der Ghm begann: Ich häng’ Euch recht in Treuen an, Das wisset Ihr seit langen Tagen. So laßt Euch eine Bitte sagen, Darum ich hergekommen bin! Gott stimme günstig Euren Sinn! – Der andre rief: was Ihr begehrt, Sprecht nur! Es ist Euch schon gewährt. Gern zahl’ ich alter Liebe Schuld. – Herr, sprach der Oheim, Dank und Huld Bewahr’ ich, wie’s mir stets gebührt. So hört denn, was mich hergeführt! Um Eure Tochter möcht’ ich frein, Und willigt Ihr in Freundschaft ein, So wird ihr alles, was ich habe, Von mir verbrieft als Morgengabe. Ihr wißt, mein Gut ist reich und groß, Ich bin allein und erbelos. Wir Freunde lebten dann im Frieden, An [Haus] und Habe ungeschieden.
Seht, Herr, drum werde sie die meine, Daß sich in ihrer Hand vereine, Was Gott uns beiden hat bescheert. – Herr, wie mich das beglückt und ehrt! Sprach freudestrahlend sein Genoß, Ich nähme drum kein Königsschloß. Fürwahr, wie könnte mir auf Erden Ein solch erwünschter Eidam werden, So zuverlässig, reif an Jahren, So ehrenfest und vielerfahren, Ein Mann so ganz nach meinem Sinn? Mein Kind ist Euer: nehmt es hin! –
Doch als das Fräulein dies erfuhr, Erschrak sie jammernd und beschwur Die heil’ge Jungfrau, sie zu retten Vor dieser Ehe schnöden Ketten. O weh mir! rief sie thränenbleich, Mich mordet dieser Schelmenstreich! Wie hat der Alte uns gelogen Und den geliebten Mann betrogen, Den edlen Ritter tugendvoll! Die Goldgier macht den Alten toll. Erwirbt er mich, geb’ Gott ihm Leid! Sein Todfeind bleib’ ich allezeit. Nein, nein! Den Tag erleb’ ich nicht! Wo berg’ ich nur mein Angesicht? Doch wehe mir, ich kann’s nicht wenden! Hier lieg’ ich mit gebundnen Händen. Wehrlos gefangen muß ich still Erdulden, was mein Vater will. O Schmach dem Alter, Schmach dem Gold, Drum ich mein Lieb verlieren sollt’! –
Indessen schmückte man das Haus Mit Kranz und Teppich festlich aus. An alle greisen Herrn im Land Ward Gruß und Ladung ausgesandt. Wohl ihrer dreißig kamen an, Worauf ein weis Gespräch begann, Und man beschloß im Rath der Alten, Am nächsten Tag das Fest zu halten, Und gab den Zofen das Gebot, Ihr Fräulein noch vor Morgenroth Beim Brautschmuck fertig zu bedienen; Sie hörten’s mit bestürzten Mienen. Der Vater strengen Angesichts Rief: Sind wir fertig? Fehlt uns nichts? – Herr, sprach der Mädchen eines, doch! An guten Zeltern fehlt es noch, Daß insgesammt wir mit ihr reiten Und nach der Kirche sie geleiten. – Der Alte sprach: Die Noth ist klein. An Pferden soll kein Mangel sein. Er rief die Knappen: Lauft zur Stunde Und sagt den Nachbarn in der Runde, Die Frauen seien unberitten, Wir lassen sie um Zelter bitten. –
Der junge Ritter mittlerweile War heimgekehrt in Liebeseile. Er schied vom Kampfplatz sieggekrönt, Von Lob und Freudenruf umtönt Und blühend Hoffnungsglück im Herzen. Er war voll Muthwill und voll Scherzen, Mit lustgem Trällern wandert er Im Hause ruhelos umher. Stets mußt’ ein Fiedler um ihn sein, Der strich ihm neue Melodein. Und so erharrt er Stund’ um Stunde Von seinem Oheim frohe Kunde.
Zum Thore blickt er fort und fort, Und wirklich, sieh, wer naht sich dort? Ein Bote kommt! Vor Schreck und Lust Erbebt das Herz ihm in der Brust. Herr, sprach der Knappe, Gruß und Heil! Mich schickt mein alter Herr in Eil’ Mit einer großen Bitte her. Ihr wißt, er schätzt und liebt Euch sehr. Ihr habt das schönste Roß im Reich, Kein andres trägt so sanft und weich. Herr, habt die Güte denn und leiht Den Zelter uns auf kurze Zeit! – Wozu, Freund? – Daß er früh am Tage Zur Kirche unser Fräulein trage. – Was geht dort vor? Gieb mir Bericht! – Herr, sprach der Knappe, wißt Ihr’s nicht? Dort wird sie Eurem Ohm vermählt, Der sie zur Gattin sich erwählt. –
Vor Schreck begann der Herr zu wanken, Ein Schwindel lähmt ihm die Gedanken: Es ist nicht möglich, sag’ ich Dir! Du treibst nur Deinen Scherz mit mir! – Gewiß nicht, Herr! Ihr dürft mir traun, Ihr könnt’s mit eignen Augen schaun, Versammelt sind von nah und fern Zum Brautgeleit die alten Herrn. – So gab’s seit Kains Mörderthat Nie einen schnöderen Verrath! – Er stand betäubt von Zorn und Leid In dumpfem Brüten lang beiseit. Ach, sprach der unglückselge Mann, Sie selbst hat keine Schuld daran, Sie nicht! Ich muß den Wunsch gewähren Als letzten Dienst für all die Ehren, Die sie mir bot, für all die Wonnen, Die nun auf immerdar zerronnen! Doch wie? Durch den ich sie verlor, Dem soll ich armer blinder Thor Mein edles Roß zum Feste leihn, Zur Lustbarkeit ihm dienstlich sein? Wie kann sich nur der Mann erfrechen, Um solchen Dienst mich anzusprechen? Hat er nicht alles mir geraubt, Woran mein arglos Herz geglaubt, Ach, all die Schönheit, Huld und Güte, Die mir in meinem Lieb erblühte? Doch muß ich allem auch entsagen, Es sei: mein Zelter soll sie tragen, Daß, wenn sie seine Zügel lenkt, Sie nochmals innig mein gedenkt. Ich liebte sie zu meinem Leid Und will sie lieben allezeit! – Er ließ sofort den Zelter zäumen; Der Knecht entführt ihn ohne Säumen.
Herr Wilhelm bleibt allein zurück Und denkt auf sein verlornes Glück, In bittrem Grimm und Herzensjammer Vergräbt er sich in seine Kammer, Und seinen Dienern insgemein Schärft er bei Tod und Leben ein, Daß keiner ihn zu stören wage, Dann überließ er sich der Klage.
Der Knappe mit dem edlen Roß Kam abends spät in’s Hochzeitschloß, Wo all die greisen Ritter saßen, Ein reichlich Mahl mit Freuden aßen. Der Burgherr scherzte mit der Schaar, Der heut in bester Laune war.
[138]Dann ließ er sein Gebot erschallen
Dem Thürmer und den Knechten allen:
Merkt auf und sagt’s von Mund zu Munde!
Vor Sonnenaufgang eine Stunde
Soll alles wach sein und bereit.
Drum sorget, daß zur rechten Zeit
Ein jeder flink das seine thue! –
Drauf legten alle sich zur Ruhe.
Die junge Braut nur lag in Thränen
Und wacht’ in hoffnungslosem Sehnen;
Sie weinte still und seufzte tief,
Indessen ringsum alles schlief.
Der Wächter selbst beschwert vom Wein
Nickt auf dem Thurm ermattet ein.
Da schreckt ihn auf um Mitternacht
Des nahen Mondes helle Pracht,
Die ostwärts überm Wald erglommen.
Er meint, schon will der Morgen kommen.
Zeit ist’s, denkt er in jähem Schrecken,
Die große Ritterschaft zu wecken.
Laut stößt ins Horn der trunkne Mann:
Steht auf, ihr Herrn! Der Tag bricht an! –
Das Dröhnen des Allarmhorns traf
Die Zecher all im ersten Schlaf;
Sie starrten gähnend in die Helle.
Die Knechte schlichen in die Ställe,
Und unter Lärmen und Geschrei
Zog Roß und Zelter man herbei,
Bis endlich die gesammte Schaar
Der alten Herrn im Sattel war.
Dem ältsten ward die bleiche Braut
Zu Dienst und Obhut anvertraut.
Der Armen führte man am Thor
Des Freundes bunten Zelter vor;
Da deckt sie mit dem Schleier sich
Und schluchzt und weinet bitterlich.
Die Alten brummen in den Bart:
So war von je der Weiber Art.
Wenn sie des Vaters Haus verlassen,
Weiß keine sich vor Schmerz zu fassen. –
So brach man auf noch lang vor Tag.
Ihr Ziel, ein altes Kirchlein, lag
Fern an des großen Waldes Saum.
Der Weg bot nur zwei Rossen Raum,
Drum ordnet sachte sich die Schaar.
In langem Zuge Paar um Paar
Rottirten sich die vielen Reiter,
Zuletzt die Braut und ihr Begleiter.
Der alte Herr, der wenig sprach,
Ließ sie voraus und folgte nach,
Daß in des finstern Weges Enge
Sein Roß nicht an das ihre dränge.
So ging es durch die Wälder fort,
Man hörte kaum ein lautes Wort,
Das Rascheln nur im dürren Laub,
Der Thiere Stampfen und Geschnaub.
Die meisten nickten schlummertrunken,
Vorn auf des Pferdes Hals gesunken,
Und wer im Sattel aufrecht saß,
Der sann für sich auf dies und das,
Im Kopf umnebelt und verwacht,
Und niemand nahm des Fräuleins Acht.
Ihr Ritter war ein gutes Stück
Des Weges hinter ihr zurück,
Da oft sein Rößlein stehen blieb,
Bis er’s im Schlafe weiter trieb.
Sie selbst blickt achtlos vor sich hin,
Nur Lieb und Liebesleid im Sinn.
So ritt sie durch die Einsamkeit
Allein, nur Gott war ihr Geleit,
Bis tief sich in ein schattig Thal
Die Straße senkte, wo kein Strahl
Des Mondes durch das Dickicht drang.
Sie ließ dem Zelter freien Gang,
Und unvermerkt bog dort mit ihr
In jenen Pfad das treue Thier,
Den es in hoffnungsreichen Tagen
So manchmal seinen Herrn getragen.
Sie schwand im Wald. Der Troß der Reiter
Ritt auf der großen Straße weiter.
Doch endlich sah das Fräulein um:
Rings nächtge Wildniß öd und stumm;
Sie war verlassen und verirrt,
Sie bebt vor Schreck und Graus verwirrt,
Schon will sie rufen angstbeklommen,
Doch wehe, nein! was soll’s ihr frommen?
Viel besser wahrlich, hier zu sterben,
Und in der Wüste zu verderben!
Sie ließ dem klugen Roß die Zügel;
Das trug sie weit durch Thal und Hügel
Mit sanftem Schritt ohn’ Aufenthalt,
Und langsam lichtet sich der Wald.
Da kreuzt ein Gießbach ihren Weg,
Dumpfbrausend, tief und ohne Steg;
Das Roß ging ruhig längs dem Rand,
Bis es die Furt, die seichte, fand.
Und sicher klomm es aus der Schluft.
Ein Horn klang durch die Dämmerluft.
Sie kam ins freie Feld hinaus
Und sah vor sich ein festes Haus.
Dort auf der Zinne blies ein Mann
Den Tag mit hellen Weisen an.
Der treue Zelter ritt in Ruh
Dem wohlbekannten Thore zu,
Und auf der Brücke scharrt sein Huf.
Der Wächter stockt im Morgenruf
Und spähte lauschend hin und wieder.
Von seiner Warte stieg er nieder
Und rief durch’s Fensterlein am Thor:
Wer ritt hier auf die Brücke vor? –
Sie spricht, und ihre Thränen wallen:
Die Unglückseligste von Allen,
Die je geschaut des Lebens Licht!
Wohin ich soll, ich weiß es nicht.
Ich bin verirrt. Erbarm dich mein!
Nur bis es Tag ist, laß mich ein! –
Das darf ich nicht, bei meinem Haupt!
Bevor es mir mein Herr erlaubt.
Der liegt vergrämt in herbem Grimm;
Denn man betrog ihn allzu schlimm. –
Ob ihrer Schönheit staunt der Mann
Und stieg zu seinem Herrn hinan;
Der lag in stetem Kummer wach.
Verzeiht, Herr, rief er ins Gemach,
Vor unsrem Thor im Morgengrau
Hält eine tiefbetrübte Frau,
Von Jahren jung und fein von Sitten.
Sie kam dort aus dem Wald geritten.
Ihr Mantel glänzt in prächtgem Scheine,
Der ist von Scharlach, wie ich meine.
Und denkt doch, Herr, ich sah’s genau:
Auf Eurem Zelter sitzt die Frau.
Wie reizend ist sie, wenn sie spricht!
Glaubt, Herr, solch lieblich Angesicht
Hab’ ich im Lande nie gesehn.
Mich dünkt, ’s ist eine von den Feen,
Sie schickt Euch Gott zum Trost im Leid,
Weil Ihr so gar verlassen seid. –
Herr Wilhelm sprang in Hast empor,
Warf um den Rock und lief zum Thor.
Das ihm der Thürmer flink erschloß;
Da hielt sein Lieb auf seinem Roß.
Sie sprach: O Herr, laßt Euch erbitten!
So viel hab’ ich heut Nacht erlitten.
Vergönnet mir ein Obdach hier!
Ich bin verfolgt; man sucht nach mir. –
Er trat ins Licht; sie sahn sich an,
Und all ihr Herzeleid zerrann.
Er hob vom Roß die holde Maid
Und küßte sie voll Seligkeit.
Er hielt sie bei der Hand gefaßt,
Führt in sein Haus den lieben Gast,
Wo sie verzückt beisammen saßen
Und alle Welt um sich vergaßen.
Sie kosten, lachten inniglich;
Sie staunten und bekreuzten sich,
Ob mit solch unverhofftem Glücke
Sie nicht ein Traumgesicht berücke,
Und wenn es just kein Lauscher sah.
So drangen sie sich zärtlich nah,
Umfingen eng sich Mund an Mund
Und küßten sich von Herzensgrund.
Doch in des Morgens goldner Helle
Führt er sein Lieb in die Kapelle.
Der Burgkaplan war schon berufen;
Er stand auf des Altares Stufen
Und schlang um sie von Hand zu Hand
Ein unauflöslich heilges Band.
Und als die Messe war gesungen,
Kam das Gesind zum Tanz gesprungen,
Die Mägde mit den Mannen all,
Das Haus erdröhnt von Freudenschall.
Indessen machten fern am Wald
Die alten Herrn beim Kirchlein Halt.
Sie harrten lang und riefen laut:
Da sind wir nun! Wo bleibt die Braut? –
Ihr Ritter sprach: Ist sie nicht hier?
Sie ritt die ganze Zeit vor mir.
Der Wald war dicht, der Weg war schmal:
Ich schlief, und wacht’ ich auch einmal,
So dacht’ ich, sie wird vorne sein,
Und schlief beruhigt wieder ein.
Sonst hab’ ich weiter nichts vernommen
Mich wundert, wo sie hingekommen. –
Da stand bestürzt der ganze Haufen.
Das war ein Rufen und ein Laufen;
Man forschte hier; man fragte dort:
Doch ach, umsonst! Die Braut war fort.
Ihr alter Vater klagte sehr,
Ihr alter Bräutigam noch mehr.
Sie quälten sich in Angst und Reue;
Und suchten ruhlos stets auf’s Neue.
Da plötzlich kam, den Zaum verhängt,
Ein Knappe grüßend angesprengt:
Herr Wilhelm, der mich ausgesandt,
Reicht, Herr, als Eidam Euch die Hand.
Heut Morgen, als der Tag ergraut,
Ward Euer Kind ihm angetraut.
Das Paar umjubelt Sang und Reihn;
Kommt selber, Herr, und stimmt mit ein!
Auch seinen Oheim läßt er laden.
In seines reichen Glückes Gnaden,
Verzeiht, vergißt er seine Schuld
Und sendet Allen Gruß und Huld. –
Die Alten stehn mit offnem Munde
Bei dieser wundersamen Kunde.
Nachdem genugsam sie gestaunt,
Ward viel geredet und geraunt:
Nicht ändern könnt ihr, was geschehn,
Mögt ihr auch noch so sauer sehn.
Je nun, ihr seid doch aus den Sorgen:
Das Kind ist heil und wohl geborgen.
Zwar ging es nicht nach unsrem Sinn;
Doch nehmt’s als Gottes Fügung hin!
Drum faßt euch klug und geht als Gäste
Zu eurer Erben Hochzeitfeste!
Beschlossen ward’s. Mit Mann und Roß
Kam angerückt der ganze Troß,
Und grüßend trat den alten Degen
Das junge Paar versöhnt entgegen.
Tragbare ekektrische Lampen. Der französische Elektriker Trouvé, dem wir bereits eine Reihe hübscher elektrischer Neuheiten, darunter die elektrischen Schmucksachen, verdanken, hat der Pariser Akademie der Wissenschaften soeben zwei tragbare elektrische Lampen vorgelegt, deren eine überall dort Anwendung finden soll, wo ein offenes Feuer zu Explosionen
Anlaß geben könnte, während die andere die stets gefährlichen Petroleum- und sonstigen Laternen zu ersetzen bestimmt ist. Als Elektricitätsquelle dienen hier, wie bei den anderen Trouvé’schen Apparaten, sogenannte doppeltchromsaure Tauchbatterien, die zu wirken beginnen, sobald die Kohle in die Flüssigkeit getaucht wird. Dies geschieht bei der ersten Lampe, und zwar selbstthätig, sobald der Bergmann oder Gasarbeiter, der z. B. nach einer undichten Stelle in einer Gasleitung sucht, die Lampe an seinem Gürtel befestigt, um beide Hände frei zu bekommen. Die hier abgebildete zweite Lampe brennt hingegen, sobald man sie am Henkel (F) hochhebt, und erlischt augenblicklich, wenn man sie irgendwo hinstellt. Zur größeren Sicherheit ist die Lampe selbst mit einem Drahtgeflechte umgeben, während die in der Abbildung sichtbaren Stäbe das Umfallen des Batteriebehälters (D) verhüten. Der am Deckel angebrachte Knopf (H) dient zur Erhöhung oder Verringerung der Leuchtkraft, indem er ein mehr oder minder tiefes Eintauchen der Kohle in die Flüssigkeit der Batterie bewirkt. Die Leuchtkraft der normalen tragbaren Trouvé’schen Lampe beträgt vier bis fünf Kerzen, und zwar drei Stunden lang, oder eine Kerze fünfzehn Stunden lang. Selbstverständlich sind auch kräftigere Lampen erhältlich. G. van Muyden.
Streit um den Fahrweg. (Mit Illustration S. 125.) Wer hat den Fahrweg freizugeben, der Schwache oder der Starke, der Kleine oder der Große? Die Frage ist heikel, nicht so leicht zu entscheiden, wie man auf den ersten Blick annehmen möchte, und Milchfrau und Postillion unseres Bildes sind offenbar auch nicht einig darüber. Kampfbereit stehen sie sich da im dunkeln Morgen auf der verschneiten Landstraße gegenüber, und das zartere Geschlecht scheint hier nicht das mildere zugleich zu sein. Die geschwungene Peitsche, der zornige Zuruf ihres Gegners schreckt sie wenig. Rechts wird ausgebogen! Das ist das Recht der Landstraße! Den ganzen Weg freigeben? Fällt mir nicht ein! Fliege ich mit meiner Milch in den Straßengraben bei dem Schnee, so verhungern alle die kleinen Stadtkinder, denen ich die tägliche Nahrung bringe. Also – – Und so ’n Hundeschlitten will der Post, der kaiserlichen Post nicht die ganze Straße freigeben? Das wäre! Aber resolut genug sieht das Weib aus, stürzt sie in den Graben, muß ich für den Schaden aufkommen – Himmel Sapperment! — — Hinüber und herüber geht’s, heftig entbrennt der Streit. Wird die Gewalt siegen oder das Recht? Wer weiß es — vielleicht liegen in der nächsten Viertelstunde beide Kampfhähne im Straßengraben — und der Fahrweg in der Mitte ist auf einmal frei. Dann hat der Streit ein Ende. –r.
Bettlerin an der Via Appia. (Mit Illustration S. 129.) Es ist ein trübes Geheimniß, ein Weh, das nicht so leicht in Worte zu kleiden ist, eine tief in Schleier gehüllte Trauer, was die Seele dieses Mädchens bewegt, dämmernd und hoffnungslos wie die verödete Landschaft, in der sich dies Zusammenbrechen eines unglücklichen, verwaisten Herzens abspielt. So wenig der Künstler uns die mächtigen Silhouetten der vom letzten Tageslichte erhellten Trümmerreste der altrömischen Leichenstraße deutlich erkennen läßt, so wenig läßt sich jedes Detail dieses Schicksals mit Zuverlässigkeit ablesen. Wir sehen auch hier nur die Umrisse und einige Abtönungen, – und gerade dies völlige Harmoniren des dargestellten Menschenloses mit dem Charakter der Scenerie ist ein besonders wirksamer Zug des Max’schen Gemäldes.
Ueber die Eigenart dieser Scenerie sei uns eine kurze Notiz gestattet. Im Alterthum war die Strecke zwischen Rom und dem Albanergebirg ein prangender Garten, mit Villen und Lusthäusern aller Art übersät; auf der Via Appia wogte und rollte es von Fuhrwerken jeder Art; überall die blühendste Vollkraft, das lebendigste Leben. Nur die Grabmäler, die nach römischer Sitte vor den Wohnungen angebracht waren, erinnerten an Tod und Vergänglichkeit. Jetzt hat allenthalben der Tod das Leben verschlungen. Grau und einförmig liegt die sanft gewellte Ebene vor dem Beschauer, nur durch die bröckelnden Trümmer zu beiden Seiten der Straße und die Bogenreihen der altrömischen Wasserleitung in ihrer starren Monotonie unterbrochen. Kein Baum belebt diese Landschaft, keine noch so dürftige Blume. Nur spärliches Gras bietet den Ziegen der Campagnolen eine armselige Nahrung. Fern aber in den bräunlichen Dünsten, die über diesem welthistorischen Kirchhofe brodeln, lauert das hohläugige Gespenst der Malaria, das blutvergiftende Fieber.
Es ist dem Künstler gelungen, diese Stimmung der Via Appia treulich wiederzugeben: einmal in der todten Natur und dann in der schmerzlich bewegten Mädchengestalt, die am Wege sitzt. Der kaum noch erkennbare Wagen, der da im Hintergründe davonrollt, als könne er dem Bereich dieser Trostlosigkeit nicht eilig genug entrinnen – trägt er vielleicht eine letzte Hoffnung, ein hohes, unerreichbares Glück der Vergessenen für alle Zeiten hinweg? Und ist sie erst jetzt im vollen Sinne des Wortes, was sie von Kindheit gewesen, ohne es recht zu begreifen: eine hilflose Bettlerin?
Die Ausspinnung dieses Gedankens überlassen wir der Einbildungskraft unserer Leser.
Der bunte Zelter. Nach Hüon dem Spielmannskönig von Wilhelm Hertz. Das Gedicht, welches wir unter dem vorstehenden Titel den Lesern der „Gartenlaube“ vorführen (S. 136 bis 139), gehört in die Klasse der altfranzösischen sogenannten „Fabliaux“, deren Blüthe in das 13. Jahrhundert fällt. Es waren dies Novellen in Versen, welche sich in der wirklichen Welt abspielten und der Mehrzahl nach sehr derbe Gegenstände behandelten. Zu den feinsten und anmuthigsten dieser Gattung gehört „Der bunte Zelter“, welchen uns W. Hertz in meisterhafter Uebertragung vermittelt.
Der Titel „Spielmannskönig“ taucht bereits im 12. Jahrhundert auf, doch ist es da noch ungewiß, ob er ein bloßer Ehrentitel, oder ob eine Autorität über andere „Spielleute“ mit ihm verbunden war. Im 13. Jahrhundert ist das Letztere der Fall. Die Spielleute organisirten sich während desselben wie die übrigen Gewerbe zu Zünften, deren Vorstände den Titel „Spielmannskönig“ (le roy des menestrels oder einfach le roy) führten. Ein solcher scheint der Dichter Huon le roy gewesen zu sein, von dessen Schicksalen wir übrigens nichts weiter wissen, als daß er im 13. Jahrhundert gelebt hat. – Sechs Jahrhunderte also sind verflossen, seit dieser Spielmannskönig die Liebesgeschichte vom „bunten Zelter“ dichtete, welche heute noch mit dem allen echten Dichterwerken eigenen Zauber unvergänglicher Jugend jeden für Poesie empfänglichen Leser anmuthet.
Ein merkwürdiger artesischer Brunnen ist in der Stadt Selma (Alabama) vorhanden. Er entsendet zwei Ströme Wasser, deren jeder seine besonderen Eigenschaften besitzt. Dieses Wunder ist dadurch bewirkt, daß man in eine 10 Centimeter weite Röhre eine von 5 Centimeter einführte. Die erstere geht etwa 110 Meter tief und fördert ein Wasser zu Tage, das keine mineralischen Bestandtheile aufweist und ziemlich kalt ist; die engere Innenröhre ist bis zu etwa 200 Meter niedergesenkt und liefert ein Wasser, das viel Schwefel und Eisen enthält und ziemlich warm ist. N.
Von Marlitt’s Roman „Die Frau mit den Karfunkelsteinen“ erscheinen gegenwärtig bereits nicht weniger als fünf Ausgaben in fremden Sprachen: eine schwedische bei A. Bonnier in Stockholm, eine dänische bei G. E. C. Gad in Kopenhagen, eine ungarische bei Aladár Székely in Budapest, eine französische bei Firmin Didot u. Comp. in Paris und eine italienische bei E. E. Oblieght in Rom. Weitere Uebertragungen stehen bevor. Auch dieser neueste Marlitt’sche Roman scheint also seinen Lauf durch die ganze civilisirte Welt nehmen zu wollen.
Auflösung des magischen Tableaus „Das geflügelte Rad“ in Nr. 7: Folgt man dem Laufe eines jeden der beiden vom Rade ausgehenden Blitzstrahlen in der Art, daß man oben beim Rad angefangen den an jeder Biegung des Blitzes durch die Senkrechte markirten Buchstaben abliest, wobei zuerst der Blitz links und dann rechts durchgenommen wird, so erhält man durch Zusammenstellen der so gefundenen Buchstaben die Worte: „Die Zeit eilt, die Zeit heilt“. S. Atanas.
F. H. in G. Wie die Verfasserin der „Brausejahre“, so sind auch wir einer gerechten sachlichen Kritik jederzeit zugänglich. Herr Rechtsanwalt Robert Keil in Weimar, unser früherer langjähriger Mitarbeiter, hat das Maß einer solchen aus für uns leicht erkennbaren Gründen weit überschritten. Wir glauben, er hat durch seinen rücksichtslosen, von bedenklicher Ideenverwirrung und Selbstüberschätzung zeugenden Angriff auf das jüngste Werk einer allgemein beliebten und auch von der Kritik längst anerkannten Dichterin weder dieser, noch der „Gartenlaube“, sondern lediglich sich selbst geschadet. Wir halten es unter unserer Würde, auf die an den Haaren in seine Kritik hineingezogene, abfällige Beurtheilung der „Gartenlaube“ zu antworten, und dürfen uns eine Erwiderung um so eher ersparen, als wir aus zahlreichen uns zugehenden warmen Anerkennungen die beruhigende Ueberzeugung schöpfen dürfen, daß unsere Bestrebungen da, wo wir Werth darauf legen, auch richtig gewürdigt werden.
J. G. L. in S. Herr Rober Keil in Weimar steht zu der Familie des Begründers der „Gartenlaube“ in keinerlei verwandtschaftlicher Beziehung.
Inhalt: Die Frau mit den Karfunkelsteinen. Roman von E. Marlitt (Fortsetzung). S. 125. – Deutsches Frauenlos im Ausland. Zur Gründung eines deutschen Frauenheims in Wien. Von Paul Dehn. S. 130. – Steirische Eisenhämmer. Eine Erinnerung von P. K. Rosegger. S. 132. Mit Illustrationen S. 132, 133 und 135. – Der bunte Zelter. Nach Hüon dem Spielmannskönig. Von Wilhelm Hertz. S. 136. Mit Illustrationen S. 136–139. – Blätter und Blüthen: Tragbare elektrische Lampen. Von G. van Muyden. Mit Abbildung. S. 140. – Streit um den Fahrweg. S. 140. Mit Illustration S. 125. – Bettlerin an der Via Appia. S. 140. Mit Illustration S. 129. – Der bunte Zelter. – Ein merkwürdiger artesischer Brunnen. – Marlitt’s Roman „Die Frau mit den Karfunkelsteinen“. – Allerlei Kurzweil: Der redende Parkettboden. – Auflösung des magischen Tableaus „Das geflügelte Rad“ in Nr. 7. – Kleiner Briefkasten. S. 140.
- ↑ Die Aenderung ist vor sich gegangen, aber die steirische Eisenindustrie steht in größerer Blüthe als je. Die größten Eisenwerke des Landes sind heute Zeltweg, Donawitz, Neuberg, Graz, Köflach, Gußwerk. Mittlere Werke, wovon eines doch immerhin mehrere hundert Arbeiter beschäftigt oder beschäftigen kann, sind Krieglach, Wartberg, Kapfenberg, St. Michel, Rottenmann, Aumühl, Eibiswald, Storee, denen sich anschließen die Werke in Turrach, Judenburg, Murau, Zeiring, Knittelfeld, Thörl, Mürzzuschlag,
Breitenau, Stanz, Eppenstein etc. Außerdem floriren auch noch unzählige kleine Eisenhämmer, wie sie hier beschrieben sind. Der Kammerbezirk in Obersteiermark vermag unter den heutigen Zuständen jährlich an 2 Millionen Meter-Centner Roheisen zu erzeugen, nahezu 50% des in den gesammten österreichischen Kronländern jährlich erzeugten Roheisens. Die Sichelfabrikation hat in Obersteiermark aufgehört, hingegen ist die Sensenerzeugung gestiegen. Gegenwärtig giebt es in Steiermark an 800 Sensenschmiede, welche jährlich gegen 2½ Millionen Sensen verfertigen. Die Produktion von anderen Stahlwaaren, Gußwaaren, Blechen, Drähten und Maschinen steht auf hoher Stufe. Der Verfasser.