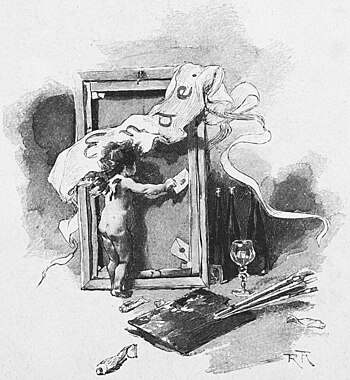Das Bild des alten Malers
Das Bild des alten Malers.
Es freut mich, daß auch Ihnen dieses Bild besonders gefällt,“ sagte der alte Justizrat Landmann. „Es ist ein schönes und gesundes Werk und nebenbei so eine Art Familienstück.“ Dabei lachte er leise und geheimnisvoll in sich hinein.
Wir saßen zu Zweien in dem kleinen Gemach neben dem Eßzimmer seiner Villa, in jener behaglichen und mitteilsamen Stimmung, die der würzige Geruch von echtem Kaffee und Havannarauch nach einem guten Mahle zu erwecken pflegt. Draußen vom Rheine klang das Stampfen und Rauschen eines Salondampfers herein, das Verdeck war dicht besetzt, und man konnte in der klaren Augustluft die einzelnen Gruppen und Gestalten scharf unterscheiden: junge Pärchen auf der Hochzeitsreise, die sich gegenseitig auf jedes alte Haus in der Front des Rheinstädtchens aufmerksam machten und dabei einander so dankbar in die Augen schauten, als hätten sie sich soeben fürstlich beschenkt, reisende Engländer, die ernsthaft in ihren roten Büchern die Geschichte der Burgruinen auf dem jenseitigen Ufer nachlasen, ohne die Burgen selbst eines Blickes zu würdigen, und alle die anderen ständigen Personen dieses lustigen Sommerschauspiels.
Der alte Herr beachtete sie nicht. Er hatte sich mit dem Rücken gegen das Balkonfenster gekehrt und betrachtete nachdenklich sein Lieblingsbild. Es war offenbar Porträt: eine junge Frau von kräftigen, fast üppig zu nennenden Formen, in einfacher ländlicher Tracht. Die linke Hand stützte sie auf ein Weinfäßchen, den vollen rechten Arm streckte sie aus weitem, halb zurückgleitendem Aermel aus, als wollte sie dem Beschauer den Römer kredenzen, den sie zierlich zwischen den rundlich schlanken Fingern hielt. Das Gesicht fast ganz von vorn – ein unendlich fröhliches Gesicht mit lachenden Augen, lachenden Wangengrübchen und lachendem Munde, der die schönsten Zähne sehen ließ. Von den dichten rotblonden Haarflechten hatte sich eine gelöst und rieselte wie ein Goldbächlein über die breite Schulter nach vorn auf das dunkle Kleid. Die Behandlung von Licht und Schatten wie die ganze frische kerngesunde Art des ziemlich in Lebensgröße gehaltenen Bildes erinnerte durchaus an Meister Rembrandt.
„Ja, es ist ein vortreffliches Bild,“ wiederholte der alte Herr. „Vortrefflich auch darin, daß die Nachahmung vollkommen ehrlich bleibt. Du lieber Gott, ich kenne ja einige sogenannte Bilderfreunde, denen man ohne sonderliche Mühe das Ding als einen Rembrandt oder einen anderen berühmten Holländer aufbinden könnte. Aber der Maler hat gar nicht an solche Schlechtigkeiten gedacht. Er hat sich einfach von einer geistesverwandten Vorliebe für den alten Meister den Pinsel führen lassen – und freilich auch von einer andern Liebe. … Für mich aber hat das Bild noch eine ganz eigene Bedeutung – und weil’s Ihnen so gefällt, so sollen Sie zur Belohnung für Ihren guten Geschmack die ganze Geschichte hören. Es dauert doch noch ein Stündchen, bis Ihr Dampfer kommt …“
Und der Alte erzählte:
„Es ist jetzt etwa zehn Jahre, daß ich das Bild besitze. Ich hatte kurz zuvor den Staatsdienst quittiert und war hierher gezogen; mein Töchterlein, damals ein Mädel von siebzehn Jahren, war noch zu Koblenz in strenger und heilsamer Hut des Instituts, allwöchentlich kam sie ’mal herüber. Drunten im Städtchen hauste zu jener Zeit ein kleiner Weinhändler, ein listiger alter Patron mit roter Nase und mächtiger Glatze. Persönlich machte der Kerl gerade nicht den besten Eindruck – wir alten Juristen haben in Fragen der Reellität eine feine Nase – aber seinen Stammgästen
[885] schenkte er in dem alten verräucherten Stübchen einen guten Tropfen, und auch ich kehrte öfters dort ein. Da er alsbald meine Liebhaberei für Bilder kannte, so verriet er mir eines Tages mit seinem pfiffigsten Gesicht, daß er ein schönes Stück habe, um mäßigen Preis wolle er es mir lassen. Na, was er mir über den Erwerb des Bildes sagte – er behauptete, ein armer und selbstverständlich durstiger Maler habe es ihm zur Deckung seiner Trinkschulden gegeben – sehr Vertrauenswert klang das nicht, aber das Bild gefiel mir sogleich sehr, bei dem Weinzapf wäre es ja doch verkümmert, und – kurz, ich kaufte es ihm für ein paar hundert Mark ab.„Sie wollen sich wohl für das Geld noch einige Zeitungen mehr anschaffen?“ fragte ich ihn; denn der Kerl hatte eine ganz merkwürdige Leidenschaft für allerlei Zeitungen, meist Lokalblätter aus ganz entlegenen Gegenden, die hier keinen Menschen interessieren konnten; er selbst studierte sie aber mit großem Eifer und abonnierte auf neue noch immer dazu. Als dann freilich später herauskam, weshalb er dieses sonderbare Preßstudium betrieb, da war es mit ihm aus, und er mußte schleunigst einen Luftwechsel vornehmen, um nicht dem Gericht oder gar einer Art Lynchjustiz seiner Weinbauenden und weinhandelnden Mitbürger zu verfallen. Der Bursche hatte nämlich jahrelang eine ganz eigenartige Gaunerei betrieben; er verkaufte Wein an Verstorbene. Wenn er in einem von seinen ostpreußischen oder pommerschen Lokalblättern die breitgeränderte Todesanzeige irgend eines Honoratioren fand, der anscheinend zahlungsfähige Erben hinterlassen hatte, so sandte er alsbald an die bisherige irdische Adresse des Seligen ein Faß miserablen Krätzers ab, den er auf irgend eine wohlklingende Marke taufte, mit Faktura „laut Ihrer werten Bestellung vom so und so vielten“, sagen wir acht Tage vor dem Todestag. Kam dann der Wein dort an, mitten in die Verwirrung der Trauer und Nachlaßordnung, so gab es gemeiniglich eine große Rührung: „Ach seht ’mal, den Wein hat Vater noch erst neulich bestellt, damit wollte er sich noch laben und uns eine Freude machen – den wollen wir in Ehren halten und verwahren, der soll auf den Tisch kommen, wenn dereinst auch einmal ein fröhlicher Anlaß die Familie wieder vereint,“ und so weiter. Die Rechnung wurde in den meisten Fällen quittiert, unser Gauner strich vergnügt seinen Raub ein, und nach Jahr und Tag wunderten sich die Leute da oben über den schlechten Geschmack ihres Verstorbenen, oder machten sich Vorwürfe, daß sie den edlen Wein nicht richtig behandelt hätten. Endlich ereilte den Kerl aber doch die Vergeltung, da er den Mißgriff that, auf eine ganz besonders große und Wohlstand verratende Todesanzeige hin ein gehöriges Faß Wein an die Adresse eines ostfriesischen Pastors zu schicken, der mit seiner Familie strenger Mäßigkeitsvereinler und obendrein seit zwei Jahren gelähmt gewesen war, mithin weder Weinbestellungen noch sonst etwas schreiben konnte. Die Verwandten witterten eine grausame Verhöhnung ihres enthaltsamen Vaters, sie ließen Ermittlungen anstellen, und so kam die Geschichte denn nach und nach heraus, worauf der Verbrecher schleunigst ins Ausland verschwand.
Solches geschah im Spätherbst, kurz nach der Weinlese und etwa ein halbes Jahr, nachdem ich das Bild erworben hatte. Mit besonderer Genugthuung betrachtete ich es nun, in dem Bewußtsein, es gerade noch zur rechten Zeit aus unwürdigen Händen befreit zu haben. Ich hatte es um der Beleuchtung willen, und weil ich es doch nicht drüben unter die echten Alten in meinem sogenannten Galeriezimmer einreihen wollte, hier aufhängen lassen, etwas höher, als es jetzt hängt, und mehr nach der Ecke dort, wo nun das geschnitzte Schränkchen steht. Meiner Tochter gefiel die rothaarige Weinschenkin ganz besonders. Allemal, wenn sie mich besuchte, war auch ihr Gang alsbald nach dem Bilde, und es war ordentlich, als wenn von dem lustigen gemalten Mädel ein voller Strahl des Frohsinns in ihr eigensinniges Braunköpfchen hinüberflöge, so heiter und liebevoll war sie gegen mich, wenn sie erst mit ihrem geliebten Bilde einsame Zwiesprach gepflogen hatte.
Es schien aber, daß dieser moderne „Rembrandt“ auch noch andere Leute förmlich bezauberte. Da lebte damals drunten im Städtchen ein junger Mann aus Berlin, ein Schriftsteller, der sich angeblich um der stillen und nervenstärkenden Luft willen in unser kleines Weinnest zurückgezogen hatte. Eines Tages – ich hatte ihn nur erst flüchtig kennengelernt – stellte er sich bei mir vor und bat, ihm das Bild zu zeigen. Er musterte es lange und aufmerksam, schien ganz ergriffen, that auch etliche tiefsinnige Bemerkungen über Rembrandt, Helldunkel und dergleichen, die unverkennbar nach einem frischen Studiengang in irgend einem Leitfaden der Kunstgeschichte schmeckten, und schließlich bat er um Erlaubnis, das Bild dann und wann in aller Stille, und wenn er mich nicht störe, wieder betrachten zu dürfen. Er möchte es als Motiv in einem Roman verwenden und sei überzeugt, daß er des häufigeren Anblicks bedürfe, um die Stimmung jedesmal wieder richtigzustellen [886] und festzuhalten. Na, von diesen Dingen verstand ich ja nun nichts, jedenfalls soll man einem Künstler nie die Möglichkeit versagen, in Stimmung zu geraten, und so kam er seitdem wieder, durchschnittlich alle Wochen einmal, ließ sich still in dies Zimmer geleiten und beschäftigte sich eine Weile damit, einsam und ungestört sich von der Weinschenkin zurechtstimmen zu lassen. Zuletzt fing er sogar an, eine kleine Kohlenskizze nach dem Bilde zu zeichnen, ein höchst trauriges Machwerk, das aber erschrecklich viel Zeit in Anspruch nahm und eigentlich nie fertig wurde.
Selbstverständlich sorgte ich dafür, daß meine Tochter bei ihren Besuchen nie mit dem Stimmungsjäger, der sich äußerlich als ein sehr netter gewandter Mensch darstellte, zusammenkam. Man kann nicht vorsichtig genug mit den jungen Leuten sein, zumal wenn sie schon in der Begeisterung für ein und denselben Gegenstand zusammentreffen. Gar zu leicht kommt es dann zu einer Verwechslung, sie glauben noch immer ihren gemeinsamen Liebling anzuschwärmen und schwärmen anstatt dessen einander an. Uebrigens mochte der junge Mann etwas von meinen Befürchtungen nach dieser Seite gemerkt haben oder litt er an einer gewissen Schüchternheit während seiner Stimmungsjägerei, jedenfalls war er taktvoll genug, auch seinerseits eine Begegnung mit meiner Tochter vor dem Bilde möglichst zu vermeiden. Ueberhaupt machte er einen ganz gebildeten Eindruck, und wie ich gelegentlich von einem Freund aus Berlin erfuhr, besaß er dort in litterarischen Kreisen bereits einen guten Ruf.
Nun, es mochten so etwa vier Wochen seit der Flucht jenes schuftigen Weingauners verflossen sein, an einem ziemlich klaren Novembermorgen – ich erwartete just an dem Tage mein Töchterchen – da meldete sich bei mir ein halbwüchsiges Wäschermädchen aus dem Städtchen drunten mit einer schönen Empfehlung vom Herrn Maler Franz Hahn und ob ich ihm nicht die große Güte erweisen wolle, ihn einmal aufzusuchen; er selber habe leider das Podagra und könne nicht gut gehen.
Ich hatte von diesem Maler Franz Hahn schon hin und wieder gehört. Als junger Mann war er vor einigen vierzig Jahren in das Städtchen gekommen, hatte sich dort in ein hübsches Mädchen aus geringem Stande vergafft, sich mit ihr verheiratet und war schließlich zu einem jener verkommenen Genies herabgesunken, die Porträts von Fleischern und Bauernmädchen für einen Thaler und eine Flasche Wein malen oder Ladenschilder, Wirtsstuben und Scheunengiebel mit stilvollen Pinseleien ausschmücken. In Romanen und Novellen machen sich diese Leute ganz gut, in Wirklichkeit sind sie meist ein Greuel für jeden ruhigen und fleißigen Mann und zum mindesten ein betrübendes Schauspiel, da ihnen wie anderen verkommenen Menschen auf die Dauer auch das abgeht, was verkommene Häuser noch erträglich machen kann – nämlich das Malerische.
In dieser Hinsicht machte allerdings Franz Hahn eine Ausnahme. Als ich ihn ein paar Stunden später in dem ärmlichen Stübchen aufsuchte, welches er bei der Mutter seiner Botin bewohnte, war ich fast wider Willen angenehm berührt von dem gescheiten freundlichen Gesichte des Alten, aus welchem mich unter einer hochgewölbten Stirn ein Paar offenblickender kluger Maleraugen fast schalkhaft anlugte. Allerdings leuchtete unter diesen Augen eine Stumpfnase von einer ganz unerlaubten Röte, und ich gewahrte einige leere Flaschen auf dem unordentlich vollgekramten Tische, welche jedenfalls etwas anderes enthalten hatten als Mineralwasser oder kalten Kaffee. Uebrigens war der Alte fleißig gewesen; bei meinem Eintritt bedeckte er mit dem Tuche ein Bild, an welchem er, vor einer höchst baufälligen Staffelei mühsam sitzend und das dick umwickelte Bein weit ausgestreckt, malte.
Nachdem ich mir aus einer Ecke des Zimmerchens, welches eine wahre Blüte der Unaufgeräumtheit vorstellte, einen wackligen Stuhl herbeigeholt, der unter anderem auch als Waschtisch gedient zu haben schien, klagte mir Franz Hahn nach vielen Entschuldigungen sein Leid. Er habe sich an mich gewandt, weil er gehört habe, daß ich von Haus aus Jurist sei und ein Herz für Bilder, folglich vielleicht auch wohl für Maler habe. Vor sieben Monaten etwa sei jener Weinwirt zu ihm gekommen und habe ihn mit großer Härte an eine Zechschuld gemahnt, die allerdings schon seit Jahr und Tag fällig war. Schließlich habe ihn der Mann vor die Wahl gestellt, entweder gerichtliche Klage und Pfändung zu gewärtigen oder ihm gutwillig als Pfand ein Bild zu überlassen, welches er noch in jungen Jahren gemalt und als Andenken behalten habe. Es sei das Bildnis seiner Frau gewesen, so wie sie ihn zuerst an jenem Tage, wo ihn das Schicksal in dieses Städtchen geführt, als Kellnerin unter der Thür eines Wirtshauses begrüßte. Er habe es nach ihrem frühen Tode gemalt, unter vielen Entbehrungen und Schmerzen, und seitdem immer in Händen behalten, als eine teuere Erinnerung und zugleich, wie er meine, als sein bestes Bild. Da er nun aber gewärtigen mußte, durch gerichtliche Pfändung wegen Trinkschulden doch das Bild und zugleich auch die Aussicht auf die Unterstützung, welche ihm etwelche fromme und weichherzige Leute bisher dann und wann zukommen ließen, zu verlieren, so habe er es dem Gläubiger gelassen, nachdem dieser versprochen, das Faustpfand in Ehren zu halten und nicht zu veräußern. Er selbst habe dann versucht, durch Sparsamkeit und allerlei Handwerksarbcit die Summe – es waren etwa hundert Mark – zusammenzukargen, und zur Hälfte habe er sie auch schon zurückgelegt gehabt, als ihn leider das böse Podagra wieder befallen habe. Inzwischen sei nun jener schlechte Mann geflohen, dessen Verwandte wollten nie etwas von dem Bilde gehört haben und hätten ihn grob abgewiesen, und nun quäle ihn Tag und Nacht die Sorge um sein Bild, das letzte Andenken an seine kurze glückliche Ehe und an eine bessere Künstlerzeit. Ob ich ihm da nicht mit Ratschlägen und Nachforschungen helfen wolle?
Es war mir nicht zweifelhaft, daß es sich um das Bild dort handle, welches jener Wirt also einfach durch eine seiner Gaunereien an sich gebracht hatte, um ein paar hundert Mark an mir zu verdienen, und ich muß sagen, daß es mir eine rechte Freude war, den Alten über den Verbleib seines Werkes aufzuklären und [887] ihm dessen Rückgabe zu versprechen. Ganz unbeschreiblich aber war die Rührung, mit welcher mir der Alte dankte. Die hellen Thränen flossen ihm aus den Augen, als ich das Bild der Wahrheit gemäß lobte.
Nun bat ich ihn, mir aber auch seine neueste Schilderei zu zeigen. Nur zögernd willfahrte er; es sei eine Art Porträtskizze, die er vor langen langen Jahren in Koblenz gemacht habe. Da er immer ein gutes und rasches Gedächtnis für schöne und bezeichnende Gesichter besessen, so sei es seine Gewohnheit gewesen, die Züge solcher Personen, die ihm öfters begegneten und ihn durch Schönheit oder Charakter fesselten, zu Hause aus dem Kopfe leicht zu skizzieren. So habe sich eine ganze Mappe einzelner Blätter angesammelt und erhalten, von denen er nunmehr einige auszuführen gedenke, so gut es gehe, in der Hoffnung, vielleicht von einem Kunsthändler ein Paar Thaler dafür zu bekommen. Wie erstaunte ich aber, als der Alte das Tuch entfernte und vor mir, fast ganz ausgeführt, in sauberster Arbeit und mit packender Wahrheit, das Porträt einer jungen schönen Dame stand, die ich selbst gekannt und zwar sehr wohl gekannt hatte; denn sie war ja nachmals meine geliebte Frau und die Mutter meines einzigen Kindes geworden! Nachdem ich meine Rührung einigermaßen bemeistert, durchmusterte ich die übrigen Skizzen – alles gute Bekannte, werte Freunde und auch einige gleichfalls sehr werte Feinde aus jener fröhlichen Jugendzeit! So manches liebe Gesicht längst Verstorbener, dem ich niemals hätte hoffen dürfen, wieder zu begegnen! Und der Mann, der diese meisterhaften Skizzen entworfen, ein echter Künstler von Gottes Gnaden, war hier in diesem Neste hängen geblieben, verkommen und verschollen, und saß jetzt hier neben mir als ein unzünftiger Anstreicher außer Dienst!
Ehe ich die stattliche Reihe der Skizzen – sie hängen jetzt ausgeführt drunten in dem runden Zimmer, und Sie haben sie nicht erst heute bewundert – zu Ende gesehen, war mein Plan gefaßt. Dem Alten trug ich ein hübsches Zimmer in meinem Hause, Unterhalt und – was ich für einen wichtigen Punkt in seinen Augen hielt – Freitrunk auf Lebenszeit an, dafür erbat ich mir von ihm als Deposit und späteres Erbteil die Bilder. Wir waren rasch handelseinig und ich verabschiedete mich von dem alten Künstler mit dem Versprechen, ihn noch selbigen Tages in meinem Wagen holen zu lassen.
Nach Tisch fuhr ich zum Bahnhof, um meine Tochter zu erwarten. Ich war so erfüllt von meinem Plane, daß ich ihr alsbald nach der Begrüßung davon erzählte. Sie teilte aufs herzlichste meine Freude und bestand darauf, daß wir sogleich auf dem Rückwege vor der Wohnung des Malers vorführen und ihn mitnähmen. Als ich ihr dort das Bildnis ihrer Mutter zeigte, begrüßte sie es mit Thränen und nahm es sofort an sich, versäumte aber auch nicht, Franz Hahn so freundlich und lieb zu danken, daß der Alte ordentlich wiederstrahlte. Im Wagen erzählte ich ihm dann von der eigentümlichen Verehrung des jungen Dichters, der auch am Vormittag während meiner Abwesenheit wieder vor dem Bilde geweilt hatte, und der Schwärmerei meiner Tochter für dasselbe. Meine Tochter errötete dabei ein über das andere Mal, wie das so die Art der Mädchen ist, wenn man in ihrer Anwesenheit von einem Gegenstand ihrer besonderen Neigung spricht.
Daheim wünschte Franz Hahn sogleich vor das wiedergefundene Bild geführt zu werden. Vorsichtig geleitete ich ihn in dies Zimmer und weidete mich an seiner Freude. Nach richtiger Malerart begann er aber, sobald er sich etwas gesammelt, die Beleuchtung zu kritisieren, welche viel günstiger sein werde, wenn das Bild mehr nach der Mitte hin gehängt würde. Ich bezweifelte das – wie ich jetzt gern zugestehe, sehr mit Unrecht – wir gerieten in Eifer und beschlossen, sogleich einen Versuch zu machen. Darüber kehrte meine Tochter zurück, die nebenan im Eßzimmer einen Willkommtrunk für unseren neuen Hausgenossen bereit gestellt und in ihrem Eifer den großen Löffel der Bowle in der Hand behalten hatte. Als sie unsere Absicht wahrnahm, wurde sie ganz entrüstet und verlangte, wir sollten das nachher besorgen und jetzt ins Eßzimmer gehen. Wir waren aber natürlich viel zu gespannt auf den Ausgang unserer Beleuchtungsstudien, um ihr zu folgen. Somit faßte ich das Bild an, um es von seinem bisherigen Platze zu heben. Da fiel etwas Weißes raschelnd hinter dem Bilde herunter zur Erde, und wie ich’s aufhob, was war es? Ein Briefchen, adressiert mit dem Vornamen meiner Tochter in der unverkennbarsten Männerhandschrift.
Ich sah meine Tochter an, die in höchster Verwirrung einen glühenden Eifer entwickelte, mich von der Lektüre des Schreibens abzubringen. Dann brach sie in Thränen aus. Ein grelles Licht [890] begann mir aufzugehen. Natürlich brach ich den Brief ohne weiteres auf, und ich brauchte nur die ersten Zeilen zu überfliegen, um mich zu überzeugen, daß es ein Liebesbrief von der blühendsten Gattung war.
Und da behüte einer junge Mädchen! Das Institut in Koblenz war berühmt wegen seiner strengen Zucht. Von dort einen Briefwechsel mit einem jungen Manne anzufangen, war ungefähr so schwer wie den König von Spanien zu stehlen. Und trotz alledem hatten sie sich – im Hause der Tante einer Mitschülerin angeblich – kennengelernt, verliebt, ausgesprochen, und in Ermangelung eines öffentlicheren Verkehrsweges mußte dieses werte Bild als Briefkasten dienen, durch den anscheinend ein recht lebhafter Meinungsaustausch zwischen den beiden jungen Kunstenthusiasten vermittelt worden war!
Jetzt begriff ich allerdings, welch wichtige Motive und Stimmungen dieser junge Mann aus dem Bilde zog, oder auch hineinlegte. Ich brauche nicht zu sagen, wie mich diese Beichte, die mir mein schuldbeladenes Töchterlein unter vielem Schluchzen und Stammeln vortrug, fürs erste stimmte. Vermutlich sprach ich mich darüber auch sehr deutlich aus, und es mag sein, daß ich dabei einen Teil meines väterlichen Zornes auf das Bild ablud und ihm einige Eigenschaftswörter beilegte, die es im Grunde nicht verdiente.
Aber da legte sich Franz Hahn ins Zeug. „Herr Justizrat,“ sagte er bescheiden aber fest, „das ist kein verfluchtes Bild. Dazu steckt viel zu viel Liebe darin. Die Liebe hat es gemalt, die unauslöschliche zu einer, die nicht mehr auf Erden weilte – die Liebe hat es durch ein halbes verlorenes Menschenleben hindurch gerettet, entschwundenen Glückes eingedenk. Und nun es bei Ihnen ein freundliches Obdach gefunden, da hat es sogleich wieder der Liebe dienen wollen, und gewiß einer guten und treuen Liebe. Glauben Sie doch meinen Augen – ich bin ein armer Kerl und sehr heruntergekommen, aber doch ein Maler mit Maleraugen – ich sehe das liebe Fräulein dort und sehe Sie, ihren Vater, und da weiß ich, daß unser Herrgott auch den Dritten im Bunde dazu richtig ausgewählt hat!“
Na, was soll ich weiter sagen – der Alte redete auf mich ein, mit Thränen in den Augen und dazu mit einem so unglaublich braven humoristischen Lächeln in seinem verwitterten Gesicht – und mein Töchterlein schluchzte und bat und hatte auch sogleich mit weiblicher Strategie das Bild ihrer Mutter zur Hand und hielt es mir vor – du lieber Gott, was soll ein armer Vater machen, wenn Mutter und Tochter so auf ihn einstürmen! Wenigstens mußte ich soweit kapitulieren, daß ich nun erst einmal in Ruhe den Brief las – umfangreich genug war er, obwohl eigentlich an sachlichen Angaben in dem ganzen Aktenstück nur die Mitteilung stand, daß „sein“ neues Schauspiel gestern in Berlin mit kolossalem Erfolge aufgeführt worden sei und „er“ sich jetzt hinlänglich sichergestellt fühle, um bei mir anzuhalten; sie möge mich darauf vorbereiten. Hm, die Vorbereitung! Aber was sonst noch in dem Briefe stand, die üblichen weitläufigen Kurialien solcher Aktenstücke aus Amors Kanzlei, schien mir schließlich doch alles von einer sehr netten soliden Persönlichkeit herzurühren …
Den weiteren Verlauf können Sie sich ja wohl denken. Ich suchte meinen Rückzug mit Würde zu decken, aber das Ende vom Liede war natürlich, daß der Werber kam, warb und siegte … Nun, Gott sei Dank, sie sind glücklich geworden miteinander und ich habe die Zuversicht, daß wenn nicht mein Name, doch mein Stamm in Ehren weiter blüht. Franz Hahn hat aber noch mehrere Jahre hier bei mir gelebt, gezecht und gemalt. Es war ein schöner Nachsommer für ihn, und ich habe auch mein Teil davon geerntet. In jener ersten Zeit meiner Einsamkeit war mir der Humor des Alten, sein feines Kunstgefühl und seine ganze Gesellschaft eine tägliche Lebensfreude, das darf ich wohl sagen. Was er als Künstler wert war und was gar erst unter anderen Bedingungen aus ihm geworden wäre, davon kennen Sie ja die Beweise. Mein Schwiegersohn suchte ihn mehrmals zu bereden, daß er das eine oder andere von seinen Sachen ausstelle, und die Kritik hätte jedenfalls dafür gesorgt, daß es noch Anerkennung finde, aber davon wollte der Alte nichts wissen. „Meine Bilder sind in guten Händen,“ sagte er. „Das ist für einen alten Malersmann genug und mehr wert als ein Platz in Kunstgeschichtskatalogen. Und wenn je ein künftiger Docent an der Akademie es für unumgänglich nötig hält, mich an diesen Platz zu stellen und kritisch zu beleuchten, so verderben Sie ihm doch nicht im voraus die Freude, nur ungenügenden biographischen Stoff zu finden und mir mit seinem Scharfsinn ein Schicksal und einen Namen zusammen zu basteln! Wer weiß, ob es ihm nicht einen Ruf auf eine ordentliche Professur einträgt und ihn in Stand setzt, das Weib seiner Liebe heimzuführen!“
Dabei blieb er. Er war eben Zeit seines Lebens im Kampf um das Glück einer von den Mindestfordernden gewesen, während die Mehrzahl es für besser hält, möglichst viel zu verlangen. Aber jedenfalls hatte ihm die kurze Spanne Glück, der er in jungen Jahren seinen etwaigen Künstlerehrgeiz opferte, ein stilles Feuerlein in der Seele hinterlassen, das ihn bis zuletzt durchwärmte. Und daß er mit dem Bilde, das zum Denkmal seines eigenen Jugendglücks geworden war, das junge Glück meines Kindes hatte begründen helfen, dies trug gewiß nicht wenig dazu bei, jenes stille Feuerlein der Erinnerung in seiner Seele noch einmal vor seinem Ende frisch anzufachen.“
| * | * | |||
| * |
Der alte Herr hatte seine Erzählung beendet. Draußen klopfte der Diener leise mahnend an die Thür: der Dampfer war in Sicht, ich mußte aufbrechen. Noch einmal trat ich an das Bild heran. Ein voller warmer Sonnenstrahl zitterte durch die Jalousie quer darüber hin, er belebte das Lächeln auf den Lippen der schönen Schenkin, und ein Hauch des in ihr verkörperten Jugendglücks traf mein Herz.