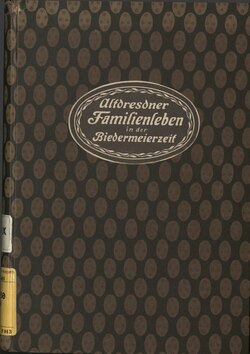Altdresdner Familienleben
Altdresdner
Familienleben
in der
Biedermeierzeit
Altdresdner
Familienleben
in der
Biedermeierzeit
von
Paul Moritz Rachel.
(Mit acht Bildern).
Dresden
1915.
Verlag des Vereins für Geschichte Dresdens.
Druck: Dresdner Lokal-Anzeiger, Dresden-N.
[-]
[Vorwort]
Vor einigen Jahren hielt ich auf Grund alter Familienpapiere im Verein für Geschichte Dresdens Vorträge über Altdresdner Leben. Auf Wunsch des Vorstandes habe ich diese anspruchslosen Berichte aus friedlicher Zeit zu einem Buche, der Vereinsgabe für das Kriegsjahr 1915, zusammengefaßt und lege es den Mitgliedern vertrauensvoll vor.
Dresden, im Herbst 1915.
[-]
[1]im 17. und 18. Jahrhundert.
In seiner hochgelehrten Geschichte, die Magister J. M. Krafft 1730 zur „Hollsteinischen Zwey-Hundert-Jährigen Jubel-Feyer“ der Einführung der Reformation in Schleswig-Holstein verfaßt hat, verbreitet er sich auch über die Husumer Kirchenhistorie und sagt dabei, daß, „wo sich irgend ein Geschlecht weit und breit vermehret und darinnen auch recht vornehme und ansehnliche gelehrte Leute sich gefunden, dies das Rachelische gewesen ist“. Wenn man die genealogische Tafel einsieht, die er von diesem Geschlecht gegeben hat, wenn man die Rostocker Universitätsmatrikel mustert, so findet man dies Wort bestätigt, denn in den Jahren 1523–1700 sind allein 14 Mitglieder der Familie Rachel an dieser Mecklenburger Universität[1] eingeschrieben oder zu Magistern promoviert worden. Sie stammten ab von einer in Malchow lebenden Familie Rachel; einer von ihnen, Nikolaus, war im 16. Jahrhundert Bürgermeister in diesem mecklenburgischen Städtchen. Die zahlreichen Söhne, Enkel, Urenkel und Ururenkel dieses Nikolaus waren eine leichtbewegliche Schar; sie verbreiteten sich über 26 Städte und Dörfer des nördlichen Deutschlands, von denen 16 in Mecklenburg oder in Schleswig-Holstein liegen. Nikolaus Rachel hatte zwei Söhne hinterlassen. Der Jüngere, Joachim mit [2] Namen, der die Malchower Linie fortsetzte, ward Vater von 6 Söhnen, die zumeist als Pastoren in Holstein, ja im eigentlichen Dithmarsenland, zu Lunden, Wesselburen und Tellingstedt, wirkten. Der älteste dieser sechs, Moritz Rachel, Pastor zu Wesselburen, ward der Vater zweier Söhne, deren Namen über das Gewöhnliche hinausragen: Joachim Rachel, geboren am 28. Februar 1618, Rektor in Schleswig, Dichter von Satiren, in denen er die Schwächen seiner Zeit mit viel Ernst und Gelehrsamkeit tadelt, und Samuel Rachel, geboren am 6. April 1628, der Professor der Rechte in Helmstedt und Kiel gewesen ist. Er hat unter vielen Schriften aus dem Jahre 1676 eine Abhandlung de jure naturae et gentium hinterlassen, unter dem Einflüsse des großen Hugo Grotius stehend, und hat als Rat des Königs Karl X. Gustav von Schweden und des Herzogs Albrecht von Schleswig-Holstein wichtige diplomatische Reisen nach Paris und zum Friedenskongreß zu Nymwegen unternommen. Seinen Spuren folgte seines Bruders Sohn, Joachim genannt, der als Gesandtschaftssekretär in Paris gestorben ist. Interessant ist, daß Professor Samuel Rachel bei der Verbesserung des schleswig-holsteinischen Schulwesens sehr energisch, aber vergeblich dafür eintrat, daß die höheren Schulen nicht Theologen, sondern eigentlichen Schulmännern unterstehen sollten. Nikolaus Rachels älterer Sohn, ein Magister Moritz Rachel, war Geistlicher zu Güstrow in Mecklenburg geworden und hatte vier Söhne hinterlassen; drei hatten studiert und waren Geistliche oder Juristen geworden. Der Drittgeborene aber, nach dem Vater Moritz genannt, hatte das Goldschmiedehandwerk gelernt und sich in Kiel niedergelassen. Von seinen sechs Kindern wanderte ein Sohn nach Hamburg und ließ sich dort nieder; ein zweiter wurde Stadtschreiber zu Gottorp; der älteste[2] aber, nach Vater und Großvater Moritz genannt, geboren 1639 zu Kiel, erlernte bei seinem Vater dessen Handwerk und begab sich 18 Jahre alt auf die Wanderschaft. Zunächst war er ein Jahr in Hamburg als Goldschmiedegesell tätig. Von 1658 – 1659 arbeitete er beim Meister Nickel Weißhun in Dresden. Von hier ging er „weiln Er nun sich auch in frembden Landen [3] umbzusehn Beliebung getragen“ nach Prag, Nürnberg, Augsburg, München, Ulm und Straßburg. Dann zog er den Rhein abwärts nach Mainz und Holland. Hier sah er sich drei Monate lang alle vornehmen Städte an, bestieg ein Schiff und fuhr nach Frankreich. In Paris, wo er zu Martini 1659 eintraf, blieb er anderthalb Jahre und „exerzierte sich in seiner Kunst“. Im Sommer 1661 reiste er nach England. Während er da einige Wochen „stille lag“, traf ihn die Nachricht, daß sein Vater am 14. Juli gestorben war. Als getreuer Sohn eilte er heim, um der Mutter zur Seite zu stehen. Er wagte aber nicht, das Geschäft des Vaters zu übernehmen, da die Stadt in den Kriegsläuften jener Zeit sehr gelitten hatte. 1664 verließ er seine Heimatstadt wieder, um zum zweiten Male nach Dresden zu wandern. Dort trat er beim Hofgoldschmied Matthäus Arnold auf der Schloßgasse als Gesell ein. Da dieser bereits 1665 starb, führte er der Witwe das Geschäft, wurde zum Hofgoldschmied des Kurprinzen, des späteren Johann Georg III., ernannt und heiratete 1667 die Witwe des Matthäus Arnold, Elisabeth, geborene van der Perre (auch von Peer genannt), und lebte mit ihr 30 Jahre in glücklicher, mit 9 Kindern gesegneter Ehe auf der Schloßgasse (im jetzt Guthmannschen Hause Nr. 18) als sehr angesehener Goldschmied, der sehr viel für die kurfürstlichen Herrschaften zu liefern hatte. Als er 1697 starb, schuldete ihm Herzog Friedrich August, d. i. August der Starke, für Juwelen und Silber von seinem fürstlichen Beilager her noch 4600 Taler. Von seinen 3 Töchtern heiratete eine den so berühmt werdenden Johann Melchior Dinglinger aus Biberach, von dessen Kunst so manches Prachtstück im Grünen Gewölbe zeugt. Moritz Rachel wurde auf dem alten Frauenkirchhof (auf dem Gebiete des jetzigen Neumarktes) begraben. Von seinen 6 Söhnen widmeten sich drei dem vornehmen Handwerk des Vaters.
Moritz Rachel, sein ältester Sohn, arbeitete bis 1699 bei der verwitweten Mutter, erwarb in diesem Jahre das Meisterrecht, starb aber schon 1717. Ein jüngerer Sohn, Heinrich Rachel, wanderte nach seinen Lehrjahren ins Reich und blieb in der damals berühmten Silberschmiede-Stadt Augsburg. Aus einem Silberdrechsler, wie er im Steuerbuch der Stadt genannt wird, [4] wandelt er sich bald in einen Silberhändler. Durch seine Eheliebste, Barbara Elisabeth Hansemann von Löwmannsegk, wird er, wie es scheint, in die altbevorrechteten Familien der Stadt aufgenommen. Die Ehe war mit nicht weniger als 12 Kindern gesegnet. Mit ihnen lebte er in der Annengemeinde, zu deren Pfarrkirche die berühmte Goldschmiedekapelle gehörte. Zwei Häuser besaß er nahe dem Annenplatze, wo jetzt seit 1914 zur Erinnerung an die Alt-Augsburger Goldschmiedekunst der Goldschmiedbrunnen steht, dessen Hauptfigur einen Meister, einen Pokal in der Hand haltend, darstellt.
Von den ihn überlebenden Kindern gingen drei Söhne nach Kursachsen zurück; nur einer blieb in Augsburg. Alle wurden von Kaiser Karl VII. unter dem Namen Rachel von Löwmannsegk in den Adelsstand erhoben.[3]
Die drei, die sich nach Dresden, dem Geburtsorte ihres Vaters wandten, waren Johann Thomas, der als Bankier genannt wird, Paul Moritz, der sich ebenfalls dem Geldhandel gewidmet hat, und Georg Matthias, ein Jurist, der erst den Titel Legationsrat führt, später „wegen seiner besitzenden guten Eigenschaften und brauchbaren Geschicklichkeit würklicher Accis-Rath, Beisitzer bei der Commercien-Deputation und zuletzt Geheimer Finanzrath“ wurde.[4]
Die Brüder Johann Thomas und Paul Moritz Rachel von Löwmannsegk (auch kurz von Rachel genannt) haben bei dem Ankauf der modenesischen Bilder für den König August III. in den Jahren 1745 und 46 in hervorragender Weise mitgewirkt, d. h. bei einem der größten Kunsthandelsgeschäfte jener Zeiten. [5] Nicht nur, daß sie die Geldbeschaffung zu leisten hatten, sie mußten sich auch mit den geldgierigen italienischen Vermittlern in Venedig auseinandersetzen.[5]
Der Herzog von Modena brauchte damals zur Befriedigung seiner Gläubiger Geld und hatte den Entschluß gefaßt, eine größere Anzahl höchst wertvoller, ihm gehörender Bilder, besonders von Correggio stammend, an den sächsisch-polnischen Herrscher zu verkaufen. Graf Brühl leitete im wesentlichen die Verhandlungen. Der Dresdner Bankier Johann Thomas Rachel von Löwmannsegk erhielt den Auftrag, die Bezahlung und die Überführung der Bilder zu übernehmen, und bediente sich dazu der Unterstützung seines mittlerweile in Venedig ansässig gewordenen Bruders, des Handelsherrn Paul Moritz Rachel. Johann Thomas reiste auf Anweisung des Grafen Brühl mit einem vierten seiner Brüder im Juli 1745 nach Venedig, um die Zahlung der geforderten 100 000 Zecchinen zu ermöglichen und den kursächsischen Hofmaler Rossi in den Stand zu setzen, mit den Bildern nach Sachsen zu reisen.
Johann Thomas fand große Schwierigkeiten vor, denn die Gemälde waren als eine Art Hypothek oder Pfand, wie wir sagen würden, in einem Kloster verwahrt und der Sicherheit halber vermauert. Bei seiner Rückreise nach Dresden war die Angelegenheit noch nicht geregelt. Paul Moritz sollte die schwierige Ausgabe vollends lösen. Es war Gefahr vorhanden, daß den Herzog der Verkauf der Kunstschätze nach Sachsen gereue, weil sich für einen Teil der Bilder neue Käufer zu melden schienen, die nur für einen Teil schon eine sehr hohe Summe zahlen wollten. Eine andere Schwierigkeit war, daß die Unterhändler des Herzogs, unter ihnen ein mehr als bedenklicher Herr, namens Bondigli, über die Art der Bezahlung ganz besondere Forderungen erhoben. Der sächsische Hof wollte in Steuerscheinen (wir würden sagen Staatspapieren) zahlen. Die Italiener verlangten jedoch Barzahlung in Goldstücken. Das bare Geld war aber bei den venetianischen Bankiers nur schwer aufzutreiben; manche Häuser waren infolge der Zeitläufte ganz oder beinahe bankerott, andere [6] waren – es herrschte damals der österreichische Erbfolgekrieg und der 2. schlesische Krieg – zu furchtsam, ein solches Geschäft zu übernehmen; vielleicht stellten sie sich auch so, um für die Beschaffung bessere Bedingungen herauszuschlagen. Nach unbeschreiblicher Mühe wurde von den Unterhändlern die Erlaubnis erwirkt, die „Schildereien“ nach Padua zu schaffen. Hofmaler Rossi nahm sie dort in Empfang. Herr Bondigli erhielt 100 Zecchinen ausgezahlt. Ehe sie aber von dort ausgeführt werden durften, sollten 7000 Zecchinen auf Abschlag gezahlt werden. Nach langen Mühen brachte Paul Moritz Rachel dieses Geld zusammen, übergab es dem Bondigli und war froh, daß dieser es überhaupt noch annahm; so schwierig hatte er sich gestellt.
Während des Winters 1745 zu 46 ruhten die Verhandlungen; abgesehen von dem Geldmangel war es wohl auch bedenklich, die kostbare Last zu Wagen über die Alpen zu schaffen. Noch immer wurde über die von den Italienern verlangte völlige Barzahlung verhandelt.
Trotz aller Kriegsfährlichkeiten machte sich Johann Thomas Rachel im Frühjahr 1746 von Dresden aus wieder auf den Weg und reiste nach Padua und Venedig. Fuhrleute wurden angeworben; ganz besonders große Kisten mußten angefertigt werden, da manche der Bilder 6 Ellen breit, 9 Ellen lang waren. Unter den jetzt in Padua für den Herzog von Modena tätigen Unterhändlern erscheint eine sehr feine Persönlichkeit, ein Marchese Rangoni. Es gelingt Johann Thomas Rachel, diesen dahin zu bestimmen, daß er „le superbe tableau de la Ste Madeleine“ von Battoni schon immer nach Sachsen führen dürfe, ehe die Hauptsumme gezahlt sei, da August III. sich gerade danach sehnen mochte. Erfreut und stolz reist der Dresdner Bankier Rachel mit dem Bilde an den sächsischen Hof; seinem Bruder Paul Moritz zu Venedig werden wiederum die abschließenden Verhandlungen überlassen.
Am 6. Juli 1746 klagt dieser dem Bruder nach Dresden über seine Erfahrungen in dem Handel: „Aber daß Gott erbarm, in was vor Verdruß bin ich nicht noch mit dem harten, unhöflichen und irraisonnablen Bondigli geraten! Als es zur Aushändigung der Zecchini gekommen, mußten selbige öfters hin- und hergeschleppt und so subtil in peso di Marco 1000, [7] auch die ganz neu geschlagenen, gewogen werden, daß dabei alleinig im Gewicht ein großer Differenz auf die depositierte Partie, ohne die viele extra Unkosten zu rechnen, zum Schaden herausgekommen, und zwar habe mit dieser Sache schon zwei, drei Tage zu vielerlei Präjudiz und andere meiner Geschäfte verloren. Und dann ist es zu einem heftigen Disput wegen dem Geld in Banco gekommen, welchen Giro der Herr Marchese nicht hätte eingehen sollen. Ich mußte über Hals und Kopf Rat schaffen, mit größter Mühe und vielem Schaden so viel Zecchini effective aufzubringen, weilen die Instruction vom Herzog von Modena, sagt Bondigli, es nicht anders erlaube.“ Dieser Bondigli, ein echter zäher Italiener, setzte es auch durch, daß gegen die 100 000 Zecchini (= 293,333 1/2 Tlr. = 2, 2 000 000 l.) die Rahmen der Bilder nicht mit ausgeliefert wurden, weil dies im Kaufvertrag nicht ausdrücklich festgelegt worden sei! – Am 6. Juli 1746 rollten die 5 Wagen, gefüllt mit den kostbaren Schätzen, aus Padua glücklich ab.
Ein sehr gutes Zeugnis stellt P. M. Rachel dem Marchese Rangoni aus: „es meritierte dieser venerable Cavalier, dessen Probität so schön hervorleuchtet, eine marque d'estime von Seiten des sächsischen Hofes. Vermeinet man ihm ein Präsent von Porcellain zu machen, müßte es ein recht hübsches Forniment[6] sein und ganz heimlich offerieret werden.“
Unsere Hochachtung vor Marchese Rangoni steigt, wenn wir später hören, daß er Schwierigkeiten macht, ein Geschenk anzunehmen. „Au contraire, S. Exc. ist intentioniert, 3 oder 4 Stück sehr rare Malereien, so er in eignem Besitz hat, Ihro Majestät dem König präsentieren zu lassen, gegen welche ihm sodann jede marque de satisfaction höchst erfreulich sein sollte.“
Trotz der schlechten Erfahrungen, die Rachel bei Abwickelung dieses Geschäftes hatte sammeln müssen, glaubte er doch nach einiger Zeit durch seinen Bruder Johann Thomas am Dresdner Hof neue Vorschläge zu Bilderankäufen machen zu sollen; es komme hierbei eine Kaufsumme von 100 000 Tlr. in Betracht, von denen sich aber gewiß noch etwas abhandeln lasse. Hieraus scheint sich jedoch nichts weiter entwickelt zu haben.
[8] Der aus dem Augsburger Seitenzweig der Rachels stammende Paul Moritz, der sich 1726 zu Venedig in das Buch der „jungen Leute“ im Fondaco dei Tedeschi (Deutsches Kaufhaus) und in das Buch der evangelischen Gemeinde[7] dieser Stadt eingetragen hatte und im Jahre 1745 selbständiger Kaufherr geworden war, ist im Jahre 1785 verstorben. Ihm waren, gewiß auch für seine Verdienste um den modenesischen Ankauf, nach und nach die Titel eines kurf. Sächsischen Geschäftsträgers, eines Generalkonsuls und Geheimen Legationsrates bei der Republik Venedig verliehen worden. Er ist kinderlos gestorben.
Johann Thomas Rachel von Löwmannsegk war zweimal verheiratet, und zwar mit Französinnen; einer seiner Söhne, nach ihm selbst genannt, ist 1764 an der Leipziger Universität immatrikuliert worden,[8] scheint aber jung gestorben zu sein. Ein jüngerer Sohn, Heinrich Balthasar, soll nach Frankreich ausgewandert und dort Haupt einer Familie geworden sein. Daß er Mitglied des Nationalkonvents gewesen und sich als solches des mittlerweile erworbenen Barontitels entäußert hat, ist überliefert.[9]
Sein Oheim Georg Matthias Rachel von Löwmannsegk, der, wie oben erwähnt, als Geheimer Finanzrat in Dresden verstorben ist, war mit dem Günstling des Grafen Brühl, Karl Heinrich von Heinecken, befreundet; denn als dieser drei Wochen nach dem Tode August III. von Polen und vierzehn Tage nach des schwerkranken Brühl Rücktritt von den Geschäften in seiner Wohnung abends 10 Uhr im Kreise seiner Familie und seiner Freunde verhaftet wurde, war G. M. Rachel in seiner Gesellschaft.
Doch nun zurück zu der dauernd in Dresden gebliebenen Goldschmiedfamilie Rachel.
Moritz Rachel jun., der schon 1717 in kräftigem Mannesalter als Hofgoldschmied zu Dresden gestorben war, hatte einen [9] Sohn Christian Friedrich hinterlassen. Auch dieser hatte die Kunst des Vaters, des Großvaters und mehrerer seiner Oheime erlernt und war eben auch auf Wanderschaft gegangen. Von 1732 bis 1735 hat er sich in London aufgehalten und sich während dieser Zeit einer Vereinigung von Deutschen angeschlossen, die sich die Künstlerbinde nannte. Bei seiner Abreise ließ er sich seine Mitgliedschaft schriftlich bestätigen. Das Blatt, ein Kupferstich, hat als Umrahmung zur Rechten und zur Linken allerhand Geräte, wie sie der Musiker, der Maler, der Mechaniker, der Goldschmied, der Architekt gebraucht. Über der Schriftplatte aber ist ein Bildchen, auf dem ein tiefbekümmerter Kranker zu sehen ist, dem ein hochgelehrt aussehender Arzt in mächtiger Perücke den Puls fühlt. Eine alte Frau zur Rechten, ein junger Mensch zur Linken, der erschreckt die Hände faltet, sind um den Kranken bemüht. Auf die untere Randleiste ist das Siegel der „Binde“ gedrückt. Es zeigt eine behelmte weibliche Gestalt mit Lorbeerbäumchen in der einen und Lorbeerkranz in der anderen Hand. Der Text aber, in dem Christian Friedrich Rachel die Mitgliedschaft von Heinrich Thomas Rammiger, dem Sekretarius, Daniel Wilhelm Wever und Nicolas Andreaß Gram bezeugt wird, hat folgenden Wortlaut in zum Teil recht schlechtem Deutsch:
Offenbar war diese Künstlerbinde eine gesellige Vereinigung und zugleich für Krankheitsfälle eine Hilfsgesellschaft für deutsche Künstler und Kunsthandwerker, die sich in London vorübergehend oder dauernd aufhielten.
Nach seiner Rückkehr nach Dresden übte Christian Friedrich Rachel sein Handwerk aus, wurde zugleich Königl. Polnischer und Kurfürstlich Sächsischer Münzscheider. Als solcher verheiratete er sich am 10. Juni 1738 mit Dorothea Christiane Schuster, der [10] Tochter eines Dresdner Kaufmanns. Zur Hochzeit hatte ein Vetter der Braut eine gemalte Zeitung anfertigen lassen und ihnen mit folgenden Widmungen überreicht: Also wünschet der Jungfer Braut als seiner Wertgeschätzten Jgfr. Muhme am Tage Ihrer Ehe-Copulation mit aufrichtiger Feder Johann Abraham Altrichter, und A Monsieur Chrétien Friederic Rachel, Joyalier bien renommé â Dresde. Von den 10 buntbemalten Zeichnungen hat die Hälfte fremdsprachliche Beischriften. So steht unter dem Bilde einer Sonnenuhr: Una sola mi consola. Auf einem anderen Bildchen, Schäfer und Schäferin darstellend, letztere mit bebändertem Stab, übergibt der Schäfer der Schönen einen Vogel im Käfig mit der Inschrift: Je quitte ma liberté de bon gré. Unter dem Bild der zwischen Löwe und Wage schwebenden Jungfrau aber steht: Voicy le cher objet de mes amours! Unter einem Bild, das einen mit Juwelen bedeckten steinernen Tisch zeigt, steht der Bibelvers aus den Sprichwörtern Salomonis 31, 10 in gereimtem, französischem Wortlaut: Encore plus precieuse une femme vertueuse.
Man sieht aus dieser zufällig erhaltenen Huldigung, die einem Dresdner Brautpaar aus bürgerlichen Kreisen in den Zeiten der polnischen Auguste dargebracht worden ist, wie tief das Franzosentum als etwas besonders Feines eingedrungen war. Als Hofgoldschmied hatte der Gefeierte ja auch viel Berührung mit der Bevölkerungsschicht, die dem deutschen Wesen gar fremd geworden war.
Christian Friedrich Rachel, der 1738 seinen Hausstand gründete, ist nach 45 jähriger Ehe 1783 gestorben. Er hatte 1778 seine Wohnung von der Schloßgasse nach einem ererbten Hause auf der kleinen Schießgasse (jetzt Schießgasse 24) verlegt. Dies Haus war an Stelle eines 1760 eingeäscherten Gebäudes errichtet worden und galt 1780 nach Hasche[10] als eines der „besten in seinem Geschmack“. Zwar erscheint es uns im Vergleich zu den Barockbauten vor dem siebenjährigen Kriege als recht einfach, sticht aber von denen, die nach der napoleonischen Zeit in den neu angelegten Straßen vor den demolierten Wällen gebaut [11] worden sind, vorteilhaft ab. Er besaß außer diesem Hause noch ein Haus und einen Garten in der Hinterseeer Gemeinde und einen Garten vor dem Pirnaischen Tore nach dem Elbberge zu. Er hat nicht die Freude gehabt, daß sein einziger ihn überlebender Sohn, nach ihm Christian Friedrich genannt, ihm in seinem Gewerbe gefolgt ist. Dieser hatte nach dem Beispiele eines Oheims, Moritz Rachel, der in der Löwenapotheke zu Dresden gelernt hatte und dann der Besitzer der Pirnaer Apotheke gewesen war, dies Gewerbe ergriffen und sich außerdem zum medicinae practicus ausgebildet. Er ist nach Frauenstein im Erzgebirge gekommen, hat sich dort mit des Apotheker Lind Tochter verheiratet und die Konzession erlangt. Die Hinterlassenschaft des Vaters an Dresdner Grundbesitz ging in die Hände zweier Schwestern über, da männliche Vertreter der Familie Rachel von 1783 an etwa 20 Jahre nicht mehr in Dresden gelebt haben.
Die Vermögensumstände des Frauensteiner Apothekers scheinen keine besonderen gewesen zu sein; von seinen Kindern wurde der älteste Sohn Tischler; er ist im Verlaufe der Jahre Tischlerobermeister geworden; ein anderer Sohn übernahm zwar die Apotheke, starb aber, ohne seine Familie in gesicherten Verhältnissen zu hinterlassen. Ein jüngerer Sohn besuchte die Frauensteiner Stadtschule und kam dann zur Erziehung und Unterweisung zum Pfarrer Blochmann nach Reichstädt bei Dippoldiswalde. Vielleicht hatte sein Vater die Absicht, ihn später noch weiter ausbilden zu lassen. Die Verhältnisse haben es aber wohl nicht gestattet, und in jungen Jahren wanderte der im Jahre 1783 am 15. Februar geborene Heinrich Wilhelm Rachel nach Dresden, der Stadt, in der seine Vorfahren schon seit beinahe 150 Jahren gelebt und geschafft hatten. Er sollte dereinst sich einen bescheidenen Wohlstand gründen, das Vertrauen und die Achtung seiner Mitbürger gewinnen und eins der Rachelschen Häuser zu seinem Besitze machen, in dem er ein halbes Jahrhundert als Vater, Schwiegervater und Großvater geliebt und verehrt worden ist.
[12]
Heinrich Wilhelm Rachel
(geb. 15. Februar 1783 zu Frauenstein, gestorben am 16. Mai 1861 in Dresden).
Erst 18 Jahre alt war Wilhelm Rachel, als er den löblichen Entschluß faßte, in der kurfürstlichen Residenz- und Hauptstadt Dresden, wo er noch Verwandte besaß, sich auf eigene Füße zu stellen. Vor etwa 140 Jahren war sein Ururgroßvater, freilich im Besitz der Handwerkskünste eines Goldschmiedes, vom Norden her, von Kiel aus, in dieselbe Stadt gekommen und hatte sein äußeres und sein inneres Glück gefunden. Jetzt versuchte er, es war im Jahre 1801, dasselbe, von Süden herkommend, aus der bescheidenen Gebirgsstadt Frauenstein, an die er sein Lebenlang Anhänglichkeit bewiesen hat. Er hat unter des Pastor Blochmann Anleitung eine gute elementare Schulung, den Ansatz zu höheren Kenntnissen und vor allem einen geistigen Hunger nach höherer Ausbildung erworben. Zunächst hieß es: bescheiden anfangen. Gewiß haben ihm seine Dresdner Verwandten, seines Vaters Schwester und deren Ehegatte, die ersten Wege freundlich geebnet.
Zuerst arbeitete er für 2 Taler Monatsgeld bei einem Juristen und verdiente sich durch besondere Schreibarbeiten – er schrieb eine wunderschöne Hand – für andere Personen noch manchen Groschen. Auch war er in guten Familien, so beim Herrn Diakonus Schröter oder beim Herrn Finanzkommissar Zange, wenn es ein größeres Familienfest, Hochzeit oder Kindtaufe gab, [13] von helfender Hand. Bei Zange erschien er täglich, um ihm allerhand Dienste zu leisten. So frisierte er ihn auch. Dafür, daß er diese Kunst, als er aus diesem Dienste nach 3 Jahren schied, seinem Nachfolger beibrachte, erhielt er 3 Taler ausgezahlt. Im Jahre 1804 kam er durch die Vermittelung seines Oheims, Johann Gottlieb Winkler, der verheiratet war mit einer Schwester des Vaters, Christiane Salome, geb. 1750, und die sehr gut ausgestattete Stelle eines Buchhalters und Kassierers bei der Hauptauswechslungskasse inne hatte, in eine untere Stelle mit 120 Taler jährlichen Gehalts.
Solange seine Einnahmen noch bescheiden gewesen, gab er, sparsam wie er war, unglaublich wenig aus. Aus seinem trotzdem sehr feierlich geführten Einnahme- und Ausgabebuch in den Jahren 1801 bis 1804 sei einiges herausgegriffen, was für die Zeit und die Preise der Zeit interessant ist. Im November 1801 sah er sich für 2 Gr. zwei wunderbare Geschöpfe an, im Monat darauf war er für 1 Gr. in einer „Bude“. Mit Begeisterung lernte er Flötenspiel auf einem Instrument, das er sich für 2 Tlr. 6 Gr. kaufte. Für Mittagessen zahlte er, wenn er Rindfleisch und Reis aß, 2 Gr.; bei einem anderen Traiteur kam ihm Rindfleisch mit Bohnen oder Bratwurst mit Gurkensalat nur 2 Gr. 9 Pf. Teuer war dagegen der Zucker; für ein Viertelpfund waren 2 Gr. 6 Pf. zu zahlen. Zu besonderen Tagen kaufte er für sich oder die Verwandten in Frauenstein „Schweizergebackenes“. Für den neuen Hut handelte er noch besonders Schnalle und Band, sowie ein Wachstuchfutteral ein. Oft wird für ein „Haarband“ 1 Groschen angesetzt. Ein Paar Stiefel kostete ihm 5 Tlr., ein Paar Schuhe 1 Tlr. 9 Gr.; für Besohlen waren 11 Gr., für ein Paar Absätze 3 Gr. zu rechnen; eine Stiefelbürste erschwang er sich für 1 Gr. 6 Pf.
Um seine bisher bescheidene Ausbildung zu erhöhen, warf er sich mit Recht auf Erlernung der französischen Sprache; für 17 Gr. schaffte er sich eine französische Grammatik und ein Wörterbuch an. Vierteljährlich verausgabte er trotz geringster Einnahme 18 Gr. für einen Lesezirkel. Außer dem geistigen Hunger trieb ihn auch, wie sich bald zeigen wird, die Liebe dazu, sich wissenschaftlich und gesellschaftlich auszubilden. Kaum hatte [14] er 1804 statt nur 2 Tlr. monatlich 10 Tlr. Gehalt bekommen, so ging er zum Sprachlehrer und zum Tanzlehrer. Er wollte hinter seinen Cousinen, den Töchtern des Buchhalters und Kassierers, nicht zurückbleiben, um so weniger, als er mit 18 Jahren sich es bereits fest in den Kopf gesetzt hatte, die 13 jährige Cousine Emilie Salome Winkler dereinst als seine Frau heimzuführen!
Jahrelang hat er diese Liebe treulich mit sich getragen, seinem Amte aber so ernstlich obgelegen, daß er das uneingeschränkte Lob seines Vorgesetzten erhielt.[11] Sobald sich Gelegenheit zur Beförderung bot, empfahl ihn dieser als einen jungen Mann, der eine sehr gute Hand schreibe und zu allen tabellarischen Arbeiten gut zu gebrauchen sei. Er rühmte ihn in einem amtlichen Schreiben an die vorgesetzte Behörde als einen „treuen und brauchbaren und für das höchste Interesse sorgsamen Mann“ wegen seines Verhaltens bei der Flucht der Kasse von Dresden nach Görlitz 1806, zur Zeit, da Kaiser Napoleon im Feldzuge gegen Preußen, mit dem Sachsen verbunden war, im Kurstaat einrückte. Der junge Rachel hatte hierbei die möglichste Sorgfalt wegen Sicherheit der bepackten Wagen angewendet.
Diese bewegten Tage waren für das junge, sich liebende Verwandtenpaar noch dadurch bedeutungsvoll geworden, daß ihm die Geliebte am Tage vor der Abreise „ewige Freundschaft“ schwur. Wie überschwenglich unsere Altvorderen ihre Liebe zum Ausdruck brachten, dafür zeuge der Glückwunsch, den der junge Mann seiner heimlich Verlobten in jener Zeit zu ihrem Geburtstage schrieb. Er lautet:
Empfindungen
am
Morgen des Lebenstages
meiner theuren
Emilie.
Noch ruhet nächtliches Schweigen auf der ganzen Natur, und nur einzelne Vögel schwirren durch die Luft. Aber der schöne Tag, der Lebenstag meiner theuren Emilie, ist schon [15] angebrochen! Mit andachtsvoller Rührung blicke ich in die purpurnen Wolken im Osten, welche die nahende Sonne, die freundliche Schöpferin all' unserer Freuden verkündigen.
Rein und wolkenlos wird sie aufgehen, die Hehre, und Deinen reinen Jugendäther, holde Emilie, mit sanftem Lichte durchglänzen!
Du freundliche Blume im Garten Gottes, möge nie ein giftiger Nebel Deine Schöne trüben, und neidische Wolken am Horizonte Deines Lebens die sanften Strahlen der segnenden Göttin verdunkeln.
Jeder Lenz, den Du, o Theure, verlebt, kehre doppelt zurück, und jede Freude, die Dich durch die rosigen Jahre geleitete, sei Dir durch die zahlenlose Menge der herrlichsten Lenze, die noch Deinem schönen Leben folgen, Begleiterin!
Kein Dämon trübe je den reinen Aether Deiner Tage, und nie möge auch nur der kleinste Schmerz Dich treffen, sondern alles Gute, Schöne, womit der Allgütige seinen Lieblingen lohnet, ströme auf Dich, Du würdiger Liebling, herab! –
O schütze sie, Allgütiger! Schütze sie, die liebevolle Spenderin meiner seligsten Freuden! Geleite sie sanft durch die Pfade dieses Lebens! Entferne mit treuer Vaterhand jedes Ungewitter von ihr, damit sie, die zarte Blüthe einer besseren Zone, reife zur schönsten Frucht! –
Ja, – theure Emilie! – Der Allgütige wird Dich segnen! – Deine Hoffnungen, Dein zartes Sehnen, wird sich auflösen in die schönste Harmonie des reinsten Lebensglückes! Deine stillen Tugenden, Deine Demuth, Deine Frömmigkeit, die zarte Liebe, mit der Du jedes fühlende Wesen beglückest – und ach! die für mich die einzigen Erdenwonnen sind! – siehet der Ewige! –
O, sei fernerhin die liebevolle Begleiterin, der holde Stern, der mit himmlisch-sanftem Lichte die eintönigen Pfade meines Lebens erleuchtet!
Ach, wie viele frohe Tage, ja Jahre, verdanke ich Dir! – Wie einsam und arm an jenen seligen Freuden, welche das Herz mit Himmelswonnen erfüllen, würde mein Leben [16] gewesen seyn, wenn nicht Du, liebevolles Wesen, all' diese Freuden mir geschaffen hättest! –
Nimm von mir gütig auf den wärmsten Dank für jede frohe Stunde, die Du mir gewährtest, und erfülle die einzige innigste Bitte, welche ich heute, an dem heiligen Tage, in Dein Herz lege: Bleib' meine Emilie! mein Alles! meine Welt!
Dann nur ist glücklich
Dein wandellos treuer Wilhelm.
Nicht so leicht wurde es dem jungen Mädchen ihre Gefühle
zum Ausdruck zu bringen. In einem längeren, zum Teil recht
ängstlich gehaltenen Briefe „an meinen Freund Wilhelm“, dem
ersten Schreiben, das sie ohne Wissen ihrer Eltern an ein männliches
Wesen richtet, drückt sie all ihre bänglichen Gefühle aus,
wie sie so manche still Verlobte erfassen. „Prüfe Dich, ob, wenn
ich mich bestrebe, Deiner immer würdiger zu werden, Deine Liebe
zu mir sich nicht mit jedem Jahr verringert, sondern mit jedem
Jahr sich erneuert und verstärkt! Lege ich je den Schwur
ewiger Liebe und Treue ab, so sei fest von mir überzeugt, daß
ich ihn auch in dem ganzen Umfange des Wortes halte, daß
kein Blick meinen Augen, kein Wort meinen Lippen entführe,
es sey fern oder nah, beobachtet oder unbeobachtet, der auch
nur den geringsten Schein von Untreue trüge.“ Wie sie ihm die
Treue je und je halten werde, so müsse auch er sie ihr halten;
nur wenn sie davon felsenfest überzeugt sein könnte, werde sie
den ernsten Schritt zum Altar einst tun, der doch über ihr ganzes
Leben entscheide.[12]
Die ernste Stimmung, die den jungen aufstrebenden Beamten in jenen Jahren erfüllte, geht besonders deutlich hervor aus einem Briefe, den er im Jahre 1811 an seinen Jugendfreund Justus Blochmann, den späteren Leiter des großen Erziehungsinstitutes in Dresden, richtete. Beide waren auf der Reichstädter Pfarre von Blochmanns Vater unterrichtet worden. Ihre Wege hatten sich geschieden. Der junge Pastorssohn hatte
[Bild][-] [17] Theologie studiert und war aus Begeisterung für Pestalozzi nach Iferten gewandert. Rachel war bis zum Jahre 1811 in seinem Amt soweit gekommen, daß er, der glücklich verlobte, 28 Jahre alte Mann, schon nahe der Heirat war. In dieser Stimmung schrieb er dem Jugendfreunde am 10. Juli 1811:
In den früheren Jahren meiner Liebe erhielt ich einmal von meiner treuen Emilie einige Blümchen, welche an ihrem schönen Busen während eines schönen heiteren Tages, den wir auf einem nahen Landguthe unter Freunden verlebten, geprangt hatten. Diese Blümchen suchte ich am Abend auf dem Heimweg von ihr zu erlangen, und sie wurden, unter Glas und Rahmen, mein Heiligenbild, vor dem ich täglich die Gefühle der Liebe erneuerte. Mit diesen heiligen Sinnbildern habe ich nun die von Dir erhaltenen Schweizerblümchen vereinigt! Ja, geliebter Freund! Du konntest mir Tausende schenken, ich würde sie angestaunt, bewundert und annehmlich gefunden haben, aber jene schönen heiligen Gefühle, welche mich beim Anblick dieser Blumen ergriffen, hätten sie nicht erregt! Ich war ganz außer mir! In den ersten Tagen sah, hörte, fühlte ich nichts, als diese Blumen. Was diese Gefühle noch erhöhte, war, daß ich gerade in dieser Zeit die Julie von Rousseau las. Nein, Freund! Du kannst nicht inniger die Geisternähe des unsterblichen Mannes während Deiner Gegenwart auf der Petersinsel gefühlt haben, als ich beim Anblick dieser Blumen. Ich kann Dir versichern, daß ich mehrere Tage dazu nötig hatte, um das Gleichgewicht wieder herzustellen zwischen meinen Verhältnissen und den tobenden Wünschen, in Deiner Nähe zu sein, um all diese Schönheiten selbst zu sehen, selbst zu fühlen! – So mächtig regt sich das Gefühl in gleichgesinnten Seelen bei Gegenständen, für die sie gleich hohes Gefühl im Busen tragen!
Ach Freund! es gehört mehr Philosophie dazu, als Du wohl ahnen magst, zufrieden zu seyn, bey dem dringenden Wunsche, ganze Welten zu durchreisen, und sich fest an einen Ort gefesselt zu sehen, ohne je vorher das Glück genossen zu haben, nur einmal Gottes schöne Schöpfung im fernen Lande [18] überblickt zu haben! – Ich erscheine mir oft als einer, welcher mit gebrechlichem Körper, mit gelähmten Füßen und von Hülfsmitteln entblößt, die feurigsten Seelenkräfte besitzt und die tiefste Sehnsucht empfindet, die Welt im Großen zu sehen – und so gefesselt an seine vier Wände, sie nur auf der Charte durchstreifen kann.
Doch laß uns abbrechen. – Es ist nicht allen vergönnt, einzudringen in die hohen Geheimnisse der Schöpfung. Dir, Du Glücklicher! sind ihre Schleier gelüftet! Du schaust hinein!
Dem ungeachtet will ich nicht undankbar seyn gegen die Vorsehung, die mich vor so vielen meiner Brüder vorteilhaft begünstigte.
Wenn ich auf meine Jugend zurückblicke und meinen damaligen Zustand dem gegenwärtigen gegenüberstelle – o, Dank sey ihm, dem Vater der Wesen! – so sehe ich unverkennbar, wie väterlich und liebevoll Er sich meiner annahm. Arm (geistig und physisch) verließ ich das kleine Städtchen, wo ich, in ärmlichen Verhältnissen, die ersten Eindrücke von den Freuden, aber, ach! auch von den vielen Leiden dieser Welt empfunden hatte, und wanderte mit meinem nun seit 3 Jahren verewigten Vater nach der Residenz, um hier im großen Gewühl der Menge für mich ein Plätzchen herauszusuchen, wo ich Armer den Grundstein zu meinem künftigen Fortkommen legen könnte. Ein Jurist nahm mich auf, und nun begann mein neuer Lebenslauf. Ich, ein unbefangener Knabe, der die Menschen nur als friedliche Wesen kannte, lernte hier in einer Reihe von 5 Jahren die Kabalen kennen, mit denen sie sich, gestützt aus das hochgepriesene Jus, Recht zu verschaffen wissen. Ach, Guter! es ist wohl nichts ärmlicheres unter der Sonne, als diese Formalien und Materialien, Repliken und Dupliken, Interrogatorien, Leuterungen und Appellationen und wie die furchtbaren Dinge alle heißen! Der größte Kabalist, Wort- und Sachverdreher gilt als der größte Jurist und hat den Zulauf der Menge!
In dieser Zeit entstand meine Liebe zu meiner theuern Emilie. Wenn ich nun den ganzen langen Tag in so „herz- und geisterhebenden“ [19] Geschäften verlebt hatte, so entschädigte mich am Abend gar reichlich der Anblick dieses holden Wesens, von dem ich jedoch noch lange nicht durch Gegenliebe beglückt wurde. Am 14. Oktober 1806 endlich, an einem Tage, wo Tausende ihr Grab fanden, wo das Glück Tausender auf immer zertrümmert ward, ging mir die Sonne des Glückes auf; an diesem Tage schwur mir Emilie ewige Freundschaft (eine holde Scham ließ sie das Wort Liebe nicht aussprechen). Es verhielt sich so: der kriegerischen Ereignisse wegen mußten wir mit unsern Schätzen, wie die Bestimmung war, nach Breslau wandern. Emiliens Vater und ich wurden ernannt, die Kassengelder zu begleiten. Hier nun, als Emilie die Möglichkeit einer langen Trennung vor sich sah, löste sich die Eisrinde, welche bis dahin ihre Gefühle vor mir verdeckt hatte: sie fiel mir um den Hals und schwur mir, den ersten Kuß auf meine Lippen drückend, ewige Freundschaft. Freund! Nur Du kannst fühlen, welche Empfindungen dieser Kuß erzeugte! Ein neues Leben goß sich über mich aus! In der Ferne hörte man den dumpfen Donner der mordenden Geschütze auf den blutigen Gefilden Jena's, aber das störte mich Glücklichen nicht: ich hatte eine Welt gewonnen! Seit jenem merkwürdigen Tage lebe ich in der süßesten Eintracht mit dem holden Wesen, und bald wird ein engeres Band uns umschlingen! Wenn Du 1814 zu uns kommen wirst, so wirst Du, wenn anders eine gütige Vorsehung unser Vorhaben begünstigt, Zeuge unseres Glückes seyn!
Wie freue ich mich, dann auch die Glückliche kennen zu lernen, der Du Deine Liebe schenktest! – Grüße sie, Du Guter! Grüße sie aufs innigste von Deinem Freunde! Sage ihr: daß ich sie, der ich sie noch nicht kenne, noch nie gesehen habe, mit der innigsten Liebe umfasse, bloß, weil sie den Freund meiner Seele mit ihrer Liebe beglückt! O wie gern möchte ich das herrliche Wesen sehen, daß Dich, Du Edler, so glücklich macht!
Hochwillkommen im Vaterlande soll uns Deine Geliebte seyn!
H. W. Rachel.
[20] Wenige Wochen nach diesem Briefe erhielt er wirklich
100 Tlr. Zulage, so daß er nun 400 Tlr. Gehalt hatte.
„Glücklich war ich nun wie ein König!“, schreibt er in seinem
Tagebuche; „gegen Abend, es war ein schöner Augusttag, ging ich
mit meiner Emilie über Neustadt die Königsbrückerstraße hinaus
spazieren. O wie selig fühlten wir uns in der Überzeugung, daß
unsere baldige Vereinigung nun nahe war!! Den 11. Oktober,
den Geburtstag der Mama, benutzte ich nun, um förmlich bei
ihr um meine Emilie schriftlich anzuhalten. Meine Bitte wurde
gewährt, wobei der Papa noch den Spaß machte und zu mir
sagte: ‚Mich gehts gar nichts an, denn Du hast bei mir gar nicht
deshalb angefragt.‘ Den zweiten Weihnachtsfeiertag war Verlobung,
wozu die Mama die Verwandten, Finanzprokurator
Haase und Schulrat Günthers eingeladen hatte.“ Im Mai des
Jahres 1812, gerade kurz vor den glänzenden Festtagen, die
Kaiser Napoleon vor seinem Marsch nach Rußland in Dresden
abhielt, machte das Brautpaar mit der Schwester der Braut und
dem Finanzkommissar Zange nebst Ehefrau eine Reise ins
„Ertzgebürge“ und nach Carlsbad. Merkwürdigerweise lautet der
unter dem 12. Mai ausgestellte Paß auf ihn, seine Frau und
seine Schwägerin, gewiß um sie beide als Beschützerin der jüngeren
Schwester einzuführen.
Erst am 21. Juli 1812 fand die Trauung in der Kreuzkirche ganz einfach statt. Nach dem Hochzeitsmahle, an dem nur einige Verwandte teilnahmen, ward etwas getanzt. Die Freunde, darunter der Königl. Hofbuchdrucker Meinhold, mit dem Rachel bis an dessen Lebensende in treuer Freundschaft lebte, hatten ein sehr schwungvolles Hochzeitsgedicht in Atlaseinband gestiftet. „Gegen Morgen ging ich mit Emilie von der kleinen Schießgasse aus über den demolierten Wallplatz nach Hause. Auf der Rammischen Gasse (jetzt Pillnitzer Straße) kamen uns die Ostraschnitter mit dem Morgengesange: Für deinen Thron tret ich hiermit usw. entgegen. Am andern Morgen besuchten uns liebe Verwandte! Dieser Morgen war für uns sehr feierlich, und nie werde ich vergessen, wie glücklich ich mich fühlte, als ich zu Mittage mit meiner lieben Emilie zum erstenmale in meiner Einrichtung essen konnte.“
[21] Aus diesem Glücksgefühl heraus schrieb er am 20. August dem lieben Freunde Justus Blochmann, der damals auch hoffen durfte, bald junger Ehemann zu werden:
„Der 21. Juli hat mich zum glücklichsten Manne gemacht. Möge, guter Freund, Deine künftige Verbindung Dir alle die Freuden gewähren, die mir in diesen vier Wochen zu Theil wurden: inniger kann kein Glückwunsch seyn, der aus Freundesherzen kömmt.
Meine Emilie läßt Dich herzlich grüßen!
Wie gehts, guter Freund, mit Deiner Herzensangelegenheit? Ich denke sehr oft an Dich und Deine Geliebte. Sage ihr, lieber Justus, von einem glücklichen Ehemann viele Grüße; sage ihr, daß wir sie herzlich willkommen heißen würden in unserem traulichen Vaterlande! – Ich freue mich sehr, Euch zu sehen bei uns, in unserer kleinen Wirthschaft, um Euch nach biederer deutscher Sitte willkommen zu heißen.
In der vergangenen Woche machte ich mit meinem treuen Weibe eine Fußreise nach Frauenstein. Wir gingen über Reichstädt und besuchten bei dieser Gelegenheit den Kirchhof. Auf dem Grabe Deines verewigten Vaters erzählte ich meiner Emilie alle die vergangenen frohen Stunden, welche wir in dem traulichen Pfarrhause zusammen verlebt haben; der Geist Deines trefflichen Vaters trat bei diesen Erinnerungen an die froh verlebten Kinderjahre lebhaft vor meine Seele – ich war ganz der glückliche Knabe, der mit Dir im Pfarrgarten traulich spielte.
Gehaltvoll, guter Blochmann, gehaltvoll sind die 14 Jahre, welche dazwischen liegen!“
Das Jahr 1812 verfloß ruhig und ungestört für das junge Ehepaar. Die „ersten Weihenachten“ suchte er der geliebten Frau besonders feierlich und unvergeßlich zu machen. Aber nach Weihnachten gingen die Unruhen an. Die Nachrichten von dem verunglückten Feldzuge Napoleons langten an, es wurde immer wahrscheinlicher, daß das Kriegstheater in Dresdens Nähe kommen würde. „Im Februar gingen schon die Durchmärsche an, und im März bekamen wir Russen zu sehen. Nunmehr schien es uns Zeit, unser Quartier zu verlassen und herein in die Stadt zu ziehen. Vorläufig schliefen wir nur in dem Hause der [22] Eltern, wo wir von einem Platze zum andern mit unserer Schlafstätte wanderten. Im Juni wurde es wieder ruhiger, und wir konnten wieder draußen wohnen, benutzten auch den Waffenstillstand, um eine Reise zu Fuße nach Frauenstein zu machen. Allein im August wurden die Unruhen ärger, und wir zogen nun mit sämtlichen Sachen in die Stadt. Unser Hinterhaus wurde in die Verteidigungslinie gezogen, und wir mußten das Quartier ganz räumen, wo wir dann zum Glück die Möbles beim Herrn Oberlandweinmeister (im gegenüberliegenden Kuffenhause) unterbrachten. Den 25. August rückten 3 Compagnien Franzosen ins Haus, besetzten die Hinteretagen, wo die Fenster durchgängig mit Erdsäcken verpallisadiert waren. In der 3. Etage hatten wir die Offiziere. Meine und Emiliens Wohnung war die Seiten- oder Hofstube. Den 26. geschah der Angriff der Stadt. Mitten im Kugelregen suchte ich Emilie, die im 8. Monat der Hoffnung war, durch Bierlingen ins Hotel de Pologne (jetzt Sächsische Bank auf der Schloßstraße), wo die Tante Siegert ihre Wohnung aufgeschlagen hatte, zu bringen. Dort blieb sie auch die Nacht und den folgenden Tag. Später, wie es wieder ruhiger wurde und wir sahen, daß die Offiziers sehr gute Menschen waren, holten wir sie wieder. Die Soldaten blieben aber noch mehrere Tage da. In der Seitenstube neben der Kassenexpedition hatten sich mehrere kranke Soldaten eingenistet, was wir nicht wußten. Ich ging einmal früh hinein, um etwas aus einem Schranke zu holen, den wir darin hatten müssen stehen lassen. Sowie ich die Türe öffnete, stößt mir der Krankengeruch entgegen, und im Nu war ich vom Nervenfieber angesteckt, was auch binnen wenigen Tagen ausbrach. Mehrere Wochen litt ich daran, während welcher Zeit meiner Frau Bruder Wilhelm ebenfalls an einem heftigen Gallenfieber litt. Noch war ich nicht genesen, da wurde mir von meiner lieben Emilie am 28. September der Julius geboren, welche Freude allen Kummer vorher wieder verscheuchte.“ Erst vier Wochen später konnte der Knabe getauft werden, denn die Wohnung war oft von Soldaten besetzt. Acht Tage nach der Kapitulation vom 13. November wurde sie ganz frei, und die Familie begann, sich in den hinteren, nach der Kontereskarpe (etwa Amalienstraße) gelegenen [23] Zimmern wieder zu „retablieren“. Da wurde Wilhelm Rachel an Stelle seines Schwiegervaters, des Kassierers an der Hauptauswechslungskasse, der zu alt und kränklich war, auf Wunsch des mittlerweile eingerichteten Generalgouvernements nach Leipzig berufen „zur Aufhülfe der Kassenbillets“. Nach dem mittlerweile eingetretenen Tode des Schwiegervaters reiste er mitten im Winter in drei Tagen mit Frau und Vierteljahrskind nach Leipzig. Dort erwarb er sich durch sein geschicktes Auftreten, seine tüchtige Arbeitskraft und durch den Einblick, den er in den Geschäftskreis gewonnen, die Achtung seiner fremden Vorgesetzten, so daß er die gesamte Neueinrichtung bei dem für die damalige Zeit sehr guten Gehalt von 1 500 Talern schuf. Dabei arbeitete er möglichst daraufhin, daß die Kasse wieder nach Dresden komme, wo am 7. Juni 1815 König Friedrich August nach dem Verlust eines großen Teiles seines Landes wieder eingezogen war. Im November 1815 wurde dies nach seinen Wünschen entschieden; im Dezember desselben Jahres, in dem ihm sein zweiter Sohn Gustav geboren wurde, richtete er die Kasse wieder im Hause auf der kleinen Schießgasse ein und lebte in sorgenfreier Lage mit seiner Familie. Im Juni 1818 wurde er, wie er schreibt, in Anerkennung seiner Verdienste und seiner Treue „Mitglied des Civilverdienstordens“, d. h. er bekam die Goldene Medaille dazu.
Die im Hauptstaatsarchiv aufbewahrten Akten enthalten aus den Jahren 1815 und 1816 Zeichen entschiedener Anerkennung für seine Tätigkeit. So schreibt einer seiner Vorgesetzten über ihn: „Die größten Anstrengungen des Buchhalters Rachel haben es möglich machen können, alles zur Abführung der Kasse und ihrer Effekten dergestalt vorzubereiten, daß er, für seine Person sogleich von Leipzig abgehen und das übrige Personal nebst der Kasse ihm baldigst nachfolgen kann“. Die Kassenräume in Dresden auf der kleinen Schießgasse sollten recht sicher gestellt werden. Der Residenz-Gouverneur, Kabinettsminister von Cerrini, wird ersucht, diesfällige Ordre zur Aufstellung eines Militärpostens zur Tag- und Nachtzeit zu geben. Hinter dem Hause, nach dem ehemaligen Walle zu wird eine Piquet-Post stehen, der der Buchhalter Rachel die nötigen [24] Weisungen zu geben hat. Als einige Monate später – im Juli 1816 – eine Laterne, die hinter diesem Hause nach dem Festungsraum zu aufgestellt gewesen war, entfernt wurde, erging von der Kasse ein Ersuchen an das Stadtpolizeikollegium, diese wieder aufzustellen und den Aufwand aus dem „Fonds zur Unterhaltung der Laternen“ zu entnehmen; bei finsteren Nächten könnte die Piquetpost den von mehreren Seiten zugänglichen Festungsraum nicht übersehen. Das Stadtpolizeikollegium übertrug unter dem 12. Juli 1816 dem Laterneninspektor Bohse Aufstellung und Unterhaltung der gewünschten Laterne.
Sechzehn Jahre später 1832 wünscht das Kriegsministerium, den Posten einzuziehen, da es die Mannschaft anderweit verwenden könne und die Bewachung überhaupt durch die mittlerweile herangewachsenen Bäume sehr erschwert sei, die Kassenfenster aber genügend vor Einbruch geschützt seien. Das Finanzministerium nimmt sich aber der Sache energisch an und verlangt die Aufrechterhaltung des Postens, denn in dieser abgelegenen Gegend sei dieser Nachtposten ohne besorgliche Gefahr um so weniger zu entbehren, als eben die Gärten und Bäume, zumal bei den bevorstehenden langen Winternächten, Versuche zu Einbrüchen begünstigen, wogegen die entlaubten Bäume der Wache die Aussicht erleichtern. Und so trägt das Finanzministerium „zur Entschüttung aller Verantwortlichkeit“ auf Beibehaltung an. Als die Kasse 1833 in ein Staatsgebäude verlegt wurde, erledigte sich diese gewichtige Frage von selbst.
Die Geschäfte, die Rachel betrieb, waren umfangreich und verantwortungsvoll. Bei seinem Streben, sich aber auch anderweit zu betätigen, ist es erklärlich, daß er in damals entstehende oder schon bestehende Vereine eintrat und Ämter darin übernahm. So hat er sich von 1820 an lebhaft mit der für Dresden damals neuen Blindenfürsorge beschäftigt, ebenso viel Interesse für die ökonomische Gesellschaft gezeigt, deren Sitzungen er gern besuchte. Im Jahre 1820 kaufte er seiner Schwiegermutter, die zugleich als geborene Rachel seine Tante war und sich in recht unsicheren Verhältnissen befand, das Haus ab.
Es gelang ihm, nach der Demolierung der Wälle ein Stück Landes hinter seinem nach dem ehemaligen Hasenberge zu gelegenen [25] Hause zu erwerben. Auf diesem Gelände legte er sich einen sehr gemütlichen Hausgarten an. Auf nicht zu großem Gebiet hatte er Gemüse- und Erdbeerbeete. An der Hauswand und an der nach Süden zu gelegenen Gartenmauer zog er wohlschmeckenden Wein. Auf den Rasenplätzen standen sehr gute Apfel- und Birnenbäume, die noch bis in die 60 er Jahre des vorigen Jahrhunderts ausgezeichnete und oft sehr reichlich Früchte trugen. Hier stach er sich selbst seinen Spargel, freute sich der Erd-, Johannis- und Stachelbeeren. Königskerzen zur Teebereitung und Portulak zu Suppenwürze überwachte seine Frau. An kleinen Blumenbeeten mit „Tulipanen“, Lavendel, Männertreu und Herzblumen, Päonien und Rosenbüschen war kein Mangel. Ein Berg gab Gelegenheit, hinüberzuschauen in den bald darauf entstehenden botanischen Garten, der nun auch schon längst eingezogen ist. Ein besonderes Schmuckstück des Gartens aber war ein „Lusthaus“, eingeweiht am Geburtstage der Hausmutter, den 9. Juni 1820. Es war im Geviert angelegt und enthielt einen Raum, groß genug, daß Sofa, Tisch und reichlich Stühle darin standen. Zur Not konnten zwei Betten hineingestellt werden, wie denn, nach des Erbauers Tode freilich, 1866 unsere preußische Einquartierung dort gemütlich hauste. Hier in diesem Lusthause saß die Familie bei kühlerem Wetter oder bei Regen. War warme Luft, dann wurden Tisch und Stühle hinausgerückt, und es wurde zu Mittag oder zu Abend traulich im Grünen gespeist. Wenn am lauen Maiabend das Licht im Garten angesteckt wurde, dann kletterte wohl einer der Jungen auf einen der Bäume und freute sich der malerischen Lichtwirkung von oben her.
Häufig kamen Gäste in Haus und Garten. Wenn die Apfel- und Birnenbäume in voller Blütenpracht standen, erschienen sie, um sich nach echter Dresdner Art an der „Blut“ zu erfreuen. Die gastfreie Familie sah aber das ganze Jahr hindurch Verwandte und Freunde gern bei sich, im Sommer eben im Garten. Da erschienen auch die Nachbarskinder. War Heuernte, dann lagen sie auf den Grashaufen herum, bewarfen sich mit Heu, „mauerten“ sich ein, warfen sich um und trieben allerhand Tollheiten. Ja, sie bauten sich wohl ein kleines Zimmer, schleppten für sich und die jungen Nachbarstöchter das Essen hinein und schmausten [26] lustig. Nach aufgehobener Tafel wälzten sie sich über die „Mauern“ und zerstörten mit Lust das mit Lust Errichtete. Kam die Zeit der Obsternte, dann kletterten sie auf die Bäume oder schüttelten sie; nur die Weintrauben am Hausspalier, die Feigen, die im heißen Sommer eben auch da schwollen, schonten sie, des Vaters scheu gedenkend.
1833 wurde die Wohnung, die man bis dahin im 3. Stock inne gehabt hatte, verlassen, und man zog ins erste und ins Erdgeschoß nach dem Garten zu; beide wurden durch eine Innentreppe glücklich verbunden; oben wohnten die Eltern und die Tochter; unten in alten gewölbten Räumen rechts und links von einem Gartensaale die alte Großmutter und die Söhne.
In diesen zwei Halbgeschossen haben die Eltern noch beinahe 30 Jahre gewohnt. Der Hausrat, der sie umgab, war ihnen zum Teil allmählich erwachsen, teils durch das Erbe von der alten Großmutter geworden. Im Wohnzimmer Mahagonisekretär, ein Pleylsches Tafelpianoforte, der runde Klapptisch am Sofa, daran ein hoher Großvaterstuhl nahe dem Ofen, auf dem einen Tritt ein bequemer Armstuhl im Stil Louis XV., Nähtisch und Vogel; zu Füßen meist der Hund gebettet; der letzte war nach der Weise jener Zeit Joli genannt. An der Wand stand in schönlackiertem, mit chinesischen Malereien geziertem Schranke eine alte Uhr, zu London gefertigt, hinter feingeschliffenem Glase. In der „guten“ Stube die „Glasetagere“ mit Silber-, Glas- und allerhand Ziergeräten; an den Wänden beider Zimmer die Familienbilder. Im Zimmer des Kämmerers sein Kirschbaumrollpult und ein behagliches Sofa. Im Schlafzimmer und in einem Beiraum aber standen schöne alte Nußbaumschränke und -kommoden mit goldbronzierten Griffen und Schlüsselschildern aus der besten Zeit des Rokoko, Überreste von der Einrichtung Christian Friedrichs, des Königlichen Münzscheiders. Auf einen lackierten chinesischen Schrank mit großen Flügeltüren und vielen Kästchen hatte es der Jude Meyer abgesehen; er kam von Zeit zu Zeit „nachzufragen“ und scheint ihn doch der Großmutter abgeschwatzt zu haben, denn er ist frühzeitig verschwunden. Mit dem klugen Händler ließ sich wohl der älteste Sohn in Gespräche ein und erfuhr von ihm manches Gute über die Art, wie diese damals [27] kleine Gemeinde ihre Kranken und Armen zu stützen wußte. Jeder wohlhabende Jude muß durchschnittlich jedes Jahr 120 Tlr. zur Erhaltung der Armen beitragen. Ein jeder unverheirateter Kranker erhält wöchentlich 3 Tlr. Der Fleischer muß, ehe er einen Ochsen schlachtet, 3 Tlr. 8 Gr. und bei einem Kalbe 16 Gr. in die Armenkasse geben. Von diesem Gelde werden Jungen, deren Eltern es nicht daran wenden können, in die Lehre geschickt, so daß sie jetzt einen Jungen Instrumentenmacher, zwei Schneider und Mechaniker werden lassen. „Ich lernte sie“, so schließt er, „nach ihren Einrichtungen achten.“
Wie sich's die Familie nun eingerichtet hatte, benutzte sie mehr und ungezwungener als bisher in der guten Jahreszeit den Garten, auf dessen schmalen Wegen die heranwachsenden Knaben, die Jünglinge, mit ihren Freundinnen, die im Hause harmlos heiter verkehren durften, in hellen und in schummerigen Stunden hin und her wandelten. Da die Mutter, deren Harfe ich im Winkel des Lusthauses noch habe stehen sehen, diesen Raum besonders liebte, ihn wohl auch einmal durch einen der Söhne tapezieren ließ, nannte man's ihr zu Ehren „Emiliensruhe“. Selbstverständlich mußten die Söhne im Garten und im Hause ordentlich mithelfen. Hingen die Bäume voller Pflaumen, dann wurden sie tüchtig geschüttelt, und abends gab es Pflaumensuppe oder Erdäpfel (auch Erbern, d. i. Erdbirnen genannt) mit gerösteten Pflaumen. Ebenso halfen sie beim Bier- und Weinabziehen, spülten wohl auch einmal ein Faß im Hofe gehörig aus.
Vier Kinder wuchsen allmählich in Haus und Garten heran: Julius Wilhelm, geb. 28. September 1813, Gustav Heinrich, geb. 8. Dezember 1815, Hermann Moritz, geb. 1. November 1819, und die besondere Familienfreude, das Töchterchen Anna, geb. 24. Juli 1824. Lange schloß sich außer der Großmutter Winkler auch die Schwester der Mutter, Auguste Winkler,[13] an. Ein junges Mündel, Caroline Geißler, half den Frauen bei der Pflege der Kinder und bei der Führung des Haushalts. Einen Blick in die Häuslichkeit der Familie Rachel bietet ein lustiges Abc-Buch, das die Tochter eines Familienfreundes, Luise Schrödel, [28] mit biedermeierlichen Bildern ausgestattet hat, zu denen der Hausfreund selbst die Fibelverse gedichtet hat. Die bescheidene Zimmereinrichtung jener Zeit, die Tracht des Hausherrn, seiner Frauensleute und seiner Kinder sind mit großer Treue wiedergegeben. Verse, wie „des Lebens Mühen und Verdruß versüße dir dein Julius“, oder „Gott segne deiner Ehe Nest, das schon zwei Junge sehen läßt“ zeigen den herzlichen Ton, der in diesem kleinen Spiegel des täglichen Lebens herrscht. Es verging kein 15. Februar, an dem nicht, da es der Geburtstag des Familienhauptes war, irgendeine kleine poetische oder zeichnerische Huldigung gebracht wurde. Die zahlreich vorhandenen Gedichte, von bunten, „marmorierten“ oder allerhand merkwürdig verzierten Bogen umhüllt, zeugen natürlich mehr von liebevoller Gesinnung, als von dichterischer Leistung.
In den Jahren, in denen die Kinder noch klein waren, nahm der Vater sie gern mit, um ihnen besonders lehrreiche oder fesselnde Dinge zu zeigen; so im Jahre 1824 einen Elefanten, der in einer Bude zu sehen war.[14] Am 3. April 1825 ging er mit ihnen vor das Schwarze Tor, wo sie ein Bärenführer sehr ergötzte. In der Harmonie bewunderten die Kinder „die Künste eines französischen Jongleurs“. An einem Feiertag wanderte man in eine Bude mit Wachsfiguren. Später, als die Kinder schon verständiger waren, sahen sie sich mit dem Vater „panoramische“ Gemälde an, die ihnen Wien, Padua, Venedig, Rom, Neapel und Pompeji zeigten.
So lange die Kinder noch nicht weit laufen konnten, wurde dann und wann ein Fiaker genommen und nach nicht allzu weit gelegenen Punkten, so nach dem Bautzner Chausseehaus (Ecke der neuen Radeberger Landstraße, jetzt abgetragen) oder auf Reisewitzens (an der Weißeritzbrücke in Vorstadt Plauen einst gelegen) gefahren. Doch ging es auch weiter hinaus: bis Golberode, bis Pillnitz. Hier besahen sie sich das nach dem Brande 1818 zum Teil neu aufgeführte Schloß, insonderheit die Hofküche; ja, [29] sie hatten die „große Freude“, „die Herrschaften“, an ihrer Spitze den würdigen König Friedrich August den Gerechten, zu einer Lustfahrt in die jedem alten Dresdner denkwürdige venetianische Gondel steigen zu sehen!
Weitausschauender war schon eine Fahrt mit Inspektor Blochmanns in Posthalters Wagen nach Großsedlitz. Die Kinder wurden – es war frisches Wetter – gut eingepackt, und so ging es gegen 12 Uhr fort. „Es war sehr hübsch im Sedlitzer Garten, ungeachtet er in einem altfranzösischen Style etabliert ist. Allein es ist ein so hoher Styl, daß man Respekt für den Erfinder haben muß“. Dem Vater, dem Freund der Landesökonomie und des Gartenbaus, machten die „pomologischen“ Anlagen des braven Hofgärtners besondere Freude. Nach herrlicher Abendfahrt kamen alle um 10 Uhr glücklich wieder heim.
Auch der Winter brachte allerhand Freuden für große und kleine Kinder. Einmal halten die „hiesigen Herrschaften“ eine brillante Schlittenfahrt ab. Alles steht auf den Straßen und sieht zu. Den Kindern wird abends die Laterna magica mit neuen „Gläsern“ vorgeführt. Schon die Verdunkelung des Zimmers läßt die Spannung gewaltig wachsen. An einem anderen Abend, es war der Geburtstag des Julius, der früh einen „Parapluie und eine französische Grammaire“ erhalten hatte, führte die liebe Mutter den Kindern „mit neuen Acteurs und Actricen“ eine Puppenkomödie auf.
Die „Comödie“ d. h. das Puppentheater war 1820 für 10 Tlr. 8 Gr. zu Weihnachten gekauft und geschenkt worden. Regelmäßig wurden auch neue Bilderbogen für die „Bildermappe“ gekauft. An ihnen haben sich noch die Enkel zwischen 1850 und 1860 erfreuen dürfen, wenn sie bei den Großeltern zu Besuch waren. Erinnerlich sind mir sehr bunt geratene Bilderfolgen: die Zauberflöte, der Freischütz, die weiße Dame; eine andere zeigte das rührende Schicksal der beiden federgeschmückten Wilden „Guma und Lina", verfolgt von den Weißen, gerettet durch gute Menschen. Interessant sind noch heute Abbildungen biedermeierlicher Zimmer- und Kücheneinrichtungen oder von Damen, die in schöner Winterkleidung zur Kirche gehen, gefolgt von der Dienstmagd, die den „Gluthund" nachträgt, das Kohlenbecken, [30] auf das sie im kalten Kirchenraum die Füße stellen. Den Kindern wurden auch ausgezeichnet hergestellte Tierfiguren geschenkt, weder so roh und plump, wie die Erzgebirgische Dutzendware, noch so seltsam, wie die durch die neueste Kunstbewegung empfohlenen Gestalten. Sie waren, obwohl schon um 1825 gekauft, noch 1860 vorhanden und in gutem Stande.
Bei diesem schlichten Leben, das der wackere Mann in den täglichen Niederschriften festhält, zeigt er eine wahrhaft dankbare Gesinnung. Aus einfachsten Verhältnissen ist er zu Ansehen und einem gewissen Wohlstand gelangt. Bei besonderen Vorfällen kommt ihm das so recht zum Bewußtsein, und es drängt ihn, dies in seinem Tagebuche auszusprechen.
So schreibt er, als er seinen ältesten Knaben mit 61/2 Jahren am 14. Februar 1820 zum ersten Male zur Schule führt: „Nach 9 Uhr gingen wir, mit dem Segen der Mutter begleitet, aus dem Hause. Inniger Rührung und des heißesten Dankes voll ging ich auf der Gasse mit dem guten Julius bei sehr heiterem Wetter und blickte oft auf den wolkenlosen Azur, um dem himmlischen Vater so recht aus voller Seele zu danken für das unendlich viele Gute, das er uns bisher erleben ließ. Welche Masse von Betrachtungen liegt zwischen meinen Schuljahren und dem ersten Eintritt meines ältesten Knaben in die Schule! – Ich übergab Julius dem Schulrath Günther, der ihm seinen Platz zwischen zwei hübschen Knaben anwies. Er hatte zu seinem Anfange auf einer Schiefertafel Parallellinien zu malen. Um ihn zu ermuntern, kaufte ich beim Conditor nachher eine Zuckerdüte und trug sie dem Schulrath heimlich hin, damit sie ihm dieser zur Belohnung geben konnte. Beim Nachhausekommen traf ich die gute Emilie eben so gerührt an, wie ich es war, und vereint stiegen unsere stillen Gebete zu Gott empor für die fernere Erhaltung unserer Kinder.“
Diese dankbare, fast feierliche Stimmung dauerte bei ihm noch am nächsten Tage an; es war sein Geburtstag und zugleich Fastnachtsdienstag; so wurde denn der Tag besonders gefeiert. Die Personen seines Haushaltes, Verwandte und Freunde gestalteten den Tag so festlich wie möglich, durch Geschenke, Gedichte und Trinksprüche. Nach heiterem Mittagsmahle und Kaffee ging [31] er, ehe die Gesellschaft sich von neuem zum Abend versammelte, in der Stille fort, über die Brücke bis ans Schwarze Tor für sich allein spazieren. „Die herrliche Sternennacht zog meinen Geist in die höheren Gefilde. Feierlich glänzten der Orion, der Sirius, die Zwillinge, in deren Nähe Mars rötlich prangte, zu mir herüber und erschienen mir als Bürgen der ewigen Vaterliebe. Ich war fast der Welt entrückt und schwelgte im Anschauen des prachtvoll gestirnten Himmels. Betrachtungen mancher Art, besonders über die Art des Fortlebens nach dem Tode, erfüllten mein Gemüth, und so war ich unbemerkt wieder nach Hause gekommen. Hier präparierte ich nun aus selbst mitgebrachten Ingredienzien einen Punsch. Nach fröhlichem Abendessen setzten wir uns zum Punsche den Tisch an den Ofen und uns traulich um selbigen herum.“ Daß dieser gemütvolle väterliche Sinn auf die heranwachsenden Kinder starken Einfluß haben mußte, ist erklärlich. Wie er, haben sie alle von einem gewissen Lebensalter an Tagebuch geführt. Vieles von dem, was bisher erzählt wurde und noch zu erzählen ist, geht auf diese Tagebücher zurück.
Der Vater hat nach und nach leider nur immer kürzer werdende Notizen gemacht, oder bald ganze Jahre garnichts mehr eingetragen. Selbst über die schweren Erfahrungen, die er 1848 und 1849 machen mußte, schweigt das Tagebuch. Da er zu den konservativen Mitgliedern des Rates gehörte, wurde er in der Zeit der stürmischen politischen Bewegungen vielfach angefeindet. Als er in den Maitagen 1849 pflichtgemäß trotz der Bitten der Seinigen aufs Rathaus ging und von da ergebnislos zurückkehrte, wurde er von den aufgeregten Volksmassen beleidigt, ja schwer verletzt. Beim Überschreiten einer entstehenden Barrikade, die ihm den Heimweg erschwerte, gerieten einige Steine ins Rutschen. Sogleich warf man ihm vor, er wolle die Barrikade demolieren, beschimpfte, schlug ihn und warf nach ihm mit Steinen. Er wurde von mitleidigen Personen hinweggeführt, auf eine Bahre gelegt und so über die Mauer seines Gartens in sein Heim geschafft. Auch darüber schweigt er in seinem Tagebuche. Ganz anders die Söhne, die sich gern, auch über Unbedeutendes, verbreiteten. Sie machten sich zunächst wohl auch nur kurze Notizen, arbeiteten solche aber im Laufe der folgenden [32] Tage, ja Wochen, aus und schrieben sie auf gutes Papier, das sie sich selbst zu Heften zurechtmachten. Später ließen sie diese Lagen binden und lasen oft nachträglich darin. Wenn sie zu jemand besonderes Vertrauen faßten, ließen sie ihn in dem Geheimbuche ihres Lebens lesen. Ließen sie es unverwahrt liegen und machte sich ein Bruder oder ein Besuch darüber und erfuhren sie dies, so zürnten sie gewaltig. Freilich nahm sich der Vater zuweilen heraus, darin zu blättern und zu lesen; erfuhr er dabei irgend einen Streich, eine Dummheit, eine Willkürhandlung, so gab es für den Tagebuchschreiber einen entsprechenden Putzer.
Die drei Brüder, zwei Kreuzschüler und dann Studenten, einer Techniker, haben dies mehrere Jahre hindurch treulich getan und dadurch manches vom Kleinleben der Familie, der Schule und der Stadt festgehalten; von geringerer Bedeutung sind die Eintragungen der Schwester; sie behandelte häusliche Dinge, den Gang zur Kirche, in der sie die Predigten in ihren Hauptteilen festzuhalten suchte. Außerdem beschäftigten sie ihr körperliches Ergehen und kleine oder größere Herzensnöte.
Doch ehe aus den Tagebüchern der drei Söhne erzählt wird, möchte ich aus dem Ausgabebuch des Buchhalters und Kämmerers Rachel, das er von 1819 bis zu seinem Tode 1861 geführt hat, für die Jahrzehnte 1820–1840, hier und da auch für später, einiges berichten. Es wird dies nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft lebende Dresdner interessieren.
Bei der Fülle der Einträge in das von 1819 bis 1861 geführte Ausgabebuch können nur einige wesentliche Punkte hervorgehoben werden. Solange er noch nicht Besitzer des Hauses war, in dem er wohnte, zahlte er für ein geräumiges halbes Stockwerk 60 Taler. Als er sich als Besitzer mehr ausbreitete, rechnete er sich seine Wohnung erst 150 Taler, später 200 Taler an. Für die Wirtschaft gab er jahrelang monatlich 40 bis 50 Taler aus. Doch schaffte er nebenbei manches an, etwa 1/4 Zentner Kaffee (für 6 Taler), ein Reh (3 Taler), „Schweinewildpret“, Hasen, Rebhühner oder einen Schinken (1834 1 Tlr. 20 Gr.). Der Lohn der Magd betrug in den zwanziger Jahren 3 Taler vierteljährlich; Mitte der dreißiger Jahre steigt er auf [33] 4 Taler; dabei werden ohne Aufbesserung zu Weihnachten jahrelang außer einigen Sachen 10 Taler gespendet. Damit mußten sich die Mägde, deren Namen sehr patriarchalisch mit Jule, Lore, Hanne gebucht werden, begnügen. Jahrzehntelang hatte er auch einen Wichsier, eine Art Faktotum, für 1 Tlr. 8 Gr. monatlich in seinen Diensten.
Zu den Ehrenausgaben sind schon damals zahlreiche Vereinsbeiträge zu nennen: Gewerbeverein, Blindenverein, evangelischer Schulverein, Verein für Dienstboten, Kranken-Hilfsverein, Evangelische Freischule, Verein für Entlassene, Camenzer Stift u. a. Immerhin nicht zu vergleichen mit dem, was schon in Friedenszeiten ein Mann seiner Stellung jetzt in Dresden zu leisten hat. Die Steuern für Stadt und Staat erscheinen als nicht beträchtlich; 1836 hatte er 47 Taler Personalsteuer und 47 Taler für sein Grundstück zu zahlen. 1840 hatte er nur 41 Taler für sich, 33 Taler für das Haus zu entrichten. Von 1847 an beginnen die Steuern rasch zu steigen; 1848 nennt er zum erstenmal eine Einkommensteuer. In der stilleren Reaktionszeit sinken die Steuern wieder und betragen 1856 annähernd insgesamt nur 80 Taler. Man kann nicht sagen, daß dies eine hohe Belastung war.
Ziemlich hoch kam die Heizung zu stehen, da er noch lange Jahre an der Holzfeuerung festhielt. Jahrzehntelang wurden beträchtliche Mengen Klaftern oder Schragen weiches oder hartes Holz angeschafft; etwa 3/4 Holz-, 1/4 Kohlenfeuerung war das Verhältnis. Ein Fuder Steinkohlen, Plauensche, zu 6 Tonnen gerechnet, kam in den dreißiger Jahren auf 4 Tlr. 16 Gr. zu stehen. Später, als Gaserzeugung in Dresden eingeführt war, wird wohl auch „Kooks“ genannt, aber in geringen Mengen. Durchschnittlich kam ihm die Heizung seiner mittelgroßen Wohnung auf 75 Taler jährlich zu stehen.
Für die Kleidung der Frau waren Jahrzehnte hindurch ohne Erhöhung 5 Taler monatlich angesetzt; doch erhielt sie zum Geburtstag und zu Weihnachten besondere Stücke, oft von höherem Wert, geschenkt, z. B. Pelzstücke, ein Gros de Naples, ein Saloppentuch. Gab er doch noch lange außer ihr seiner lieben Schwiegermutter und der treuen, bei ihm lebenden Schwester der Frau bis zu ihrer Verheiratung eine gewisse Summe zur Bestreitung [34] ihrer Bedürfnisse. Auch ihnen stiftete er besondere Stücke; so hat er der Schwiegermutter die Fältelhaube, in der sie uns so gemütlich ansieht, für 3 Tlr. 22 Gr. gespendet! Hie und da erscheint auch ein Felbelhut für eins der weiblichen Mitglieder der Familie.
Er selbst mußte für sich als Staatsbeamter, der oft mit den höchsten Beamten zu tun hatte, und später als zweites Mitglied des Ratskollegiums auf gute Kleidung halten. So fehlt es denn nicht an häufigen Einträgen über neu Beschafftes, wobei Stoffnamen erscheinen, die unsere Zeit kaum mehr kennt. Er kauft sich nach der Weise jener Zeit den Stoff beim Tuchhändler selbst: blauen Berkan, braunen Sibirien, grau-grünlichen Casimir, Köpertuch zu Pantalons, Kattun zum Schlafrock; oft wird, auch für die heranwachsenden Knaben, „Nanquin“ gekauft. Auch fehlt es nicht an besonderen Namen für einzelne Kleidungsstücke: ein Makintosh, eine Twine. Die Stoffe wurden dem Schneider übergeben, und nach einiger Zeit wird das Macherlohn oder, wie er oft einträgt, der Schneiderzettel bezahlt. Ein blauer Frack kommt ihm mit Stoff und Macherlohn auf 19 Tlr. 21 Gr. zu stehen. Ein Paar tüchtige Stiefel, d. h. mit hohen Schäften und von Rindsleder, kosten 3 Tlr. 8 Gr., Jagdstiefel 4 Tlr.; das Besohlen kostet 1834 19 Gr. Für seinen Hut hat er lange Zeit immer 3 Tlr. 8 Gr. zu zahlen; für die Knaben 1 bis 2 Tlr. Leinwand zu Hemden, Stoff zu Camisolen wird in ganzen Stücken gekauft. Als Besonderheiten nenne ich noch: den großen Regenschirm (es ist dies der Familienschirm der Biedermeierzeit!) zu überziehen 2 Tlr. 10 Gr. Und 1836 sind wegen der Gratulation zum Regierungsantritt König Friedrich August II. Trauerschnallen für Gürtel und Schuhe nötig (1 Tlr. 3 Gr.). Mit der Zeit, da die Söhne und das Töchterchen heranwuchsen, stiegen natürlich die Ausgaben und überschritten die 100 Taler, die eine Reihe von Jahren für seine und der Kinder Kleidung zu rechnen waren.
So gering damals das Schulgeld war, 1–2 Taler, je nach der Klasse, monatlich auf der Kreuzschule, so stiegen doch auch hier bei den drei Söhnen die Kosten. Dazu kamen Privatstunden im Französischen für alle drei nacheinander, in Mathematik und [35] Schreiben bei dem einen, der Techniker werden wollte, für Musik bei Söhnen und Tochter. Auch ist damals dem Notenabschreiber Mockwitz mancher Taler gezahlt worden; waren doch gestochene Noten sehr teuer. Ich entsinne mich, im großväterlichen Nachlasse große Stöße abgeschriebener Noten gesehen zu haben, besonders Teilstücke aus alten oder beliebten neueren Opern. Bücher wurden für die Familie selbst wenig gekauft, um so mehr für die Kinder. Die bedeutendste Ausgabe verursachte im Jahre 1829 die Anschaffung eines Reallexikons für 15 Taler, das der Primaner zu der später zu besprechenden Stunde über „Römische Antiquitäten“ und gewiß noch später zum Studium des Römischen Rechtes gebrauchen konnte.
Außer den gerade geläufigen politischen Blättern wurden die Dresdner Abendzeitung und das Stuttgarter Morgenblatt gehalten; ein stets verrechnetes Lesegeld spricht für die Teilnahme an einem Lesering.
Noch war die Zeit, in der, wer es irgend ermöglichen konnte, sich und die Seinen „porträtieren“ ließ. Ihn selbst hat Prof. Pochmann an der Künstlerakademie, ein Schüler Anton Graffs, gemalt (Titelbild), ein ansprechendes, liebenswürdiges Bild. Wenn er im Jahre 1819 einträgt, daß er dafür 24 Taler, für den Rahmen 10 Taler gezahlt hat, so möchte man vermuten, daß ihm ein Freundschaftspreis berechnet worden ist. Als Pochmann starb, vermerkte es Stadtrat Rachel in seinem Tagebuch mit den Worten: mein lieber Freund Pochmann ist gestorben. Von wem das in Königin-Luise-Tracht gegebene Bild der Gattin Emilie Salome stammt, ist nicht überliefert. Ich vermute, auch von Pochmann; es ist, weil vielleicht von ihr geschenkt, nicht vermerkt worden.
1853 ließ sich der von seinem Amt Zurückgetretene vom Lithographen Zöllner[15] porträtieren und mußte hierfür 45 Taler zahlen. 1854 steht in seinem Ausgabebuche: 40 Thaler für die Gemälde von der Mutter und mir. Ich vermute, daß dies die [36] ausgemalte Photographie ist, die von dem damals eben erst auftretenden tüchtigen Photographen Brockmann stammt, der später lange Jahre Ausgezeichnetes geleistet hat. Das Bild zeigt das Ehepaar im Alter von 71, bez. 66 Jahren. Im übrigen liest man selten von Anschaffung eines Bildes, dann und wann sind 16 Gr. für einen Kupferstich gebucht, gewiß ein Vereinsblatt oder ein Lieferungswerk. Als der von ihm verehrte Rektor Gröbel stirbt, kauft er sich für 20 Gr. eine ihn darstellende Lithographie. Von Nebenausgaben seien als charakteristisch für die dreißiger und vierziger Jahre noch die für die Neujahrsgratulanten genannt, unter denen die zwei Ausreuter des Rates, d. h. Ratsboten, der Nachtwächter, der Essenkehrer usw. erscheinen. Doch auch dem Herrn Rektor, einem oder dem anderen Herrn Magister, einmal sogar einer Frau Magister, wird zu Neujahr oder zum Geburtstag eine „Verehrung“ gespendet. Nicht zu vergessen das Holz- und Lichtgeld für die Kreuzschüler, das damals statt der Naturallieferung noch eingeführt war.
Doch zurück zu der Wirtschaftsführung in den zwanziger und dreißiger Jahren! Einen ziemlich stattlichen Posten nimmt in der Zeit, da die Kinder noch nicht so viel gekostet, der Wein ein; erst später schränkte er sich etwas ein, um dann in höherem Alter wieder behaglicher für den Weinkeller zu sorgen. Sein Haus ist zu allen Zeiten sehr gastfrei gewesen; und so erklärt es sich, daß er in den Jahren 1819 bis 1822 durchschnittlich für 130 Taler Wein und etliche Flaschen Arrak und Rum für die üblichen Geburtstags-, Fastnachts- und Silvesterpunsche angeschafft hat. Er bevorzugte Rhein- und Main-Weine; französische Weine, Burgunder werden nur selten genannt. Aber es erscheinen Erbacher, Oberingelheimer, Würzburger u. a., auch einmal vom berühmten „Eilferwein“. Den Rotwein nahm er aus dem seinem Hause damals auf der kl. Schießgasse gegenüberliegenden Kuffenhause. Diese Weine werden insgesamt in „Eymern“ und Ohmen beschafft, oft unmittelbar aus Mainz, wobei denn mancherlei besondere Zahlungen, Akzise u. dgl. zu leisten sind. Dann wurden die Gelder, die den Schrötern, den Böttchern, den Helfern beim Abziehen zu zahlen sind, gebucht. Ganz selten werden Flaschenweine gekauft oder, wie er wohl schreibt: 12 Bouteillen alten
[Bild][-] [37] Rheinwein in der Auktion bei Schönfeld ersteigert. Erst in den vierziger Jahren wird als besonderer Kauf der von Kaviar dazu erwähnt. Noch seltener wird Champagner[16] (Sillery) genannt, 3 Bouteillen zu 4 Taler. Von Bier ist in den Notizen selten die Rede; wahrscheinlich wurde dies einfache Gassenbier vom Wirtschaftsgelde bestritten. Ein oder das andere Mal wird Reinsberger Bier genannt. Später, als der Stadtrat Rachel die Waldschlößchenbrauerei mit ins Leben gerufen hatte, wurde deren Bier, und zwar eine leichtere Sorte davon, Schöps genannt, eingelegt. Zum Bier gehört nach Männerauffassung nun einmal das Rauchen! Bis in die dreißiger Jahre ist nur Tabak vermerkt, später nebenher Zigarren, schließlich nur solche. Eine regelmäßige Ausgabe verlangt die „Harmonie“, deren sehr treues Mitglied Rachel Jahrzehnte hindurch bis zu seinem Tode war.
Unverhältnismäßig teuer waren in jener Zeit Ausflüge, die etwas weiter führten, und wenn die lieben Frauen dabei waren. Eine „Fuhre“ nach dem Dorfe Rippien zur guten „Rohmfrau“ Knollin (wie gut war doch ihr Kirmeskuchen!), als es galt, Pate zu stehen, kostete 2 Tlr. 16 Gr.; nur eine Spazierfahrt auf Findlaters (erstes Albrechtsschloß) 2 Tlr.; auf den Steiger, wohin öfters gefahren wurde, 2–3 Tlr.; ebensoviel nach Kreischa; nach Pirna hin und zurück 4 Tlr.; für eine Tagesfahrt nach der Goldenen Höhe oder nach dem Rabenauer Grund 7 Tlr. Größere Reisen werden damals in Bürgerkreisen selten unternommen. In Schandau oder in Teplitz kosteten Badeaufenthalte für die Mutter etwa 80–100 Tlr.; eine Reise des Vaters nach Prag 50 Tlr. Aus der Überfülle der Buchungen seien noch hervorgehoben: eine Zeitlang jeden Monat 1 Tlr. 20 Gr. Verlust bei Kassenbilletts, als Agio bezeichnet. Das ärztliche Honorar wird nach Spezies berechnet, aber in der neuen Währung gezahlt (25 = 33 Tlr. 8 Gr.). Wenn es im Mai 1846 heißt: 7 Tlr. 5 Gr. mein Feuerzeug wiederherzustellen, so erinnert das an die streichholzlose Zeit; es war wohl ein Döbereinersches. Zündhölzchen waren zwar schon seit dem Anfang der dreißiger Jahre in Vertrieb gekommen, eroberten sich aber den Markt nur [38] sehr langsam; galten sie doch anfangs in manchen deutschen Staaten als sehr gefährlich und blieben noch längere Zeit verboten.
Genug! Der Leser darf nicht mit soviel Einzelheiten geplagt werden. Zusammenfassend sei gesagt, daß der fürsorgliche Hausvater in den Jahren 1819–1843 durchschnittlich 1 600 Tlr. für seine Familie ausgegeben und dabei nicht nur anständig, sondern recht behaglich gelebt hat; hierbei ist die Miete nicht gerechnet. Für das Haus hat er ein besonderes Einnahme- und Ausgabebuch geführt. Obwohl das Haus außer drei vollen Geschoßwohnungen auch noch im Erdgeschoß angenehme Räume und im 4. Stock eine kleinere Wohnung enthielt, zog er nicht viel Gewinn daraus.[17] Er selbst bewohnte in der Hauptzeit dieser Jahre das halbe erste und das halbe Erdgeschoß nach dem Garten zu und hatte es sich hier in 7 Zimmern, dem Garten und dem Lusthaus äußerst bequem eingerichtet; nur daß er in einer Hofstube schlief, in der jetzt niemand seines Standes den dritten Teil seines Lebens zubringen möchte. Er hatte das Haus seinerzeit mit Schulden belastet übernehmen müssen; es ist ihm wenigstens gelungen, es im Laufe der Jahre durch Zurückzahlung von Darlehen, von Konsenskapitalien, wie man damals Häuserhypotheken nannte, etwas schuldenfreier zu machen.
Ich lasse nun die drei Brüder nach ihren ausführlichen Tagebüchern hier und da zu Worte kommen.
[Bild]
[-]
[39]Julius Wilhelm Rachel.
Erstaunlich ist es, wie so ein junger Mensch damals Zeit gefunden, so ausführliche Niederschriften zu machen, alles so sorgfältig auszuarbeiten. Die hunderte von Seiten umfassende Handschrift ist mit der größten Peinlichkeit und Sauberkeit abgefaßt; sie könnte sofort in die Druckerei wandern!
Wenn ich zusammenzähle, wie oft er eingetragen hat: „ich schrieb im Tagebuche“, so muß ich sagen: er hat reichlich viel Zeit darauf verwendet. Wer möchte aber sagen, es sei rein verlorene Zeit gewesen? Er übte sich im Beobachten, im Schreiben. Weit davon entfernt, sich darin selbstgefällig zu spiegeln, wozu Tagebuchschreiberei so oft verführt, sucht er vielmehr treulich, die Erlebnisse und Eindrücke des Tages festzuhalten. Natürlich ist der holden Jugendschwärmerei viel Platz gegönnt. Harmlose Wonnen hat er während des Schreibens, hat er später beim Wiederlesen (und wie oft las er darin!) empfunden!
Um nun zusammenfassend einen Begriff von der Fülle des Niedergeschriebenen zu geben, sei gesagt: Familienleben, Bücherlesen, Theaterbesuch, musikalische Versuche, eignes Theaterspiel, der Tanz, der Ball werden besprochen. Das Leben mit den Freunden in und außer der Schule, die politischen Vorgänge in der Stadt, im Heimatland, die Aufstände in unmittelbarer Nähe und in weiterer Ferne – alles, was so einen Primanerkopf, ein Primanerherz erfüllen kann, zieht am Leser vorüber.
[40] Zunächst die Familie selbst!
Ehrfurcht und Achtung erwiesen die Söhne beiden Eltern. Im Jahre 1832 konnten sie es mit einem gewissen Stolze erleben, daß der aus einfachen Verhältnissen hervorgegangene Vater, der sich durch eisernen Fleiß selbst viele Kenntnisse erworben und sich in Nebenämtern, z. B. als Mitglied des Armendirektoriums, als Vorstand des Augenkranken-Heilvereins, sowie als Pfleger der Blinden, vor seinen Mitbürgern hervorgetan hatte, nach der neuen Städteordnung zum Kämmerer der Stadt Dresden, d. h. zum Finanzmann gewählt wurde.[18] Als diese Wahl bevorstand, bat ihn der ihm befreundete Hofrat Falkenstein, er solle nicht zu hoch fordern. Mit einem gewissen Selbstbewußtsein meinte er: „wenn die Repräsentanten (d. s. die Stadtverordneten) um 100 Tlr. knausern wollen, so sind sie nicht wert, daß ich mich zum Kämmerer hingebe.“ Sie wählten ihn nach seinen Vorschlägen 1832 am 16. Mai, an einem Tage, der 29 Jahre später sein Todestag werden sollte.
Ihm zur Seite stand die von ihm lange heiß umworbene Gattin, die Mutter der blühenden Kinder, von diesen hoch verehrt. Sie war eine begabte, geistig lebendige Frau; sie spielte hübsch Klavier, sang dazu, auch pflegte sie das Harfenspiel. Mit einem unleugbaren Geschick zeichnete sie; mancher Versuch, eine in ihrer Nähe sitzende Person durch den Stift festzuhalten, zeugt davon. Für Dichter und Dichtungen hatte sie lebhaftes Interesse, versuchte sich bei Familienfesten wohl selbst darin. Wie spannten ihre Söhne, wenn sie ihnen vom Dichter Seume erzählte, von dem sie bei einem früheren Aufenthalt in Teplitz manches gehört und gesehen hatte.
War ihr Geburtstag, dann kamen schon ganz früh Verwandte oder Freunde und befestigten an der Wohnungstür eine Blumenranke, darunter einen Kranz, worin der Name der Gefeierten auf himmelblauem Grund und von Rosen und Immortellen eingefaßt stand. Um 10 Uhr wollte dann, es war am 9. Juni 1831, einer der Söhne beim Konditor eine Torte holen;
[Bild][-] [41] sie war aber etwas schlecht geraten und wurde – noch einmal gemacht. Endlich um 12 Uhr kam sie, und bald darauf die Gäste, unter ihnen der liebe Bruder der Geburtstägerin, der Onkel Winkler, der einen schönen Spitzenkragen mitbrachte.
Eine besonders geliebte Mitbewohnerin war die teuere Großmutter, die Mutter der Mutter. In kräftigeren Jahren hatte sie noch mitgeholfen in der Wirtschaft; sie ließ sich’s auch noch lange nicht nehmen, an jedem 15. Februar dem lieben Schwiegersohne, der sie, die ihres Vermögens durch allerhand Unglücksfälle beraubte Frau, treulich erhielt, vortreffliche Festgerichte zu bereiten. Sie sind gut gewählt gewesen, die Rebhuhn-Pasteten, Muschelsaucen, italienischen Salate usw. und deuten daraufhin, daß sie einst in recht behaglichen Verhältnissen gelebt hatte.
Als sie älter wurde, flüchteten sich die Enkel gern zu ihr in die kleine Unterstube, in der sie lebte, trugen sie, da sie schwächer wurde, im Lehnstuhl in den Garten und lauschten gern ihren Erzählungen aus dem siebenjährigen Kriege. Da saß sie nun, wie sie uns das Bild von Luise Schrödel zeigt, unten vorm Lusthause oder drin in der Wohnung, mit ihren vorgesteckten Locken, das gute Gesicht von einer dicht gefältelten Haube umgeben. Bei guter Weile erzählte sie dem hochaufhorchenden Enkel von den Erlebnissen der Familie Rachel während der Belagerung von Dresden im Jahre 1760. Ihre Eltern hatten mit ihr im Hausraum und im Keller gewohnt. Vor dem Garten hatte die sogenannte Freipartei gelegen. Einige waren in dem Garten, um die unter einem Misthaufen verborgenen Koffer, die verräterisch entdeckt worden waren, auszugraben. Der Hausmann, ein Zimmermann, rennt nebst andern mit der Mistgabel hinter und sticht einen, der in den Staketen hängen geblieben, fast tot. Einmal guckt eine Waschfrau zum Boden heraus und zeigt, unvorsichtig den Arm aus dem Fenster streckend, nach der Schanze, als es sogleich donnert und das ganze Dach zusammengeschossen ward, da die Freipartei denkt, es seien Spione da.
Da die liebe Großmutter bei den Familienausflügen nicht mehr mitgehen konnte, wurde ihr zu Liebe öfters einmal ein Wagen genommen. Sonntags früh wanderten Vater und Söhne nach dem Plauenschen Hegereiter (der jetzigen Wirtschaft zum [42] Forsthaus), der damals sehr beliebt war. Die Frauen kamen mit dem Wagen nachgefahren. Man traf gute Freunde, aß mit ihnen zu Mittag, und am Nachmittage ging es wieder heim. Vater und Söhne wanderten über die Berge, die herrliche Aussicht genießend, zurück. Der Wagen brachte die Frauen und die kleine Schwester zur Stadt zurück. An Mittwochnachmittagen geht es auf den Steiger, nach dem Kaffee in einem Bogenspaziergang über Pesterwitz und Roßthal zum Steiger zurück. Nach einem kräftigen Imbiß geht es wieder nach Hause. Dort wird zur Labung noch eine Milchkaltschale genossen. Um recht schöne frische Milch zu bekommen, sendete an Wochenabenden die Mutter einen der Knaben schnell „auf Zinzendorfs“, an der ehemaligen Langegasse (jetzt Zinzendorfstraße) gelegen. War die Familie zu Verwandten, um Geburtstag oder ein anderes Fest zu feiern, eingeladen, so wurde die Großmutter in der Chaise dahingetragen. Zu häuslichen Festen war sie natürlich die Spenderin hübscher Geschenke. Schwerer befriedigte die Mutter den Geschmack des heranwachsenden ältesten Sohnes, als er seinen letzten Schülergeburtstag 1831 feierte. Sie ließ ihm 10 bis 12 Mützen zur Auswahl hinlegen. Da sie aber, wie er schreibt, alle zu „spießig“ waren, bestellte er sich selbst im Geschäft eine, die ungefähr der bald zu erhoffenden Studentenmütze ähnelte. Handelt es sich bei ihm um die wichtige Beschaffung von neuen Hosen, dann geht der Vater selbst mit ihm auf den Altmarkt und kauft den Stoff, etwa die Elle zu 5 Gr. 6 Pf., für ihn ein; er selbst trägt diesen dann sogleich zum Schneider.
Als der Herr Enkel abends einmal einschläft und, leidenschaftlich träumend, aus dem Barbier von Sevilla die Worte ruft: Hin muß ich zu ihr, der heißgeliebten, ziehn – da hat die Großmutter lächelnd gesagt: Nun ja, solches Zeug hat er im Kopfe!
Im Hause verkehrten nun, da die Söhne älter geworden waren, noch mehr als früher liebe Verwandte, Beamte und Schulmänner, der Finanzprokurator Haase, der Schulrat Günther u. a. Ein Festtag war es, wenn der lustige Onkel Zumpe oder wie es heißt: der Herr Akzisinspektor aus Neustadt bei Stolpen mit Frau und Kindern im eignen Wagen angefahren kam. Sie wurden, so gut es ging, alle beherbergt. Festliche Mähler wurden [43] gehalten, bei denen der Onkel, der nicht viel vertrug, gar bald, vom Geiste des Weines ergriffen, tolles Zeug zu schwatzen anfing. Man bereitete den Gästen ein besonderes Vergnügen, indem man sie nach dem Theater auf das Lincke’sche Bad führte und ihnen die hauptsächlich die Jugend entzückende Oper „Jacob und seine Söhne“ anzuhören bot. Beim Abschied wurden die Söhne für die Ferien nach Neustadt geladen, aber hübsch nacheinander. Am beliebtesten hierfür waren die Pfingst- und die Michaelisferien; da gab es Schützenfest mit Tanzvergnügen oder die ersten Wintertänzchen. Wie fest und treu die beiden Familien Rachel und Zumpe zusammenhielten, erhellt daraus, daß jeder bei Zumpes geborene Junge so wie der vorher bei Rachels erschienene getauft wurde, und so gab es in jeder Familie einen Julius, einen Gustav, einen Hermann!
Beim Abschied in Dresden ging es gar zärtlich zu, wenn draußen vor dem Hause die Rosse des Herrn Akzisinspektors ungeduldig scharrten. Als 1831 die Cholera ihren unheimlichen Zug durch Europa hielt, bangten die weiblichen Familienmitglieder gewaltig davor. Die beiden Frauen, die Frau Buchhalter Rachel und die Frau Akzisinspektor, sanken sich weinend in die Arme – wer wußte, ob man sich in Neustadt oder Dresden wiedersehen werde? Die Mutter sorgte in der Stille schon für alle möglichen Vorräte, denn wenn die Seuche kam, mußte sie mit allerhand Mitteln bekämpft werden – anderseits wurden die Lebensmittel wegen mangelnder Zufuhren gewiß teuerer! So kaufte sie Brotzwieback auf und allerhand Pillen und Tränkchen, daß der Sohn niederschreibt: Bei uns sieht es aus wie in einer Apotheke.
Die Gefahr, daß die Cholera verschleppt werden könnte, führte auch dazu, daß sich die Obrigkeiten der Städte von Zureisenden Gesundheitsatteste vorlegen ließen. Als der junge Kreuzschüler Michaelis 1831 nach Neustadt bei Stolpen wandern wollte, holte er sich ein solches auf dem Dresdner Rathaus und legte es auf dem Rathaus zu Neustadt vor. Er verleibte es als eine wichtige Urkunde neben kleinen Bildern, Blumen und Blättern dem geliebten Tagebuche ein.
Unter den von auswärts kommenden Gästen wird auch gern ein ehemaliges Mündel des Buchhalter Rachel genannt, [44] der nachmalige Pastor Geißler zu Gränitz im Gebirge. Er war einige Zeit Hauslehrer des ältesten Sohnes gewesen, dem er beim Abschied Gellerts geistliche Lieder geschenkt hatte. Auf einer der bescheidensten Pfarren Sachsens saß er und war mit der Zeit ein etwas wunderlicher, aber sicherlich dabei höchst gemütlicher und lustiger Herr geworden. Über seine Erlebnisse auf der Pfarre, über seine Kämpfe mit den halsstarrigen Bauern haben die jungen Leute oft gelacht, während der Vater geradezu aufgebracht wurde. Einige Szenen schildern sie sehr lebendig in ihren Niederschriften. Im Pfarrhause war zweimal hintereinander der Ofen eingefallen; in seiner Angst hatte der Pfarrer, um das Feuer zu löschen, alles Geschirr, alle Milch-, Rahm- und Käsetöpfe hineingeworfen. Einstmals ging die Familie Rachel mit ihm, der zu Besuch war, nach dem Großen Garten. Im Scherz fuchtelt der Familienonkel Winkler mit seinem Stock herum. Da ruft der kleine Pastor Geißler erschrocken: Schlagen Sie mich kleines Davidchen nicht!
In der guten Jahreszeit war, wie begreiflich, der Sonntag gemeinsamen Ausflügen gewidmet. Vater und Söhne gingen in die Umgebung der Stadt; beliebt war der Gang an Antons Garten hin (d. h. der Garten des Prinzen Johann Georg jetzt), den Weidenweg am Kaitzbach bis zum Roten Hause vor Strehlen; über die Höhen von Zschertnitz und Räcknitz wurde oft gewandelt. Hinter Moreaus Denkmal zeigte der Vater den Söhnen wohl die Dresdner Weichbildgrenze. In Räcknitz trank man vorzüglich mundendes Medinger Doppelbier. Über Leubnitz (nach echt Dresdner Sprechweise Leimnitz geschrieben!) hinaus sind sie nur selten gekommen; einmal sahen sie nahe diesem damals still gelegenen Dorfe einen aufgedeckten Fuchsbau. Als sie einst von der Grünen Wiese nach Reick zu gingen, erblickten sie „rechts bei dem großen Sumpfe“ Wasserhühner und Kiebitze. Über Mockritz zurückkehrend, bemerkten sie mit Bedauern, daß die Reben im Weinberg bei Klein-Pestitz, an dessen Winzerhäuschen (neben „Café Weinberg“) heute noch als Wahrzeichen Kaleb mit der großen Weintraube zu sehen ist, erfroren waren. Die Söhne allein sind einmal bis Lockwitz gelaufen und von da wieder nach Dresden zurück; stolz verschmähten sie einen Sitz [45] im Wagen des Hofrat Pienitz, den die Eltern benutzen durften. Mit Vorliebe wandte man sich dem Plauenschen Grunde zu, der damals noch frei von Fabrikrauch war. Wie beim Hegereiter so auf der damals gerade eröffneten Grassi’schen Villa (jetzt Gebiet des Felsenkellers) verweilt man gern. Der Vater verband mit solchen Wanderungen auch gern die Besichtigung interessanter und lehrreicher Einrichtungen.
Am Pfingstsonntag 1831 weckte er seine jugendliche Gesellschaft, um sie zunächst einmal draußen vor der Stadt die Kanonenschüsse hören zu lassen, für jeden Dresdner damals eine wichtige Sache! An der Annenkirche kauften sie sich Semmeln. Als sie kurz vor Reisewitzens waren, hörten sie den ersten Schuß vom Dresdner Pontonschuppen her, dann die drei Königsteiner Schüsse. Nun sahen sie sich den Sonnenaufgang an und waren, wie der junge Mensch schreibt, „in diesen herrlichen Anblick ganz verschwunden“. Sie erklommen hierauf die Pesterwitzer Höhe, besuchten die zum Heben der Schachtwässer vom Kaufmann Meisel aufgestellte Dampfmaschine und ließen sich solche von einem Bergmanne erklären. Gleichzeitig standen Bergstudenten aus Freiberg dabei, die dies neue Gerät kennen lernen sollten. Kaufmann Meisel, ein Mann von eigenen Gedanken, ist später Stadtverordneter geworden und hat, wie die Akten des Ratsarchivs beweisen, die damals ganz mangelhafte Buchführung auf dem Rathaus durch die Einführung der doppelten italienischen wesentlich zu verbessern versucht. Er hat aber einen langen Kampf kämpfen und die Überlegenheit dieser Methode über die ältere, einfachere in zahlreichen Eingaben nachweisen müssen, ehe er sein Ziel erreichte.
Ein andermal führte der Vater die Söhne nach einem neuen Weißeritzdurchstich. Als er später Stadtkämmerer geworden war,[19] tat er manchen Gang, um sich zu überzeugen, ob städtische [46] Einrichtungen so, wie beschlossen war, getroffen worden und[WS 1] in gutem Stande waren. So bestieg er einmal mit ihnen, Donnerstag den 9. Mai 1833, nachmittags, den Kreuzturm und ließ die auf dem Turme angebrachten Spritzen probieren. Dann besuchten sie den alten Türmer, und endlich erstiegen sie den Ort, wo die Uhrschellen sich befinden, und warteten, bis es 3/4 4 und 4 Uhr schlug.
An den Wochentagen wurden nahgelegene Punkte aufgesucht: der Große Garten und seine Rügersche Wirtschaft (jetzt die alte Wirtschaft zum Zoologischen Garten), in der damals eine Gruppe tüchtiger Bürger aus verschiedenen Ständen regelmäßig gegen Abend oder später verkehrte. Man rastete wohl auch bei „Cagiorgis“, jetzt die Torwirtschaft; oft ging es auch zu Findlaters, jetzt das erste Albrechtsschloß. Wie einfach ging es bei solchem Wirtschaftsbesuch zu! Oft wurde nur eine „labende“ Semmelmilch, kein Bier, genossen. Die Knackwürstchen schmeckten oft so gut, daß der Vater, z. B. von der Grünen Wiese, der Mutter „eine Schnur“ mit nach Hause nahm. Lange Jahre lag er mit Dresdner Freunden auf südlich und südöstlich von Dresden gelegenen Fluren der Jagd ob. Sein Jagdfreund Kaufmann E. R. Treutler ließ sich und ihn beim Jagdfrühstück im Walde ruhend abmalen.
In der Mitte der dreißiger Jahre pachtete sich der Vater in der Nähe des Marcolinischen Jagd- oder Waldschlößchens, das ja noch steht, in der Heide einen Stand zum Vogelfang, einen Vogelherd, den ich – es war ein eirunder, von nicht zu hohen Bäumen umgebener Platz – vor 1866 noch gesehen habe. Oft ging er noch in nächtlichem Dunkel mit den Söhnen oder ohne sie hinaus, um Singvögel zu fangen, die dann wohl auch zum Teil im Hause gehalten wurden. Ein junger Raubvogel hüpfte lange im Garten am Haus umher. Es war eine Rickelweihe, dem sie Sperlinge zu fressen gaben. Manchmal lassen sie ihn am langen Strick hoch steigen und ziehen ihn wieder herunter, ein Spiel, das an das Bild von Rubens’ Söhnen erinnert, deren einer einen Stieglitz am Faden flattern läßt. In jenen Zeiten war der Vogelschutz noch wenig oder gar nicht entwickelt. Entsinne ich mich doch, daß noch vor 55 Jahren Leipziger Lerchen [47] gebraten wurden. Die alte Dienstmagd unserer Großmutter briet uns gelegentlich Sperlinge, und noch vor 50 Jahren erlegte sich auf dem stilleren Teile der Schloßstraße ein Polytechniker durch geschickten Stockwurf herumhüpfende Spatzen, die er in die Rocktasche schob, um sie sich zu Hause braten zu lassen!
Im Hause auf der Schießgasse vor 80 Jahren fehlte es auch sonst nicht an Getier: ein Hund wurde beständig gehalten. Lange hielten sie sich auch im Garten einen jungen Hasen, dessen Fütterung, dessen Herumlaufen und dessen gelegentliches Verschwinden die Söhne lebhaft beschäftigte.
Manchen Sonntagvormittag ging die Familie in die Kirche, und sehr offen vor sich selbst schreibt Julius in sein Tagebuch: „es war eine sehr gewöhnliche Predigt bei Güldemann, dem Superintendenten an der Kreuzkirche“; oder er äußert sein Wohlgefallen an der Predigt des noch heute in Dresden-Neustadt unvergessenen Pastor Schmalz, der sich über das Wort verbreitete: Der Gottesfreund auch ein Menschenfreund! Am Reformationstag hört der Primaner eine Predigt Ammons, der einen Vergleich zwischen katholischer und protestantischer Geistlichkeit zieht, in jenen Zeiten der starken Jesuitengegnerschaft natürlich zugunsten der letzteren. Der junge Mann nimmt an diesem Tage das heilige Abendmahl und bittet im Geiste sein geliebtes Mädchen um Verzeihung für alle Beleidigungen, die er ihr etwa zugefügt hat. An einem sehr kalten Himmelfahrtstage wandern sie zu Mag. Böttcher in die Waisenhauskirche (damals am Jüdenteich, dem jetzigen Georg-Platz stehend), und als sie etwas ausgefroren zurückkehren, gibt es ein Glas Glühwein.
Gern bespricht der Sohn die Geburtstagsfeiern der Eltern im Hause. Der 15. Februar, der Geburtstag des Vaters, wurde bei heranwachsenden Jahren der Söhne von ihnen selbst mit „Aufführungen“ gefeiert. Ganz biedermeierlich mutet es uns an, wenn wir vom 15. Februar 1832 lesen: Es wurde ein Altar mit Opferfeuer errichtet. Die Jugend stellte sich in Schweizertracht darum und sang nach einer Arie aus Rossinis Tankred: „Tanti di palpiti“ mit untergelegtem Text ein Huldigungslied. Eine Soloarie nach einer Melodie in P. v. Winters „Unterbrochenem Opferfest“: „Wenn Siegeslieder tönen“ folgte. Ihr schloß sich ein Tanz [48] lustig gemalter und phantastisch gekleideter Puppen an. Einer der begabtesten Freunde des Sohnes, der Primaner Gustav Blöde, erschütterte alsdann die Gesellschaft durch den Vortrag des großen Monologs aus Faust.
Zum Schluß, als die Stimmung schon erhöht war, wurde Tierbude gespielt, wobei die Unkundigen vor dem verhüllten, dann aber gelüfteten Spiegel Forderungen derber Art stellten, die sie denn durch das Spiegelbild ihres eignen Gesichtes zu allgemeinem Gelächter selbst befriedigten.
Auch am Geburtstag der lieben, alten Großmutter wurden ihr von Freundinnen oder von der Tochter Blumen- oder Obstkränze an die Stubentüre gehängt.
Der Sinn für freundliche Überraschungen wurde bei der Jugend gepflegt. Das Ölbild des Vaters, von Prof. Pochmann gemalt, das der Mutter, das Pastellbild der Großmutter hatten herzliche Freude bereitet. So ließen sich denn nun auch die zwei ältesten Söhne in Pastell malen. Der Kreuzschüler lief mit übergeworfenem Mantel in seinem neu geschenkten Schlafrock, den er einmal einen Warschauer, dann wieder einen Kaftan nennt, von der Schießgasse bis nach der Reitbahnstraße, um sich darin verewigen zu lassen. Der zweite ließ sich als junger Feldmesser abkonterfeien. Eine Hauptfreude aber empfanden die Eltern, als ihnen das Bild der einzigen, inniggeliebten Tochter beschert wurde.
Nicht nur an Festtagen verkehrten die Freunde zwanglos bei Mittags- oder Abendtisch im Hause: es ging überhaupt sehr gastlich zu, und am späten Abend mußten die Söhne Besucherinnen nach Hause geleiten. Am 18. September 1831 ging einer von ihnen aus der inneren Stadt hinaus nach der Neuen Gasse mit der Laterne, die noch dazu vom heftig wehenden Winde ausgelöscht wurde.
Was während des Tischgespräches interessierte, das buchten die jungen Leute. Wie oft sprach der Vater über der Welt Lauf, über die Revolution in Polen, die Gesundheitszustände anderer Städte, über aufregende Begebnisse in der eigenen Stadt. So schrieb einer der Söhne, mächtig ergriffen, die letzten Worte eines damals in der Gesellschaft sehr beliebten Leutnant P., der
[Bild][-] [49] sich erschossen hatte, in sein Tagebuch: Meine Gesundheit ist zerrüttet, mein Gewissen ist verletzt. Grüßt meine angebetete Braut und verehrte Schwester und – lebt wohl!
Fast noch ausführlicher, als über das Familienleben, handelt das Tagebuch über das Leben auf der Kreuzschule in den Jahren 1831 und 1832.
Die alte, ehrwürdige Kreuzschule, von der aus den Jahren 1300 und 1334 schon einige urkundliche Nachrichten überliefert sind, hatte sich aus einer Lehranstalt für Chorknaben zum Gottesdienste in der Reformationszeit zu einer öffentlichen lateinischen Schule für Elementarunterricht und Gelehrsamkeit entwickelt. Sie ist sich in ihrem Bestande und ihren Unterrichtsstoffen bis zum Anfange des neunzehnten Jahrhunderts mit Vorzügen und Mängeln gleich geblieben. Daß es um die Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert mit der Verwaltung des Alumneums, wie mit dem Unterricht der aus der Stadt kommenden Schüler gerade übel genug stand, erhellt aus der naiven Selbstbiographie eines ihrer damaligen Lehrer, des Tertius Heyder. Sagte ihm doch bei seiner Anstellung als Inspektor des Alumneums der Superintendent Tittmann: „Sie wissen, wie verwildert alles drüben aussieht; ich introduciere und schütze Sie.“ Die äußeren und inneren Verhältnisse der Schule riefen laut nach einem Reformator. Und dieser wurde ihr 1816, als Ernst August Gröbel aus Flemmingen in Thüringen – eine halbe Stunde von der Schulpforte, die er auch als Schüler besuchte – ihr Rektor wurde. Wohl war er als letzter in seiner Art in Leipzig als Theologe ausgebildet worden; aber unter dem berühmten Philologen Gottfried Herrmann war er ein Freund des Altertums geworden und ein begeisterter Lehrer der Jugend im Verständnis der alten Sprachen und des Geistes der Alten.
„Dieser hellsehende, zum Direktor wie geschaffene Mann sah die Mängel der Kreuzschule gar bald ein, und von ihm war eine Totalreform vorauszusehen. Als eine alte Stiftungsschule, halb öffentlichen, halb privaten Charakters, mit kümmerlich bezahlten Lehrern übernahm er sie, als ein modernes Gymnasium, als eine wirklich öffentliche Lehranstalt übergab er sie 32 Jahre später seinem Nachfolger. Ein festes und von tüchtigen Kräften [50] gebildetes Kollegium stand ihm in diesen Jahren zur Seite; gegen 200 Schüler besuchten die Schule, als er sie übernahm, über 400 wurden es in seiner Amtszeit.“
Der junge Kreuzschüler, der ihr 1825 zugeführt wurde, kam also in eine frische Zeit. Und so machen auch seine Aufzeichnungen einen solchen Eindruck: Trotz mancher kleiner persönlicher Mängel, die ihm aufgemutzt werden, war Gröbel ein Rektor, vor dem man Achtung, ja in besonderen Fällen auch Furcht hatte. Sein Spitzname fehlt ihm natürlich nicht. Und wenn ein solcher nicht frech gewählt ist und nicht unbescheiden angewendet wird, ist er nach der Art der Menschen und vor allem der Jugend ein Beweis eines innerlichen, gemütlich heiteren Interesses für den Mitmenschen. Gröbel hieß in den dreißiger Jahren der kleine Nieten, später nur der Kleine, wie Rektor Hultsch in seiner Gedächtnisrede über Gröbel berichtet. Er hatte einmal den Namen des berühmten englischen Naturforschers Newton falsch ausgesprochen, und das wurde ihm vor den Gymnasiasten, von denen gewiß selbst nur wenige etwas Englisch verstanden, zum Verhängnis. Als einen Beweis, wie geachtet, ja etwas gefürchtet der Rektor war, sei der Bericht über eine Urlaubserbittung eingeschaltet. Der junge Rachel wollte zu Michaelis Verwandte in der Sächsischen Schweiz besuchen und hoffte, ein paar Tage länger Ferien zu erhalten. Er wollte seine Bitte in der Schule nach einer Synode bei Gröbel anbringen. Ein kluger Mitschüler aber riet ihm, zu dieser Zeit nicht zu ihm zu gehen, da er nach der Synode mißgelaunt und hungrig sei. Er ließ es daher auf den Nachmittag. Auf dem Wege dahin meldete ihm ein Klassengenosse, der schon beim Rektor gewesen war, er sei heute sehr fidel. „Nichts erwünschter als dies. Auf der Rampischen Gasse wies mir Schneider das Haus des Rektors. Klopfenden Herzens trat ich in den Garten und ging die Treppe hinauf. Ich trampelte auf dem Vorsaal herum; niemand hörte mich; endlich sah ich einen ehemaligen Kreuzschüler, der bei der Rektorin schwenzelte. Ich wartete eine Weile; da kam es getapselt, und siehe, der Kleine tritt heraus und fragt mich: ,Was wollen Sie, mein lieber Rachel?‘ (Gutes Omen!) Ich übergebe mit gehorsamstem Empfehl vom Vater den Brief. Er liest und [51] lächelt. ‚Den 3. 4. 5., das ist also Montag, Dienstag, Mittwoch? Ist es auch notwendig?‘ Das war freilich schwer zu beantworten. Ich sagte, daß ich die Hundstage nicht hätte gehen können. ,Na, kommen Sie herein!‘ Er ging in ein anderes Zimmer, wo Mag. Wagner mit dem Studenten saß (als ich seine Stimme hörte, ward mir anders, aber nicht besser!) und kam mit der Unterschrift zurück. O, welche Wonne! Ich dankte unterthänigst; zum Abschied empfahl er mir noch, den Horaz in die Tasche zu stecken, da gleich im Anfange recitiert würde. Ich versicherte es heilig und wäre dem Kleinen lieber um den Hals gefallen. Bald wäre ich in einem Satze zur Thüre hinausgesprungen."
Konrektor war von 1816 bis 1832 Baumgarten-Crusius, geb. 1786 zu Dresden. Der pietätvolle Sinn einer seiner Söhne hat ihm ein biographisches Denkmal gesetzt, aus dem die ausgezeichnete Bildung, das bedeutende Wissen, die Begeisterung für seinen Beruf, die Beliebtheit bei den Schülern, die Vielseitigkeit seines Wesens hervorgeht. Er war nicht nur auf altklassischem Boden schriftstellerisch tätig; er hat auch erzieherische vaterländische Schriften verfaßt. Ja, er, der in Dresden mit Tieck, Tiedge, Friedrich Kind, Friedrich Laun verkehrte, hat sich auch dichterisch in mehreren Romanen versucht. Er gehörte also nicht zu den so oft mit Unrecht als weltfremd verschrienen Philologen. Für geschichtliche Vorgänge des Tages hatte er lebendiges Interesse und wußte davon auch den Schülern an der rechten Stelle vorzutragen, um sie, die heranreifenden Jünglinge, mit dem Leben zu verbinden.
Es ist erfreulich, in dem Tagebuche des Kreuzschülers, das mir vorliegt, die Charakteristik, die der Sohn Baumgarten-Crusius' von seinem Vater gegeben hat, bestätigt zu finden.
Neben Rektor und Konrektor wirkte als Tertius dem Namen nach Heyder, in Wirklichkeit war er schon so gut wie im Ruhestand; Kollege Quartus war Philipp Wagner; ihnen reihten sich an die Magister Liebel, Böttcher und Sillig.
Der Unterricht, den die Oberprimaner nur in 8 Stunden für sich, in den übrigen 19 mit den Unterprimanern zusammen hatten, war vor allem dem Latein gewidmet: 2 Stunden Horaz, 2 Stunden Extemporale, 2 Stunden lateinische Disputierübungen, [52] sämtlich beim Rektor selbst; 2 Stunden Tacitus bei Sillig, zwei Cicero beim Konrektor.
Das Griechische stand mit 6 Stunden wöchentlich hinter dem Latein zurück: 3 Stunden Herodot, 2 Aeschylus, 1 griechische Stilübungen.
Hierzu kamen 2 Stunden Literaturgeschichte, nur altklassische natürlich; 2 Stunden Religion, 2 Geschichte, 2 Mathematik, 1 Stunde Geschichte der Philosophie. 2 Stunden beim Rektor werden als Korrekturstunden genannt. Aus den Notizen des Schülers ist zu entnehmen, daß in diesen Stunden deutsche Arbeiten nach selbstgewählten Themen von den Primanern vorgelegt und sogleich vom Rektor und den Kameraden kritisiert wurden. Es waren das also die einzigen deutschen Stunden, die erteilt wurden. Außer diesen 27 Pflichtstunden gab es für die Theologen noch 2 Stunden Hebräisch und für die, welche außer dem jährlichen Schulgeld von 28 Tlr. noch 8 Gr. monatlich zahlen wollten, 2 Stunden Französisch, von Herrn Schumann-Leclerq erteilt.
Man sieht, das Deutsch steht ganz zurück, Naturwissenschaft, etwa Physik und Chemie, waren nicht bedacht. Das veranlaßte auch den Primaner, sich beim jüngeren Bruder und dessen Freund einiges in Chemie zeigen zu lassen.
Über den Religionsunterricht, den M. Böttcher gab, fällt in dem Tagebuch nicht ein Wort; er scheint also die Schüler nicht sonderlich gefesselt zu haben. Um so mehr hat die Art, wie Crusius die Weltgeschichte trieb, die Schüler stark beschäftigt. An vielen Tagen ist die Rede davon, daß Crusius Verhältnisse berührt hat, die im Augenblick die Leute beschäftigten. Es zeigt sich auch hier das so oft Beobachtete, daß der jugendliche Geist mit Freude darauf eingeht, wenn der Lehrer das rein Schulmäßige einmal beiseite läßt, Besonderes, Unerwartetes einflicht und die Jünglinge durch Besprechung dessen, was alle Gemüter erfüllt, gleichsam näher an sich heran, zu sich emporzieht.
Als sich im April 1831 in Dresden eine revolutionäre Bewegung zeigte, von der später noch erzählt werden soll, las Baumgarten-Crusius in der Prima einen Brief vor, den er mitten in der Stunde erhielt, und teilte daraus mit: Die Regierung [53] werde alles tun, wenn die Bürger ihrerseits ihre Obliegenheiten erfüllten. Des Schülers Vater meinte im häuslichen Gespräch, wahrscheinlich stamme der Brief vom Kanzler von Könneritz. Als im Hinterhause des die Köpfe vieler Dresdner verdrehenden, frömmelnden Pastor Stephan Feuer angelegt worden war und ein Schüler das griechische Wort stephanus (= der Kranz) fälschlich mit langem a aussprach, konnte sich der Konrektor eines Witzes über den Stephan, dessen Hinterteil man verbrannt habe, nicht enthalten. Und wenn er darüber klagt, daß seit der Eroberung der Gewürzinseln im fernen Ostasien die Gewürze so billig seien, daß sich jedermann ihrer bediene und sich dadurch nur die Nerven schwäche, so wird dies von Julius gebucht; ebenso die „interessante“ Mitteilung, daß Luthers Leibgericht Hering mit Erbsen gewesen sei. Als einer der Schüler, wahrscheinlich schlecht „präpariert“, greulich übersetzte, gab ihm der Konrektor mit den Worten: „Sie sind ein lächerlicher Grieche“ einen Hieb vor der ganzen Klasse, der wahrscheinlich besser gesessen hat, als ein „Eintrag“ oder dergleichen.
Mitteilungen über die Schulden, die Ludwig I. von Bayern als Kronprinz gemacht, aber als König pünktlich gezahlt habe, oder darüber, daß berühmte Geschichtswerke von Italienern nach Napoleons Sturze neu und in vollkommenerer Gestalt als früher erschienen seien, nachdem sie vorher starke Streichungen erfahren hatten, werden eingetragen. Mit großem Vergnügen hören die sächsischen Schüler die List Blüchers erzählen, der, als die französische Kavallerie, auf sächsischen Pferden reitend, habe einhauen wollen, sächsische Retraite habe blasen lassen. In der lateinischen Interpretationsstunde von Cicero's de officiis spielt er einmal auf die Weinpanscherei eines angesehenen Dresdner Bürgers an und erzählt, einem Freiberger Gelehrten sei jetzt eine Zigarre zugeschickt worden, mit der Frage, ob sie aus Tabak bestehe. Daran knüpft er den Witz, der weidlich belacht wurde, die legio, d. h. die Schülerschar vor ihm, hätte es gewiß beurteilen können.
Einem solchen Lehrer wurde es auch gern verziehen, wenn er einmal, durch Faulheit einiger überreizt, sehr heftig wurde und seine Schüler kräftig schalt. Der Ausklang zeigt auch diese angenehme Stimmung.
[54] Nach der Schulentlassung ging der junge Rachel, wie er ausdrücklich schreibt, mit einem Freunde am Gründonnerstag zum Abschiednehmen zu dem freundlichen Konrektor.
Die Anregung in der Geschichte ging auch soweit, daß sich unter den Primanern eine Gruppe zu Privatwiederholungen vereinigte. Die Seele des kleinen Klubs war der später um die prähistorische Forschung in der Umgegend Dresdens hochverdiente Dr. Theile in Lockwitz; nebenher beteiligte sich eifrig daran Gustav Blöde, der Sohn eines Geheimen Finanzrates. Griechische, römische und sächsische Geschichte wurde mit besonderem Eifer getrieben, letztere nach dem bekannten Werke von Pölitz. Die Fortschritte oder die Mängel, die dabei der einzelne zeigte, werden gewissenhaft genannt. Die Zusammenkünfte bei Theile brachten auch jugendlich kräftige Ausarbeitung und zugleich Vorausgefühl, Vorausgenuß studentischen Lebens: es wurde tüchtig gefochten, und oftmals heißt es im Tagebuch: wir gingen zu Theilen – keilen. Theiles Liebhabereien, die ihn auf Naturwissenschaften hinwiesen, beschäftigten nebenbei noch die Freunde. So hatte er im Kaitzer Grunde eine große Ringelnatter gefangen, hatte sie gesotten, das Fleisch, das nach seiner Angabe wie Aal geschmeckt habe, genossen, die Haut aber über einen Spazierstock gezogen. Theile sammelte schon damals Scherben von Urnen, die er auf irgend einer der benachbarten Dorffluren ausgegraben hatte, und zeigte sie den erstaunten Mitschülern.
Von den weniger wichtigen Fächern wird nur selten die Geschichte der Philosophie erwähnt. Mag. Liebel, der, wie ich aus Erzählungen im Hause der Gröbelschen Familie weiß, wohl manches Seltsame an sich hatte, trug diesen etwas schwierigen Stoff vor. Er vertiefte sich im Anfang in die indische und chinesische Philosophie, erntete aber nur die ironische Anmerkung: „er ließ seine Gelehrsamkeit in der Philosophie leuchten“ oder „unser Psycholog, Poet und Philosoph gab sich ungeheuere Mühe mit den indischen und chinesischen Worten“; einmal kam ein Schum-Sche, ein See-Schu u. ähnl. heraus! Von den Literaturstunden, die sich nur auf die altklassischen Völker bezogen, ist nie die Rede.
Noch war das Deutsch als Unterrichtsgegenstand nicht von großer Bedeutung. Doch wurde, was den Aufsatz anbelangt, [55] große Freiheit gegeben. Es durfte sich, wie es scheint, ein jeder sein Thema wählen. Naturgemäß traten die Schreibgewandten, die sich an ihrer Lieblingslektüre herangebildet hatten, besonders hervor. Gern wurden die Freunde oder irgendwelche Tagesereignisse mit hineingeflochten. Einige Beispiele seien gegeben: Am 16. April 1831 las ein Schüler, namens Jenichen, eine Arbeit vor: Erinnerungen aus dem Tagebuche des beherzten Studiosus Skästig, und zwar ein Gespräch mit Johann, seinem Bedienten. Gemeint war der „Kommilitone“ Manitius, der aus Skäßgen unfern von Merschwitz an der Elbe stammte. In derselben Stunde fand die Arbeit eines von Oppen: Drangsale eines Schneiders keinen Beifall. Adolf Bary, ein ganz besonders begabter Schüler, trug einmal eine von ihm verfaßte Novelle vor; die Szenen mit der Lisette, die berlinisch sprach, waren recht hübsch. Sengeboden, ein anderer, sprach in seiner Ausarbeitung von der Wehmut des Abschiedes, und so fuhr er fort: „gleich darauf zog ich die gebratenen Tauben aus der Reisetasche“. „Also, meinte der Rektor, Sie haben eine lange Wehmut; wenn Sie um die Ecke sind, fallen Sie über die gebratenen Tauben her.“ Als Poland in seiner Arbeit von seinen Gefühlen während der Septemberrevolution 1830 berichtet und sagt, er habe gebetet und das Polizeihaus habe aus seinem Vulkane brennende Papiere ausgespieen, erntet er nur die lebhafteste Geringschätzung.
Gegen solche freiere Themata fiel das des Tagebuchschreibers im Sinne der Mitschüler sicherlich auch ab, obwohl es für ihn eine, wenn wahre, so sicherlich gute Zusammenfassung war. Er schrieb über „meine Studien in den Ferien“.
Das Vorlesen der Arbeiten brachte bei den gewiß oft zweifelhaften Gymnasiastenhandschriften Gelegenheit zu Verwechselung. So las Rektor Gröbel in einem ihm vorgelegten Brief an einen Freund den Eingang so: Dein langes Schwein statt Schreiben, worauf denn allgemeines Gelächter entstand.
Die Themata der zwei Prüfungsaufsätze – Michaelis 1831 und Ostern 1832 – lauteten: „Die vorzüglichsten Beförderungsmittel des wahren Patriotismus“ und „Inwiefern bereiten die öffentlichen Schulen auf das körperliche Leben vor“, Aufgaben, die sicherlich geeignet waren, die 18–20 jährigen jungen Leute [56] zum Nachdenken und zum frischen Aussprechen über sich selbst zu bringen.
Wenn nun auch der Betrieb des deutschen Unterrichts in Zeit und in Stoff sehr mager erscheint, denn vom Besprechen oder vom Lesen deutscher Dichtungen ist niemals die Rede, so wurde eben wohl vorausgesetzt, daß die Anregungen früherer Klassen, das Haus, das Theater der Stadt, die in der Jugend der höheren Schule von selbst liegende Lust, sich nicht nur lateinischen und griechischen Poeten zu widmen, sondern auch deutsche kennen zu lernen, ergänzend einträten. Und das ist auch, wie später erörtert werden soll, der Fall gewesen.
Vom Deutschen zum Französischen: Dies war kein Zwangsunterricht, sondern Wahlfach. Der Schreiber und seine nächsten Freunde haben es gern und fleißig getrieben. Hier mochte der Reiz wirken, daß es in der Wohnung des tüchtigen Schumann-Leclerq wie in einem Privatzirkel gepflegt wurde. Die Schüler hatten einen gewissen Einfluß auf den Lehrer. Er wählte das zu Lesende, und Lektüre war hier klugerweise der Mittelpunkt des Ganzen, nach den Wünschen der Teilnehmer. Ferner hatten ja doch auch Mädchen aus guten Familien ihren Zirkel bei demselben Lehrer. Dieser wußte das literarische und das gesellschaftliche Interesse beider Kreise geschickt zu vereinigen. Von Zeit zu Zeit studierte er Auserwählten aus beiden Gruppen ein Theaterstück ein. Die Wahl der Rollen, das Einstudieren selbst, die Proben und zum Schluß die Aufführung vor den Familienangehörigen gab selbstverständlich reiche Gelegenheit zu allerhand Freuden. Das Messen der eignen Kraft in solcher Betätigung, die billige Kritik an den mangelhaften Leistungen der Bekannten, Wahl und Ausputz des Kostüms, zarte Beziehungen während des Spiels, die sich vielleicht in irgendeiner Form auch nach der Festlichkeit fortsetzten – auch damals ein wonniges Behagen junger Menschenwelt, wie heute. Und es war ihnen eine stolze Sache, nach einem hübschen „Quartett“ gepudert und verkleidet vor die Zuschauer zu treten, unter denen Honoratioren der Stadt saßen: Frau Hofrätin Meißner, Herr Dr. Ficinus, Obersteuerrat Mühlhauser, Frau von Oppen, der ehemalige Stadtkämmerer Schnabel. Ein lustiges Essen schloß das kleine Fest.
[57] Ehe von den zwei wichtigsten Stoffen, den beiden alten Sprachen, gehandelt wird, sei noch die Mathematik erwähnt. Erst gerade im Jahre 1831 war der Mathematikunterricht auf sämtliche Klassen der Schule ausgedehnt worden, aber freilich gab es nur 2 Stunden wöchentlich in diesem Fache. In den unteren Klassen hieß es Arithmetik, von Tertia an Mathematik. Dieser Unterricht wurde bis 1833 nicht von einem „Kollegen“, nicht einmal von einem sogenannten Kollaborator oder Mitarbeiter, sondern von einer Hilfskraft erteilt; diese war damals ein als Leutnant Löhmann bezeichneter Hilfslehrer. Erst im Jahre 1833 ist er in das Kollegium aufgenommen worden; allmählich erhielt er mehr Stunden und vor allem eine angesehene und besser bezahlte Stellung.
Es ist klar, daß in zwei Stunden nur wenig geleistet werden konnte. Erst in Oberprima wurde Geometrie angefangen; ganz zuletzt wurden Logarithmentafeln angeschafft und danach gearbeitet. Es zeigt sich aus den Niederschriften, daß die Schüler weder den Stoff, noch leider auch den Mann ernst nahmen. Er machte kein Hehl daraus, daß er in bedrängten Umständen lebte, für viel Arbeit wenig Bezahlung bekam. Da die Schüler also seine klägliche amtliche und klägliche soziale Stellung kannten, hatten sie wenig Achtung vor ihm, dann und wann wohl ein Gefühl des Mitleids, zumeist aber starke Rücksichtslosigkeit. Aber freilich, im Juli will er den Schülern Maßstäbe besorgen und bittet um das Geld dazu im voraus, da er in seiner Familie 13 Menschen zu ernähren habe, von 20 Taler monatlich für 20 Stunden. Über die hohe Verwandtenzahl machen die Jungen natürlich ihre Witze. Ein andermal hatte er Subskribenten für gedruckte Formeln gesammelt. Er rügte die Witze, die auf dem Zettel gestanden hatten. Einer hatte geschrieben: Mitglied der Garküche zu Strehle; ein anderer hatte die Ablehnung mit „ich og niche" festgelegt, so aber, daß der Mathematikus dies für einen Eigennamen las. Wie gering die Disziplin war, zeigen die naiven Einzeichnungen unseres Oberprimaners.
Je nach der Jahreszeit heißt es: Heute kaufte ich mir für die Mathematikstunde getrocknete Pflaumen oder gute Kirschen. Es hatte dies nicht nur den Zweck, bei guter Weile etwas Rechts [58] zu schmausen, sondern die Kerne als Wurfgeschosse zu gebrauchen. Und dies geschieht trotz des anwesenden Lehrers, der einen einmal dafür an der Nase zupfte, trotz des entrüsteten Primus der Klasse, der wohl ruft: lassen Sie diese Kindereien! Den Obstkernen gesellten sich als Wurfgeschosse gelegentlich noch Handschuhe und Schwammstücke hinzu. Daß die Arbeit in Mathematik in der Schule nicht bedeutend war, geht hieraus hervor; aber auch in den sonst zahlreichen Eintragungen über häusliche Arbeit erwähnt sie unser Schüler nicht. Kein Wunder, daß, als das Maturitätsexamen herankam, der Leutnant über die drohenden Aufgaben arg gequält wurde, so, daß er zuletzt im Spaß sagte: so frage man doch einen dummen Jungen aus. Und als der Tag kam, waren Julius und sein bester Freund Gustav Blöde schon halb 10 Uhr fertig, denn es war, wie er schreibt, zum Totlachen leicht gewesen. War die Mathematik demnach ein Aschenbrödel, so war von Naturwissenschaft auf dem damaligen Gymnasium gar nicht die Rede.[20] In allen Klassen zeigt der Lektionsplan von 1833 nicht eine Stunde darin. Die Unkenntnis in Pflanzen- und Tierreich, über den Bau des Menschen, über physikalische oder gar chemische Vorgänge mag damals in der Jugendwelt groß gewesen sein. Ein Vorkommnis in der Schule erhellt dies blitzartig. Es kommt eines Tages bei M. Sillig im Tacitus eine Stelle zur Besprechung, in der es heißt: das Meer warf eine Menge Fische an das Land. Auf die Frage nach Fischen des Mittelmeeres antwortet der Primaner Jacoby: Austern. Ohne daß etwa Gelächter entsteht, denn die Kenntnisse vieler mögen hierin schwach gewesen sein, wird vom Lehrer der Tunfisch genannt, den der Tagebuchschreiber Dunfisch schreibt und mit Dünn in Zusammenhang bringt! In der Pause schreibt ein Spaßvogel an die Tafel: Austern sind Fische auctore doctissimo Jacoby, und sorgt dafür, daß diese Inschrift für die folgende Mathematikstunde stehen bleibt. In einer Zeit, in der dem in der Stadt und im Binnenland Lebenden die Anschauung in der Wirklichkeit noch vielfach fehlte, ist dergleichen nicht zu verwundern. Ich entsinne mich, daß noch vor 50 Jahren ein großstädtischer Gymnasiast als bestimmt annahm, Hirsche seien ausgewachsene Rehe!
[59] Nun aber zu den Kernstücken gymnasialer Bildung, zu Griechisch und Lateinisch.
Das Griechische setzte in den Anfangsgründen damals schon in der untersten, in der sogenannten Elementarklasse, mit 6 Stunden ein; dies setzt sich durch alle 5 Klassen mit ihren 2 oder 3 Unterklassen, also nach Befinden 9 Jahre lang hindurch fort.
In den 4 untersten Klassen wurden nur grammatische Übungen und Schreibübungen getrieben, sowie Beispiele aus einem Elementarbuche gelesen. In Tertia erscheint Xenophons Anabasis, in der Sekunda gleichzeitig Homer und Arrian; im ersten Jahre der Prima wird des Euripides Medea gelesen. Der Lehrer, M. Wagner, war am Schlusse der Lektion und des Schuljahres zugleich klug und geschmackvoll genug, seinen Primanern eine deutsche Übersetzung vorzulesen, die, so sagt der Chronist, „unsere Aufmerksamkeit, da sie schön war, sehr fesselte“. Im zweiten Jahre der Prima wurde in zwei Wochenstunden Herodot, in einer des Aeschylus Prometheus gelesen. Selbstverständlich wurde zur Privatlektion angemahnt, die im letzten Primanerjahre in Sophokles bestehen sollte; das leichtere war dem Schüler allein überlassen, das schwerere wurde in der Schule geboten. Einen besonderen Eindruck scheint der gewiß schwere Prometheus nicht gemacht zu haben; es wird nur darüber geseufzt, daß der Lehrer fast die ganzen zwei ersten Stunden eine lateinische Vorrede aus einer anderen Ausgabe vorliest! Um den Sophokles besser zu verstehen, geht Julius von Zeit zu Zeit auf die Königl. Bibliothek und schreibt sich des gelehrten Herausgebers Musgravius Anmerkungen heraus. Von griechischen Arbeiten ist während des zweiten Primajahres und beim Abschlußexamen nicht die Rede.
Nun sei des Lateinischen gedacht, das ja der Zeit und der Arbeitskraft nach die meisten Ansprüche an den Gymnasiasten stellte.
In der untersten Klasse tritt es mit 11 Stunden auf, in der nächsten mit 13. In den Sekunden sind es 12, in den Primen sind es 10 Stunden. Es werden gleichzeitig mehrere Schriftsteller gelesen, so in der Tertia Cicero, Ovid, Curtius und Cäsar. In der Prima 31/32 wurden Cicero, Tacitus und Horaz [60] gelesen. Da Horaz neu war und vom Rektor selbst gelesen wurde, ist das Interesse für ihn besonders lebhaft. Um so lebhafter, als in den neu hinzukommenden 2 Stunden lateinischer Disputierübungen einer stets eine Ode des Horaz ganz nach Philologenart auszulegen hatte; ihm waren Opponenten ernannt, die ihn zu bekämpfen hatten. Der Rektor gab sein Urteil meist in ernster, manchmal in ironischer Weise hinein; dann heißt es wohl: „er brachte Sottisen an“, oder er machte, aber sehr selten, einen Spaß. So machte er bei dem Worte „arena" eine Anspielung auf die Benennung der vor der Antonstadt nördlich gelegenen Baufläche, auf der wohl nur einfache Leute wohnten und die der Sand genannt wurde. Sicher waren alle Kameraden ganz bei der Sache, schon um zu beobachten und hinterher über den, der geglänzt hatte, wie namentlich über den, der übel bestanden hatte, allerhand Redensarten und Witze loszulassen. Als im Schuljahre 1831 zu 32 der Primus Osterloh die Reihe der lateinischen Vorträge beginnt, nennt Rektor Gröbel diesen Anfang, da es gut ging: auspicatissimum, d. h. von der besten Vorbedeutung. Der Spottvogel schreibt in sein Tagebuch: sonst heißt es wohl bei Vorträgen eher: spicatissimum, d. h. sehr stark gespickt, abgeschrieben. Der Verblüffte, wie der, der seltsame Angewohnheiten hat, nicht minder der, bei dem es herzlich schlecht geht und der Rektor sich äußert: „Hören Sie, daß es nur nicht die Spittelweiber hören!“, werden ins „Merkbüchlein“ geschrieben.
Die lateinisch gehaltene Auslegung einer horazischen Ode, Satire oder Epistel war das Kernstück. Zur Auslegung eines solchen Gedichtes bedarf es nun aber einer ganz besonderen Kenntnis römischer Verhältnisse in Geschichte, Religion, Mythologie und häuslichem Leben. Dafür hatte eine Lehrstunde in der Sekunda stark vorgearbeitet. Es ist dies Silligs Unterricht in den Römischen Antiquitäten. Bereits 1829 und 1830 hatte Julius Rachel diesen für beide Sekunden vereinigten Unterricht genossen. Den künftigen Juristen hatte dieser Stoff sehr interessiert, und so hatte er denn sehr fleißig nachgeschrieben. Ein starker Pappband liegt vor, der 241 Quartseiten enthält, die zwar nur auf der inneren Halbseite beschrieben sind, aber viele Zitate und [61] Hinzufügungen enthalten. Auf dem Vorblatt steht: Römische Antiquitäten, vorgetragen von H. M. Sillig, nachgeschrieben von J. W. Rachel. Beim Verlassen der Kreuzschule „vermachte" er das Buch seinem jüngeren Bruder Hermann, der sich dann die Sache leicht machte und während der Stunden das vom Bruder Niedergeschriebene prüfte und gelegentlich hinzufügte. Kecker Weise schrieb er in den oben angeführten Titel die Worte: Wiederum durchgegangen und verbessert von H. Rachel. Beim Durchblättern dieses „Kollegienheftes“, denn diesen Eindruck macht der von einem 16/17 jährigen jungen Gymnasiasten geschriebene Band, ist man erstaunt, in wie eingehender Weise Römische Staats- und Privataltertümer schon auf den Schulen damals getrieben wurden. Offenbar ist alles diktiert, denn es erscheinen, wie in einem „Kompendium“, die eingehendsten Unterabteilungen. Da liest man A, a, α, β, αα, ββ! In diesen vielverzweigten Abschnitten sind auch, genau nach Art der Studentenhefte, zahlreiche Quellenangaben und Literaturnachweise angefügt. Besonders erstaunlich ist es, wie diese jungen Menschen dazu veranlaßt wurden, allerhand heikle Dinge zu hören und aufzuschreiben, so die Hochzeitgebräuche, die Überführung schuldiger Vestalinnen und deren Bestrafung, eingehende Erörterungen über priapische Dinge u. a.
Es ist hier nicht der Ort, sich weitläufiger darüber auszusprechen. Ein wichtiges Zeugnis für die stark philologische Art der Behandlung solcher Stoffe auf dem Gymnasium jener Zeit wird dieser Band immer sein. Gewiß ist vieles darin, was einen jungen Menschen jener Zeit schon fesseln konnte, aber der Notizenkram überwiegt sehr oft; so werden in dem Paragraphen, der die Malerei der Römer behandelt, die Namen der zwei Männer genannt, die Neros goldenes Haus ausmalten.
Ein Beweis für die große Gelehrsamkeit ist dies von Magister Sillig gehaltene „Kollegium“. Ein anderer Dresdner jener Zeit, der bekannte Hofrat Böttiger, hat durch seine mythologisch-antiquarischen Werke dem Kreuzschullehrer offenbar viel Anregung gegeben.
Der auf Grund solcher Kenntnisse ausgelegten horazischen Ode folgte der Vortrag eines eigenen lateinischen Gedichtes oder [62] die deutsche Übertragung des im Mittelpunkte der Disputation stehenden Gedichtes des Horaz. Den Wert dieser Übung sahen alle Beteiligten ein; so erklärt sich die Anlegung eines Sammelbandes für diese deutschen Übersetzungen. Im Jahre 1828 wurde unter des Rektors Anregung der Beschluß gefaßt, die besten lateinischen Vorreden (Praefatio) zur Disputation, die besten lateinischen Gedichte, die besten deutschen Übertragungen aus Horaz durch einen vom Rektor ernannten Ausschuß von 11 Primanern zu dieser Ehre vorzuschlagen, und bis 1837 ist es so gehalten worden. Die Vorrede zum ersten Band der Camöne[21] sagt darüber: „Da es für Jünglinge, welche die dichterischen Meisterwerke des klassischen Altertums lesen, ungemein bildend ist, sich in Nachahmungen derselben in der Muttersprache zu versuchen, so ward von unserm verehrten Herrn Rektor die Einrichtung getroffen, daß von jedem Primaner, dem die Ehre des Disputierens zu Teil wurde, eine metrische Übersetzung des Gedichtes, das zum Stoff der Disputation gewählt worden war, vorgelesen werden sollte. Hierdurch ward zu mancher ziemlich gelungenen Nachahmung eines Gedichtes des Horaz (denn die Erklärung dieser Koryphäe aller Lyriker ward in Disputier-Übungen versucht) Anlaß gegeben, von welcher eine längere Aufbewahrung zu wünschen gewesen wäre. Obwohl man sich dem weisen und gerechten Urteil des Herrn Rektor freudig unterworfen hätte, so nahm man seine Entschließung, daß 11 Primaner nach nochmaliger Verlesung des Gedichtes mit Stimmenmehrheit zu entscheiden hatten, sehr gern an.“
Bei der Wahl der zu besprechenden Ode zeigt sich Vorliebe für die bekannten bedeutenden des dritten Buches. Sehr beliebt ist auch die kürzere, gedrungenere I, 15, des Meergottes Nereus Verkündigung von Trojas Fall.
Eigentümlich ist es, daß nicht unbedingt wörtliche Übertragung des antiken Inhalts geboten war; das Gedicht durfte auch in moderner Einkleidung erscheinen. So begann Osterlohs Übersetzung des 11. Gedichtes im ersten Buch der Epistel also:
[63]Wie hat dir Prag gefallen, Freund, und Wien?
Gewiß erlebtest du dort hübsche Stunden?
– – – – – – – – – –
Du lobst wohl Dresden gar, das Todten-Nest?
Weil es entfernt vom Meere liegt?
Oder Buch der Satiren 1, 9 fängt einmal also an:
Einst ging ich nach gewohnter Weise
Ein wenig auf der Prommenade,
Mir Kleinigkeiten überdenkend,
Doch ganz und gar darein vertieft.
Ein andermal liest man:
Als ich in Neustadt jüngst einmal spazieren gehe
Und ganz in mich vertieft gar nicht um mich sehe ....
Manchmal erinnert Titel und Inhalt geradezu an eine Art Ulkzeitung, so z. B. die Saturnalienfeier oder der freimütige Raisonneur, travestierte Posse nach Horaz' Satire; oder eine Parodie auf Satire II, 8, so beginnend:
Bon jour, mein lieber Freund! Sprich, wie bekam der Schmaus
Beim reichen Wechsler Schmul? Wie kamst du denn nach Haus?
Die Reise des Horaz nach Brundusium wird in witzelnder Weise durch eine in Alexandrinern gedichtete Pfingstreise in die sächsisch-böhmische Schweiz wiedergegeben! Gerade solche Seitensprünge sind natürlich beliebt; und so fehlt es in den Tagebuchnotizen bei aller Neigung zur Kritik und zum Witz nicht an Lob und Anerkennung. Noch einige Beispiele seien aus der Fülle der Randbemerkungen gegeben: Ein Gedicht ist „allerliebst“, ein anderes wird gerühmt wegen seines Titels: Ans Fläschchen. Kräftig belacht wird ein Liebesgedicht, in dem das Mädchen gewarnt wird: sie solle keinem Minnesänger trauen, und säng’ er auch den tiefsten Baß. Einmal wird eine Tragödie, die gerade in Dresden ausgepfiffen worden war: Rosamunde, von einem der Schüler ironisch gepriesen: sie habe alle Eigenschaften einer guten Tragödie, Mord folge auf Mord, Leiche auf Leiche. Man wagte es sogar, politische Satiren loszulassen. Zu einer Horazstelle, „descende coelo“ versuchte einer ein komisches Gedicht, in dem er in der Titanenrevolution die im April 1831 in Dresden [64] ausgebrochene schildert. Als der Rektor eine Disputation beim Verlassen der Klasse ganz besonders lobt, fangen sie alle an zu klatschen, worauf er sagt: „Das wollte ich nicht haben!“; trotzdem ruft einer laut: Bravo!
Der Rektor hielt bei jeder Disputation nach Universitätsweise auf ganz besondere Formen: Der Disputator hatte eine schön geschriebene Invitatio, die ihm oft ein besser schreibender Kamerad verfaßte, beim Rektor einzureichen, der wohl ein: Glück zu! rief. In feierlicher Stimmung erwartete der Unglückliche den Rektor; dieser trat ein. Der Schüler, es war Julius Rachel selbst, begann: „Signa cecinere“ – es hat geläutet! Nun ging’s los, und es ging gut. Aber das Gedicht fiel ab; im Anschluß an eine Stelle der Ode, über die er disputiert, sagte der Rektor, er habe wenigstens laxo, nicht lapso arcu, mit schlaffem, nicht mit entglittenem Bogen gestritten. Wie es sich im Laufe der Jahrzehnte auf deutschen Gymnasien wohl hundert und aberhundertmal wiederholt haben mag, die lateinischen Gedichte oder die Übertragungen stammten von den besonders dazu Begabten aus der Klasse; diese waren geradezu die Fabrikanten, und im Tagebuch wird mit der gemütlichsten Offenheit gesagt, von welchem der zwei gerade das „heute“ vorgetragene Gedicht stammte. Löblich ist aber der Eifer, mit dem die Disputation betrieben wird. Gleich in den ersten Primanerwochen wird zum Zusammentritt zu einer Privatdisputation aufgefordert; unterschriftlich verpflichten sich etliche dazu, und aus den Eintragungen geht hervor, daß die Zeiten auch regelmäßig innegehalten wurden. Wie es scheint, wird auf deutsch disputiert, etwa einmal über den Nutzen der Mönche im Mittelalter. Selbstverständlich schließen die Übungen, bei denen Tee getrunken wurde, mit lustigem Singen und lebhaftem Qualmen oder einem anregenden Schachspiel. Ein Bändchen guter Leistungen in diesen „Privatdisputationen“ ist in der Kreuzschulbibliothek erhalten. Unter anderem ist ein längerer Aufsatz aus dem Jahre 1832 darin, in dem sich der Verfasser über die Errichtung von gewerblichen Schulen und höheren Bürgerschulen ausläßt. Er will nichts weniger als gemeinsamen Unterbau des Gymnasiums und dann Abzweigung in ein anderes Schulwesen und möglichste Erhaltung des gymnasialen Charakters [65] der oberen Klassen. Naturwissenschaften und Mathematik seien auf dem Gymnasium nicht so stark zu betreiben, wie auf den fürs Gewerbsleben vorbereitenden, eben recht wünschbaren Schulen. Wenn er für den mathematischen Unterricht ein Lehrbuch verlangt, damit nicht nach Vortrag und Nachschrift zu lernen sei, so zeigt dies, daß Leutnant a. D. Löhmann damals ohne ein solches auszukommen versuchte.
Zum Schluß seien noch einige Namen derer genannt, deren Erzeugnisse für würdig erklärt worden waren, in die Camöne, eine Art goldenen Buches, eingetragen zu werden. Sie haben im späteren Leben Dresdens oder Sachsens eine mehr oder weniger hervorragende Stellung eingenommen: F. O. Schwarze, der spätere Generalstaatsanwalt, H. H. Pechmann (Jurist), H. Schlurick (Kirchenrat), Emil Kade (Prof. am Kadettenkorps), Bernh. Adolph Langbein (Hofprediger), F. Wilh. Pfotenhauer (Oberbürgermeister), Anton Pusinelli (Dr. med.), G. Kürsten (Bürgermeister), Franz Otto (Rechtsanwalt); mehrere des Namens Kell. Aus der damals noch kleinen jüdischen Gemeinde in Dresden sind zu nennen: Bernhard Hirschel (Dr. med.), Joseph Elb (Dr. med.), Wolf (Dr. med.), Landau (Rabbiner), Veit Meyer.
Keiner dieser „Dichter“ würde uns wohl jetzt als bedeutend vorkommen. Ein einziger ragt hervor, und das ist Adolf Bary, der wirklichen dichterischen Schwung besaß. Nur ist hier, wie so oft, zu sagen: er ist stark beeinflußt von Schiller und Körner, wenn er in einem seiner Gedichte über das deutsche Volk singt:
Groß stehst du du, mein Volk, in deines Glaubens Klarheit,
In deiner Freiheit stolzerem Gefühl.
Hell leuchtet dir das Lichtgestirn der Wahrheit,
Und Niederdruck und Lügenwerk zerfiel.
Es ist zwar eine Verherrlichung zur Lützner Schlachtgedenkfeier 1832, doch könnte man auch die Stimmungen nach 1830 heraushören.
Neben diesen Disputationen, von denen die Schule sicher nichts erfuhr, gab es noch reichlich Privatarbeit, namentlich Privatlektüre. Im Lateinischen gelegentlich Livius, im Griechischen Sophokles. Dessen Ajax fesselte den Primaner wohl [66] so, daß er darüber die Geschichtswiederholungen versäumte. Gerade diese Art Studien empfahl der Rektor sehr eifrig; einmal rief er dem Schreiber zu: „Nur fleißig privatissime; Jean Paul hat als Primaner 4 Quarthefte excerpiert".
Von den lateinischen Aufsätzen hört man nicht viel: eine Stelle aus Horaz; dann eine Aufgabe, die an die Warnungen unsrer Tage vor Schundliteratur erinnert: de damno romanensium librorum – Vom Schaden der Romanlektüre. Vielleicht, um die Probe auf das Exempel zu machen, hat unser Chronist, auch während er daran arbeitete, häufig bei Bekannten oder in der Leihbibliothek Romane geholt, um sich an ihnen zu ergötzen. Wie steht es mit der häuslichen Arbeit nach den Niederschriften; hat sie auf dem jungen Menschen gelastet? Durchaus nicht. Er ist im Sommer und Winter nach dem Vormittag- und nach dem Nachmittagunterricht um 10 oder 11 und um 4 gar vielfach auf den Straßen der Altstadt, im Großen Garten, in der Neustadt, auf den Buden der guten Freunde. Er hat Zeit zu französischer Extrastunde, zum Gitarrespiellernen, zum Singen, zum Klavierspiel, zum Fechten, zu musikalischen Übungen, zu Besuchen, zum Tanzen, zu Ausflügen an Mittwoch- und Sonnabendnachmittagen und an Sonntagen. Kurz, nicht die Spur von Überbürdung, obwohl viel Latein und tüchtig Griechisch getrieben wird. Zum Teil erklärt es sich daraus, daß der junge Mann ein Frühaufsteher war. Im Sommer hat er sich häufig das Wecken bei dem Soldaten, der hinter der Auswechslungskasse Wache zu stehen hatte, für um 4 oder 5 bestellt, und manche Vorbereitung für Lektion, Ausarbeitung usw. ist um diese Zeit entstanden. Ganz selten arbeitet er des Abends lange; als etwas ganz Besonderes wird einmal gebucht, daß er abends bis 11 45 gearbeitet habe. Es gibt sich auch im letzten Halbjahre vor dem Maturitätsexamen durchaus keine Erregung, kein atemloses Pauken kund. Fast sind die Freuden des geselligen Lebens gerade so groß, daß die Arbeitszeit geringe genug ist; die Interessen richten sich mehr und mehr auf die weiblichen Wesen, mit denen er an Gesangs- und Tanzabenden verkehrt. Es muß freilich hervorgehoben werden, daß für die Naturwissenschaften gar nichts, für Mathematik, neuere Sprachen und Deutsch fast nichts zu arbeiten ist.
[67] Von besonderen Schulvorgängen habe ich noch die Synoden, die Ferien, das Abschlußexamen und die Schulfeierlichkeiten zu erwähnen.
Wenn irgend ein wichtiger Disziplinarfall zu entscheiden war. wurde der Unterricht ausgesetzt; die Lehrer vereinigten sich in ihrem oder des Rektors Zimmer, die Schüler mußten, da doch außer den Angeschuldigten vielleicht andere als Zeugen oder als weiterhin Belastete zurückzuhalten waren, in der Schule bleiben, und den Primanern wurde die Ehrenpflicht aufgeladen, die jüngeren Klassen zu beaufsichtigen. Selbstverständlich gab das auch damals den Anlaß zu allerhand Unsinn. Der jüngeren bemächtigte sich eine Art wilden Humors; das süß-schauerliche: etwas Besonderes vollzieht sich, der Unterricht fällt aus, eine außergewöhnliche Aufsicht greift Platz. Je nach der Zahl der etwas unverschämt angelegten Jungen entwickelte sich nun ein Kampf zwischen der Autorität der Oberen und dem Ungehorsam der Unteren. Aber selbst die Oberen wurden von einem Taumel ergriffen. Schon die Anlässe zur Synode belustigten oder interessierten. So hatte einst die Ökonomin der Alumnen Milchbrei, der etwas angebrannt war, aufgetischt. Als sie die Teller wieder haben will, schreien alle, lachen und verfolgen sie bis zur Treppe hinunter und rufen: „Das könnten sie nicht fressen“. Und nun wurden diese Herren, wie es heißt, dafür „gewitscht“. Sehr entrüstet heißt es, als auf derselben Synode beschlossen worden war, die Privatarbeiten von Zeit zu Zeit zu kontrollieren, dies sei ein Krähwinkler Beschluß.
Selbstverständlich kamen auch Kneip- und Rauchgeschichten vor die Synode. Aus den zahlreichen Angaben des Tagebuches geht hervor, daß die Leute in ihren Familien oder, wenn sie sich besuchten, mit größtem Vergnügen ihre Pfeifen, ganz selten Zigarren rauchten. In der Stadt selbst tun sie es nicht öffentlich, und wenn es einmal geschehen ist, wird es als eine Art Heldentat gebucht. Von geflissentlichem Kneipenleben ist in dem Kreis, dem der Chronist angehört, nicht die Rede. Es wird viel Tee, auch Milch oder Limonade getrunken, seltener Bier. Bei einer Gasterei, die der junge Struve gibt, setzt es Wein, und es ist natürlich, daß diese ungewohnte Pracht verhängnisvolle Folgen [68] hat. Von Verbindungswesen ist keine Spur zu merken. Eine Zeitlang sind die Freunde auf Kuchen ganz versessen und gehen oft einmal zum Kuchenbäcker; doch scheint auch dies nicht erlaubt gewesen zu sein, denn sie verabredeten sich, daß sie, wenn sie einmal von einem Lehrer gesehen werden sollten, sagen würden: sie hätten sich Cholerabonbons gekauft!
Nun war aber einmal eine Kneipengeschichte herausgekommen. Der Rektor versammelte die Hausinspektoren nach der Synode und erklärte ihnen den ganzen Prozeß: wie einer, der eine Tabakspfeife habe, wodurch er schon an und für sich ein Bengel wäre, liederlich würde, da er dazu trinken müßte, hernach lieber in Gesellschaft rauchte und, um beides zu haben, gleich auf Kneipen ginge. Von nun an müßte jeder Schüler, der seine Eltern nicht in Dresden habe, seine Wohnung melden – dies war also bisher merkwürdigerweise noch nicht geschehen. Die Lehrer wollten Umgang halten, und jeder Schüler müsse außer mit gehöriger Legitimation nach 6 Uhr zu Hause sein. Darauf erschien im Dresdner Anzeiger folgendes: daß in den Trödelbuden bei der Annenkirche Blendlaternen billig zu verkaufen seien, vorzüglich geeignet für Lehrer, die Primaner abends in ihren Wohnungen aufsuchen wollten – eine Anzeige, die zugleich darauf hinweist, wie selten noch Treppenbeleuchtung sein mochte.
Sechs Wochen, ehe die Oberprimaner die Schule verließen, war die Androhung für diese wohl etwas verspätet und überflüssig, denn wenige Tage darauf ist schon davon die Rede, daß nach Leipzig wegen einer passenden „Bude“ geschrieben wird.
Wie toll es manchmal bei den Synoden zuging, ein Beispiel: In der Prima sangen die, die nicht zu Hausinspektoren bestimmt waren, Gaudeamus igitur. Dann machte einer den Erklärer von Guckkastenbildern, ein anderer gründete aus seinen Mitschülern eine Tierbude: einer wird zur Bisamkatze, ein anderer zur Wasserratte ernannt. Zum Schluß hebt der Tollste, ein zukünftiger Theologe, die Klassentüre aus und will sie aufs Alumneum schleppen, lehnt sie aber an die Treppenwand. Wenn aus dem Programm hervorgeht, daß er zu Ostern mit II b im Betragen zum Studium übergegangen ist, bewahrheitet sichs: Alle Schuld rächt sich auf Erden!
[69] Von Schulstrafen ist in dem Tagebuche kaum die Rede, da es sich doch um Primanerzöglinge handelt. Wohl wird ihnen, und das war nötig, besseres Verhalten in der Mathematikstunde vorgehalten, damit sie mit dem guten Beispiel vorangingen; auch ihr Auftreten als Hausinspektoren wurde getadelt. In den mittleren und niederen Klassen war, wie aus den Lehrerprotokollen jener Zeit zu ersehen ist, Strafversetzung in eine niedrigere Klasse, Sitzen auf der schwarzen Bank, Eintrag in ein schwarzes Buch, eine halbe Stunde in der Klasse knien, Androhung von körperlicher Züchtigung denkbar. Die Abneigung gegen das Rauchen der Schüler auf offener Straße war 1827 noch so stark gewesen, daß der dabei Betroffene mit Rückversetzung in die nächsttiefere Klasse bedroht wurde; es wird wohl kaum dazu gekommen sein.
Jetzt ein Wort über die Ferien, die allen Schülern aller Zeiten willkommenste Zeit! Damals waren sie zu Pfingsten gleich lang wie jetzt; zu Ostern und zu Weihnachten kürzer, denn zu Ostern wurde erst nach Palmarum geschlossen, zu Neujahr schon am 2. Januar wieder begonnen. Die Großen Ferien dauerten 1831 von Sonnabend den 16. Juli bis Montag den 8. August, also 3 Wochen. Die Schule begann merkwürdigerweise am Vogelwiesenmontag wieder. Natürlich fehlte es beim Herannahen freier Zeiten nicht an Unruhe und Tollheit. Am Freitagnachmittag vor Pfingsten wurde in des Magister Sillig Tacitusstunde von 2–3, sobald er irgend Witze machte, gelacht, gezischt, gebrummt. In der darauffolgenden Mathematikstunde war das Pflaumenwerfen schlimmer als sonst; außerdem ging auf zinnernem Teller eine Bittschrift um spitzige Kreide und um zeitigeren Stundenschluß in der Klasse herum. Erst ironisierte der Leutnant, sie könnten es ja nicht erwarten, wie die kleinen Quartaner. Als aber allgemeines Pochen eintrat, entließ er die Herren Primaner 3/4 4 Uhr.
Am 16. Juli aber „inszenierte das enfant terrible“, der Türausheber, eine Bittschrift an den Rektor: Die erste Klasse bittet um die Erlaubniß, die Lektionen um 10 Uhr zu beendigen. Welches Gaudium, als es genehmigt wurde! Den Zettel mit der Genehmigung und der Unterschrift des Rektors wußte sich der Chronist anzueignen und fügte ihn in sein Tagebuch ein. [70] Wie es damals noch üblich war, fehlte es nicht an Ferienaufgaben, aber da der junge Mann zu Pfingsten wie in den großen Ferien ruhig in Dresden blieb, so hat er gar manchmal vor seinem Zumpt, an seiner lateinischen Ausarbeitung gesessen, ja, er nahm sich des Horaz Episteln mit auf den Spaziergang und lernte darauf los. Nur in den Osterferien und zu Michaelis blühten ihm zwei Fahrten, die eine nach Meißen, die andere nach Neustadt bei Stolpen. Da lebte man bei lieben Verwandten nach eigenem Behagen! Charakteristisch ist das Bedauern, daß vormals freie Tage verloren gegangen sind. So heißt es am 24. Juni wehmütig: eingegangener Johannistag![22] Und als im Sommer 1831 die Cholera droht, wird unter dem 13. Juni der fromme Wunsch aller Klassengenossen geäußert, daß die Cholera, wenn sie kommen sollte, erst nach den Hundstagsferien kommen möchte!
Diese gefürchtete Krankheit spielt natürlich hie und da bis in die Schule hinein. Als er in der lateinischen Disputierstunde gefragt wurde, woran Eurydike gestorben sei, hätte er am liebsten geantwortet: an der Cholera. Am 10. September teilte der Rektor mit, daß wegen der Choleragefahr kein Examen stattfinde und die Schule nur kurze Zeit ausgesetzt werde. Ein Anschlag des Herrn Marktmeisters Heerklotz verkündete, daß die Hausmannsfrau kein Obst mehr verkaufen dürfe; überhaupt werde dies die hohe Schulkommission ganz abschaffen, da es die Schüler zur Genäschigkeit verleite und zur Zeit sehr gefährlich sei. „O, höchst ridikül!“ lautet die Schülerkritik.
Als hierauf am 28. September die Translokation (die Versetzung) verkündigt wurde, hielt der Superintendent Güldemann (damals der Vorsitzende der Schulkommission) in Anlehnung an mens sana in corpore sano eine „rührende“ Rede über die Cholera; „wir wären es unseren Lehrern, Eltern und uns selbst schuldig, daß wir alle Vorsichtsmaßregeln anwenden sollten; worauf aus dem Hintergrunde ziemlich vernehmlich ertönte: Camillenthee nicht zu vergessen!“
Nun einiges von den schriftlichen und mündlichen Prüfungen, die abgehalten wurden.
[71] Zu Michaelis 1831 war schon ein Vorausgefühl zu spüren: man hatte dem mündlichen Examen der Abiturienten zuzuhören, denn damals wurden auch zu Michaelis reifgewordene Schüler nach der Universität entlassen. In Latein, Griechisch, Mathematik, Geschichte und Religion wurde geprüft. Die hinten Sitzenden bliesen in unverschämter Weise ein, und als die „Hebräer“ aus der Bibel zu übersetzen hatten, rissen die Kameraden aus ihren deutschen Bibeln die entsprechenden Blätter heraus und schwindelten diese nach vorn zu. Während der Beratung der Lehrer waren die Abiturienten in einer Klasse versammelt und schrien zu den Primanern: „Ihr Pennäler!“ Diese antworteten: „Ihr seid noch nichts!“ Freudiger, ernsthafter und doch nicht so gefährlich, als es von fern erschienen war, wurde es zu Ostern selbst. Im Hinblick darauf hatte Julius am 1. Januar 1832 in sein teueres Tagebuch geschrieben: „Halleluja! Heute ist denn das Jahr angebrochen, in welchem meine Erlösungsstunde schlägt, diese Schule zu verlassen!“
Mittwoch den 18. Januar meldete er sich mit seinen Freunden persönlich beim Rektor zur Prüfung. Am 10. März beginnt diese mit dem lateinischen freien Aussatz: In eligendo vitae genere quid sit spectandum? Was hat man bei seiner Berufswahl zu bedenken? Er schreibt davon: „Ich und Blöde arbeiteten bis halb 4 Uhr, andere noch länger. Der Rektor war sehr wenig in der Klasse, also konnte wegen des Lärmes nicht viel gemacht werden; Kellermann bekam Papierkugeln an den Kopf, während er einschrieb. Blöde holte eine herrliche Butterbemme von der Hausmannsfrau herauf.“
Als es 1 Uhr schlug, brachen alle in ein langes Ach! aus, dies vermehrte sich bei jeder neuen Stunde, da der Rektor zufällig nie da war.
Vier Tage später wurde die freie deutsche Ausarbeitung geschrieben: In wiefern bereitet die öffentliche Schule auf das bürgerliche Leben vor?
Auch hierbei war wenig Aufsicht, daher viel Lärm und Unsinn, so daß er, obwohl um 12 Uhr mit dem Entwurf fertig, erst um 2 Uhr abgab. Ein Hauptwitz war: am selben [72] Tage esse man auf dem Alumneum Gamaschenknöpfe zu Mittag, d. h. kleine Graupen.
Wieder drei Tage später wurde ein lateinisches Examenspecimen über den Diktator geschrieben. Dadurch, daß der Rektor die schwersten Stellen diktierte, wurde alles übrige kinderleicht, so daß schon um halb 10 Uhr alles vorüber war, d. h. nach 1 1/2 Stunde. Drei Tage später gab es kinderleichtes mathematisches Examen. Am 24. März erfahren sie, daß am 28. alle 25 Abiturienten zugleich mündliches Examen haben sollten. So war das schriftliche vorbei, ohne Griechisch oder Französisch.
In der ganzen Zeit vor und während der Prüfung hat der Kreuzschüler damaliger Zeit nicht gebüffelt, sich nicht vom gesellschaftlichen Leben ferngehalten; im Gegenteil, gerade in der Zeit dicht vor Ostern werden Gesellschaften, kleine Tanzereien, Gesangsaufführungen, Ausflüge lustig mitgemacht. Nur von Zeit zu Zeit gibt es Geschichtsrepetition und eine Disputation, denn der Unterricht geht in diesen Wochen, wenn gerade kein Examen ist, ruhig fort.
Am 27. abends sitzt er fröhlich mit seinen Freunden zusammen, denn am andern Tage soll das mündliche Examen sein. Noch wurden aus Pölitz’ Geschichtswerk Kulturabschnitte vorgelesen, da der Konrektor in der Geschichtsprüfung Literatur daran nehmen wollte. „Zuletzt aßen wir“, so schließt der Bericht, „unser, so Gott will, letztes Pennalfressen, Butterbemmen und Schweizerkäse.“
Das mündliche Maturitätsexamen selbst: Eine horazische Ode, ein Stück aus des Sophokles Ajax, leicht, überhaupt die ganze Prüfung nicht abiturientenmäßig. Dann kommt der Konrektor und prüft Geschichte der Philosophie, nicht Weltgeschichte, worüber sich alle ärgern. Nachmittags kommt noch Mathematik und Religionsgeschichte daran. Auch sie wandern dann in die Tertia und warten, bis sie herübergerufen werden. Der Superintendent nimmt das Wort; es klingt im Anfang verdächtig: die Regierung habe beschlossen, den Andrang der Studierenden soviel wie möglich zu mindern. Dann kommt aber überraschend die Mitteilung: alle 25 haben bestanden, und gewiß werden sie einst auch auf der Universität gut bestehen!
[73] Einer, der in schweren Ängsten geschwebt hatte, er werde durchfallen, lud 6 seiner Freunde zum Abendbrot ein. Da ging es denn sehr lustig zu. Es wurde gesungen: Körners Lied von der Kraft, dann: Lasset die feurigen Bomben erschallen, Der Musensohn, Lützows wilde verwegene Jagd und Gaudeamus igitur. Über den Wert oder Unwert der Burschenschaft wurde eifrig gesprochen und gestritten, die Köpfe wurden heiß, die Magen schlecht, die Stimmung aber immer rührseliger, so daß mancher Bruderkuß getauscht wurde.
Und auf diesen heiteren Abend folgte, soweit Unwohlsein nicht abhielt, noch 14 Tage regelmäßiger Schulunterricht. Der Tagebuchschreiber mußte am 4. April, 7 Tage nach der Maturität, noch als letzter lateinische Disputation abhalten und ein von ihm gefertigtes Gedicht vortragen! Mitten in dieser Zeit las er die ihm bestimmte Abgangszensur im Programm! Die Woche vor Palmarum brachte nun noch die mündlichen Osterprüfungen, an denen sich die Muli mit der zweiten Hälfte der Prima auch zu beteiligen hatten. So hatten sie denn noch einmal vor „dem Minister Müller und den übrigen Pennalräten“ ihre Weisheit im Sophokles glänzen zu lassen. Dabei lagen die unter Aufsicht der Lehrer gefertigten Specimina und andere Arbeiten in deutscher, lateinischer und griechischer Sprache öffentlich aus. Dies war Mittwoch den 11. April. Noch immer kam sich aber der Mulus als stark abhängig von der Schule vor; denn als er nachmittags vom Großen Garten bis in die Pirnaische Gasse hinein mit der brennenden Pfeife geht, erklärt er dies selbst für eine Frechheit. Und am folgenden Tage reizen ihn bei einem Spaziergang des jungen Volkes befreundete Mädchen auf der bretternen (nicht ledernen, wie er schreibt) Saloppe mit Worten, er fürchte sich wohl, so lange, bis er sich sein Pfeifchen anbrannte.
Montag den 16. April kam der große Tag der Entlassung. Des jungen Mannes Interessen waren aber an diesem Tage sehr geteilt. In den frühen Morgenstunden hatte er mit den Seinen die liebe Tante begraben, aus deren in den Jahren 1808 bis 1811 geführtem Tagebuche ich in den Dresdner Geschichtsblättern einiges veröffentlicht habe. Die Schüler versammelten [74] sich in der Kreuzschule und marschierten, da sehr viele Zuhörer erwartet wurden, von da nach dem Gewandhause; zum ersten Male erschienen, sehr zu ihrer Unzufriedenheit, die Festredner nicht mit Degen und Dreimaster. Nun wurden, ehe der Rektor die Entlassung aussprach, vierzehn Reden oder Gedichte vorgetragen: Ein hebräisches Dankgebet; zwei griechische Gedichte, eine Frühlingsfeier und ein Lob des Leonidas; vier lateinische Reden: über den notwendigen Zusammenhang zwischen literarischen Studien und Musik; über den Segen der Gerechtigkeit im Staate; über Horaz, den besten Sittenlehrer, und – 1832, ein halbes Jahr nach Einführung der Verfassung in Sachsen, – das interessanteste der vier Themen: Orationem liberam magnum esse libertatis publicae praesidium – die freie Rede ein gewaltiger Schutz für die öffentliche Freiheit! Die drei deutschen Reden behandelten allgemeine, philosophische Themen: über den Wert der Freundschaft sprach Theile, über die Freuden der Erkenntnis Gustav Blöde, der Freund Julius Rachels; und über Schillers Wort „Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst“ ein Dritter. Nicht weniger als vier deutsche Gedichte folgten: Die Hermannsschlacht, die einzige Programmnummer, die einen vaterländischen Stoff behandelte; dann Bary’s Gedicht, Der Schwedenstein, zur Feier Gustav Adolfs und der Lützener Schlacht am 6. November 1632. Den Schluß bildeten ein Gedicht der Abgehenden, eines der Zurückbleibenden, dies letztere vom späteren Kirchenrat Schlurick verfaßt. Das Bary’sche Gedicht ist in die Primanergedichtsammlung Camöne aufgenommen worden und zeigt den feurigen, gewandten Dichtersmann.
Von alledem gefiel dem Tagebuchschreiber die deutsche Rede seines Freundes Blöde „über die Freuden der Erkenntnis“ am besten; er sprach, gehoben durch die Anwesenheit seiner Herzensflamme, mit wahrer Begeisterung. Es ist begreiflich, daß die Beredsamkeit des Rektors nach soviel Redeleistungen und noch dazu in Gegenwart der Töchter befreundeter Familien die muli nicht mehr fesseln konnte.
Und nun die Frage nach gewissen Festlichkeiten, die die Schule während des Jahres etwa selbst geboten hätte: Von Schulball, Schülerfest, Schülerausflug, Schülerspiel, Schauturnen, Schüleraufführungen [75] musikalischer Art ist nicht die Rede. Selbst von dem Gesang der Alumnen in Schule, Kirche oder auf der Straße fällt kein Wort. Es war dies so alltäglich, so gewohnheitsmäßig, daß es nicht sonderlich interessierte.
Aber nun die Ergänzung zu all diesem Schultreiben und die Erholung davon – so weit solche überhaupt nötig war, denn von Überbürdung ist ja überhaupt nicht die Rede.
An erster Stelle wäre hier das Lesen zu nennen. An Zeitungen werden die in Leipzig erscheinende Sachsenzeitung und der Merkur genannt, die über die Vorgänge im Sachsenlande unterrichteten; dann die zwei damals bekanntesten belletristischen Blätter: die Abendzeitung und das Morgenblatt, aus denen er auch wohl der Mutter vorlesen muß. Dann natürlich Taschenbücher, Musenalmanache, in denen auch einmal etwas von Goethe zu lesen ist. Von Dichtern werden Körner und Schiller oft genannt. Sein Freund Blöde regte hierzu lebhaft an. Er findet ihn über Körner sitzend und liest gleich mit. Nach der ersten Lektüre von Zriny, den er erst in Unterprima kennen gelernt hat, trägt er ein: Schön sind die kühnen Charaktere eines Zriny, eines Juranitsch, einer Eva, einer Helene! Die Freunde singen zusammen Körnersche Lieder. Blöde beabsichtigt zu Fastnachten, mit seinen Freunden den Nachtwächter aufzuführen, doch wird nichts daraus. Die Nachricht vom Tode des Vaters Körner bucht Julius mit Empfindung. Groß ist die Einwirkung Schillers. Er besitzt dessen Werke nicht selbst; da muß der Onkel Jurist im Finanzministerium aushelfen; Bände werden geholt und zurückgetragen. Alles wird gelesen, wie es der begeisterte deutsche Jüngling vielleicht heute noch tut: Macbeth, Turandot, Der Neffe als Onkel, Demetrius und Warbeck. Theaterbesuche knüpfen sich aber nicht oft an dieses Lesen. Am 15. Dezember 1831 besucht er eine Vorstellung der Räuber, aber leider ist es die Mannheimer Bearbeitung für die Bühne, also zu versöhnlich! Schweizer und Franz sterben nicht, Karl entläßt Schweizer und Kosinsky, damit sie bessere Menschen werden. Dies war allerdings dem Geiste des Stückes nicht angemessen. An diesem Abend ernteten Pauli als Franz und Eduard Devrient als Karl „wüthenden Applaus“. Von Schillers Liedern singt er voll Begeisterung [76] das Reiterlied; eine Strophe aus den „Künstlern“ lernt er aus eigenem Antrieb auswendig.
Auch Goethe hat ihn erfaßt. Blöde besitzt einen Faust. Sie nehmen ihn mit, wenn sie in den Palaisgarten gehen, um Fliederduft zu genießen. Er borgte sich auch dieses Werk aus, und manchmal heißt es: ich ging mit der Pfeife und dem Faust in den Garten und legte mich ins Heu. Im Winter besuchte er die Aufführung des Stückes. Auerbachs Keller und der Osterspaziergang gefallen ihm am besten. Die letzten Gretchenszenen verstimmten ihn und den Freund sehr. Neben diesen drei Größen werden auch des Voß Luise und Wielands Musarion gelesen; zu seinem Erstaunen wird hierin die in der Schule so gepriesene griechische Philosophie schlecht gemacht. Von Goethes Tode, der in die Zeit des Abiturientenexamens fällt, wird im Tagebuche nichts vermerkt.
Von neueren Dichtern jener Zeit seien Raupach, dessen Schleichhändler er liest, und Müllner genannt, dessen Schuld in jener Zeit so viele packte. Stellt Elisa von der Recke dies Werk doch fast auf gleiche Stufe mit den Stücken Goethes und Schillers! Eine umfassende Romanlektüre wird durch Vermittelung der Leihbibliothek getrieben: Cooper, Tromlitz, Caroline Pichler, Luise Brachmann. Einen seltsamen Titel führt ein Werk des Hans Falk: Elektropolis. Der Inhalt wird nicht angedeutet. Immer und immer wieder ist von Zschokke’s Novellen die Rede. Er lacht oder er weint bis zu Tränen, wenn er über ihnen sitzt. Das neue Deutschland tritt uns nur in Börne entgegen, der die Freunde sehr beschäftigt; merkwürdigerweise wird Heine nicht erwähnt. Geschichtliches tritt ganz selten auf; die Vorbereitung für das Examen nimmt hier viel Interesse in Anspruch. Sie lesen Pölitz’ Sächsische Geschichte und fragen sich darüber aus. Und doch wird einmal zu Llorentes Geschichte der Inquisition (im Auszuge) gegriffen. Bücher ganz gewöhnlichsten Tagesinteresses werden nicht genannt; nur einmal bringt eine gute, alte Großtante die Lebensbeschreibung einer berühmten Giftmischerin mit!
Zu den Freuden des Lebens war bei ihm auch die Musik zu rechnen. Die älteren Familienmitglieder regen ihn schon dazu an. Der Vater spielte die Flöte, die Mutter und deren Schwester hatten [77] in jüngeren Jahren viel gesungen und die Harfe gespielt. Er lernte erst Klavier und hat gar manchmal mit der Mutter ein „Doppelstück“ d. h. vierhändig gespielt. Dann wurde es ihm durch die Güte des Vaters möglich, bei Berggold Unterricht in Gesang und Gitarrespiel zu nehmen. Er borgte sich für 8 Gr. monatlich und gegen Schadenersatz eine Gitarre und eilte mit ihr beglückt nach Hause: mit einem Griff in die Saiten trat er in die Wohnung. Nun wurden beide Instrumente abwechselnd gepflegt. Er spielt sich den Don Juan durch, singt aus Reißigers Fräulein vom See, die Holteischen Polenlieder, das Lied an Alexis, den Jäger von Reichard, ferner Teile aus der damals so beliebten Schweizerfamilie, voran das heimlich trauliche „Setz dich, liebe Emmeline, nah, recht nah zu mir!“ Von der Aufführung der Zauberflöte in der Singakademie mitten in den Maturustagen war schon die Rede: ein blinder Baron blies die Flöte dabei. Das Palmsonntagskonzert im alten großen Opernhaus mit einer Messe von Hasse, mit einer „Beethovenschen“, wird besucht; eine Arie aus dem Renegaten singt die Palazzesi[23] mit ihrer Nachtigallenstimme dazwischen. Die ganze Familie geht am 15. Juni 1832 in ein Orgelkonzert in die Kreuzkirche. Das Theater wird nicht allzuoft besucht; er gehörte also nicht zu den Schülern, gegen die auf Grund eines Synodenbeschlusses wegen allzuhäufigen Theaterbesuches, der doch schädlich wirken müsse, vorgegangen wurde. Über eine Aufführung in Meißen werden nur lustige Anmerkungen gemacht, der Theaterzettel zum „Löwen von Kurdistan“ nach W. Scotts Talisman (erster Platz 4, zweiter 2 Groschen!) wird als Andenken dem Tagebuche einverleibt. In einem Neustädter Dilettantentheater will ihm das Augenspiel der auftretenden Mädchen (Theater im Theater!) zu den im Publikum sitzenden Freunden und Freundinnen nicht gefallen. An die wenigen bedeutenden Stücke, die er im Hoftheater gesehen, schließt sich, wie ein Satyrspiel, der Besuch der Theatervorstellungen bei Direktor Magnus an. Nicht als Kreuzschüler, sondern im Sommer 1832 als Leipziger Student hat er diese besucht.
[78] Wer unter den alten Dresdnern entsänne sich nicht dieser Truppe, deren Aufführungen unter der Witwe des einstigen Direktors, zuletzt nur noch auf der Vogelwiese, den Tummelplatz wüsten Unsinns abgaben?
Wie es scheint, ist schon unter Magnus, als er in späteren Jahren hier spielte, der Unsinn das Wichtigste gewesen. Im September ging Julius mit seinem Bruder über den Zwinger und den neuen Steg nach der Friedrichstadt. Als sie sich die Plätze ausgesucht, sich niedergesetzt, die Pfeifen angezündet und sich einen Topf Bier geholt hatten, begann das Schauspiel: „Band und Halstuch“. Es wurde leidlich gespielt, besonders machte sich der alte Magnus als Schulmeister gut. Hierauf kam eine plastisch-mimische Darstellung, die sehr zum Lachen eingerichtet war. Nach dem Schauspiel ging das Tanzen mit den anwesenden Mädchen, unter denen sie einige kannten, los. Nach dem Tanze führt der jüngere Bruder eine nach Hause und erzählt ihr, als sie am Rabenstein (Löbtauer Schlag) vorbeikommen, Schauergeschichten von einem, der am selbigen Tage in Meißen hingerichtet worden war. 14 Tage später gehen sie noch einmal hinaus. Es wurde „Conrad der Stählerne“ gegeben. Diesmal wurde Magnus mit seiner ganzen Sippschaft ausgepfiffen und ausgelacht. Mehrere Schauspieler vom Hoftheater hörten mit zu. Als Magnus malitiös wurde, pfiff ein Teil noch lauter, andere schrieen Ruhe. Zuletzt war die Gefahr einer Prügelei sehr groß, bis sich die Schreier, mehr vorsichtig als tapfer, entfernten.
Andere künstlerische Anregungen werden ganz selten erwähnt. Nie ist davon die Rede, daß die hochberühmten Dresdner Sammlungen besucht werden. Es war damals ebenso schwierig, wie kostspielig, in die Gemäldegalerie, die im jetzigen Johanneum untergebracht war, zu gelangen. Ein ganz ungünstiger Aufgang, eine Wendeltreppe im Stallhof, auf der Modergeruch herrschte, führte zur Eingangstür. Oben mußte man an der verschlossenen Türe oft zweimal läuten; ein alter mürrischer Diener öffnete im April bis zum September zwischen 9 und 12 Uhr. Der Diener erwartete stets ein Trinkgeld. Fremde mußten außer der Zeit an den Direktor einen Dukaten bezahlen! Erst ein anonymer Artikel des bedeutenden Kunstforschers Direktor Waagen in Berlin, den die Leipziger [79] Zeitung im September 1836 veröffentlichte, schuf Wandel.[24] Ausstellungen und Arnolds Auslagen boten mancherlei Anregung. So gefällt ihm ein Bild, das eine der Napoleonischen Schlachten zeigt. „Napoleon sitzt auf einem Hügel und besieht die Gegner durchs Fernrohr, im Hintergrund geht die Schlacht vor sich.“ Gewiß waren ihm die Bilder aus der Zeit des großen Kaisers, den seine Eltern ja in Dresden mehrmals gesehen hatten, geläufig genug. Haben wir solche doch noch vor 1866 und 1870 in den Wirtsstuben sächsischer Gasthöfe auf dem Lande häufig gesehen. Lasen doch selbst Mädchen damals fleißig über Napoleon und sind in Schriften über ihn bewandert. Einmal droben an Moreaus Denkmal bittet ein Mädchen den Kreuzschüler um Angabe einer Biographie Moreaus.
Unter den ausgestellten Bildern entzückt ihn einmal eines von Professor Retzsch „die Hoffnung“. Der Kunstausstellung war 1831 eine kleine Industrieabteilung angegliedert, die Geräte und Vorkehrungen enthielt für den Fall, daß die Cholera nach Dresden kommen sollte, also der Embryo einer Dresdner Hygieneausstellung.
Ein Wort von der körperlichen Erquickung! Im Sommer ist es das Baden und Schwimmen. Der Fischer, zu dem er geht, hält nahe dem Lincke’schen Bade einen größeren Kahn bereit, von dem aus ein Sechser- oder ein Groschenbad genommen werden kann; wahrscheinlich je nach der Tiefe, die er bieten kann. Mit diesem Kahn war der Besitzer einst bis nach Hamburg gefahren, auch hatte er ihn während der Kriegszeit versenkt gehabt. Im Kahne kleiden sie sich aus und wieder an oder kriechen unter, wenn ein tüchtiges Wetter kommt. Im August des Sommers 1831 kann der junge Mann zu seiner Freude und zu seinem Stolz das Schwimmen genügend; ein Prof. Eckstein regt ihn nur noch dazu an, das Schwimmen auf dem Rücken zu lernen. Vom Fechten bei Theile war schon die Rede.
[80] Tüchtige Bewegung gab auch das Spiel mit Freunden und Freundinnen: Blindekuh; Jacob, wo bist du? Angebrannt. Stillere Spiele waren: Griechen- und Türkenspiel; Höllenfahrt, Hans mit dem Strich, manchmal Vingt et un um wenig Pfennige, wohl auch Schach. Zettelschreiben, Verlobung und Brautschaft, allerhand Geheimspiele seien noch erwähnt.
Von Turnen, von Sport, von Ballspiel, aber auch von gewöhnlichem Kartenspiel kein Wort. Fürs Spazierengehen bietet der Große Garten die nächsten Freuden; unter der Großen Eiche wird gelesen; bis zu den 7 Brüdern, einer einst viel bewunderten Baumgruppe, wird gern gewandelt. Oft wird bei Cagiorgis eine „Semmelmilch“ eingenommen; im Winter lassen sie sich auf dem Teich Stuhlschlitten fahren. Wie oft ist abendliches Begleiten der Mädchen! Am 18. Oktober führen sie sie nach Klengels Garten und necken sie, da sie trotz des Mondscheins Laternen mitgenommen hatten. Bis zu Klengels Garten war eben die nächtliche Beleuchtung noch nicht vorgedrungen!
Daß der Gang nach der katholischen Kirche oder das Stehen vor ihr, ebensowie der Besuch der Wachtparade, vor allem einmal über die Brücke und wieder zurück sehr üblich war, geht aus manchen Eintragungen hervor. Eigentümlich ist es, daß die Jugend gern in Auktionen geht, wenn die Nachlässe bekannterer Personen versteigert werden.[25]
Gar manche Wanderung hat ihn aber nach Loschwitz, Wachwitz, Pillnitz, nach Lockwitz, Kreischa, Weesenstein geführt! Es war schon eine Leistung, wenn damals von Jünglingen und Mädchen auch in die entfernteren Ortschaften zu Fuß gewandert, dann alles Wichtige besehen, natürlich auch getanzt und nach Dresden wieder zurückgegangen wurde. Brach Regen aus, so gingen wohl entsprechend der Biedermeierzeit drei Freunde unter einem Regenschirm leidlich gedeckt.
Zu Pfingsten ist er mehrere Tage zu Besuch beim Freunde Schnabel in Loschwitz auf der jetzigen Viktoriahöhe mit ihrem großen „Berg“. Am Tage laufen sie herum, gehen in des Prinz Friedrich August Mitregenten Weinberg, sehen Depeschen in einer [81] Grotte liegen, erblicken des Prinzen Reittiere und seinen Beichtvater, den Pater Francesco. Sie treten an das Wildgatter und locken die Hirsche heran. Vergnügt geht es zurück nach Freund Schnabels Weinberg. Im Bett wird noch gesungen, geraucht und Horaz gelernt. „Draußen heulte der Sturm, uns wiegte er aber in den Schlaf“.
Wenn es dann wieder nach Dresden zurückgehen soll, besteigen sie wohl das gerade anhaltende Pillnitzer Küchenschiff und fahren auf ihm herein. Sie treffen einen Studenten, der schon zwei Jahre auf Reisen ist. Sie hören seinen Erzählungen gespannt zu und führen ihn, in Dresden angekommen, nach dem kleinen Rauchhaus, das bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts als eine gute Unterkunft für bescheidene Leute galt.
Wie freute sich der Stadtsohn, wenn er bei einer Wanderung nach Kreischa 25 Weiber auf dem Hof sitzen sah, die Schafe auf ihren Schoß gebunden hatten und nun die Schur vornahmen. Wie lustig ein Ausflug mit befreundeten Mädchen früh 8 Uhr nach Lockwitz zum Rittergutspachter! Sie dringen in die Kirche vor, ein Bauernjunge tritt die Bälge zu des Kreuzschülers Orgelspiel; es folgen Spiele im Garten, ein lustiger Besuch bei Grellmanns, ein Tänzchen; zu Fuß geht’s nach Hause. Ebendahin bringt sie eine Winterfahrt zum Ball trotz genagelter Schuhe. Nachts 1 Uhr ist der lustige Abend zu Ende. Es wird noch eine Zigarre geraucht; die Dresdner Geheimratstöchter versuchen es auch, doch will es ihnen nicht schmecken. Mit Nüssen reich versehen, kriechen sie in die Betten und „fressen“ darauflos; im Nebengemach sind die Mädchen gebettet. Da geht denn ein lustiges Klopfen an den Wänden los.
Stärkere Ansprüche stellte eine Wanderung nach Weesenstein in den Großen Ferien. Früh 5 Uhr geht es über die Lugschenke nach Dohna, Falkenhain und so nach Weesenstein. Hier besucht man den Aussichtstempel, dessen Inschrift abgeschrieben wird. Kurz vor Antritt des Heimweges kommt ein furchtbares Gewitter. Als es vorüber ist, was nun? Ein Bauer wird wegen eines Wagens begrüßt: Ja, das habe er schon manchmal getan und 3 Taler dafür bekommen. „O je!“ Nun ging’s durch dicksten [82] Schmutz unter allerhand Unsinn mit den befreundeten Mädchen nach Dresden zu Fuße zurück.
Zwei Glanzpunkte in jenem Jahre 1831 waren für ihn ein Aufenthalt in Meißen unter den günstigsten Bedingungen und 8 Tage beim „Herrn Accisinspektor“ Zumpe, dem lieben Verwandten in Neustadt bei Stolpen.
Zu Ostern nahm ihn sein Freund Gustav Blöde mit zu einer in der Meise wohnenden wohlhabenden Familientante, Demoiselle Vetter. Ein Gutshof mit Scheune und Viehställen, ein sehr hübsches Wohnhaus, gemütliche Zimmer, eine geräumige Diele, auf der gern einmal Meißner Mädchen sich herumschwenken ließen, eine sehr gut ausgestattete Bibliothek, sehr gutes Essen (täglich gebucht!) gaben eine sehr behagliche Stimmung. Viel heiterer Verkehr mit der Jugend der Stadt, die Gesellschaft eines strebsamen Kandidaten, den die gütige Dame begönnerte, die fesselnde alte Stadt und ihre reizvolle Umgebung gestalteten diesen fast 14 tägigen Osteraufenthalt zu einem wahren Hochgenuß. Und dabei allerhand kleine Abenteuer! Schon die Fahrt nach Meißen – höchst interessant für den Primaner. Vorsichtig wurden schon zwei Tage vorher Plätze beim Meißner Boten in Neustadt bestellt. War doch einmal vor einer Fahrt nach Grimma die Tante Zumpe in heller Angst auf die Dresdner Post gelaufen, denn sie fürchtete, für sich und ihren Sohn, den späteren Dr. Julius Zumpe in Dresden, keine Plätze mehr zu bekommen. Nach Meißen hatten sich nicht weniger als 18 Personen zusammengefunden. Halb 5 Uhr morgens geht es fort; der Bote schreit: Hurra! Die Fahrt beginnt und endet glücklich. Gar herrlich verbringen die Freunde den Ostermorgen: 3/4 5 Uhr gehen sie über die rauchende Elbe auf die Proschwitzer Höhen, sehen das Schloß höchst romantisch wie aus einem Meere hoch aufragen. Das Mondlicht übergießt den wundervollen Bau; allmählich steigt die Sonne in aller Pracht empor, und unten im Tale unterscheiden sie Schiffsmühlen und Kähne; Schüsse fallen von verschiedenen Seiten. Sie schneiden sich von der Pappel, unter der sie gesessen, etwas Moos ab und legen dies in ihre Tagebücher. Am anderen Tage geht es nach dem Buschbad und auf den Götterfelsen. Am herrlichsten ist es in Siebeneichen. [83] Sie dürfen den großen Saal betreten und schreiben sich ins Fremdenbuch. Dann durchwandern sie den Park am rieselnden Bach bis zu einer Steinbank und sprechen versuchsweise in – Jamben. Darauf beginnt Gustav Blöde, mächtig Verse zu schmieden auf treffliche Männer, auf geliebte Mädchen. Wandern sie durch das Spaargebirge, dann kehren sie wohl zu einer Semmelmilch ein; einmal versuchen sie auch Lauer, ein „Nachwein“, auch Treber- oder Tresterwein genannt, der ihnen aber wie sauere Gurken schmeckt.
Den nachhaltigsten Eindruck machten aber wohl die Besuche, die sie dem Maler Kersting abstatteten, dem ehemaligen Lützower, den wir durch die Berliner Jahrhundertausstellung wieder schätzen gelernt haben.
Hier seien die Worte des Tagebuchschreibers vom 3. April 1831 eingefügt: „Wir gingen zum Malervorsteher, Herrn Kersting, einem sehr freundlichen und treuherzigen Mann, der mir sehr gefiel. Er war (neben dem Domkeller) hinten in seiner Malerstube und arbeitete an dem Bilde von Herrn Dr. Heine, mit Frau und Kind in der Stube am Fenster sitzend, wobei er mit der Pfeife zur Stube hereintretend abgebildet ist. Ein anderes Gemälde, Jesus am Ölberg, stand halbfertig da. Das beabsichtigte er zur Dresdner Ausstellung zu geben. Er zeigte uns ein altdeutsches Gewehr, wo statt eines Steinschlosses ein Schwefelkiesel war, der durch Reiben an einer Scheibe Funken gab und so entzündete; dann auch ein Paar Pistolen von Lazaro Lazarino.“ Auch am 4. April begrüßten sie den ihnen liebgewordenen Mann. „Er war so bieder und freundlich wie neulich. Als wir im Begriffe waren fortzugehen, kam das Gespräch beim Anblick der kleinen Statue, die die Arbeiter ihm nach der Gipsfigur von Rauch abgegossen und geschenkt hatten, auf Göthen. Nun erfuhren wir, daß er sehr gut mit Göthen bekannt sey, und mit Körnern, der in der Compagnie der Lützowschen Jäger, wo er gestanden, Oberjäger gewesen sey. Als Göthe einmal nach Dresden gekommen sey, so hatte Körner, der es erfahren, Herrn Kersting beredet, ihn zu besuchen. Herr Kersting hatte es gethan, war sehr freundlich von diesem großen Manne aufgenommen worden; noch zuletzt hatte er Herrn Kersting zugerufen, er [84] wünsche ihrer guten Sache glücklichen Erfolg, den schönsten Sieg. Einmal hatten sie um einen Feldkessel voll Punsch herumgesessen, als ein Hauptmann hereintritt und fragt, wer als Freiwilliger Bagagewagen mitnehmen wollte. Da es so Viele wollten, mußte geloost werden, und unter diesen war auch Körner, den sie nach ein Paar Stunden mit den anderen Verwundeten todt hereingebracht hatten. Auf der Reise nach Thüringen hatte Herr Kersting Göthen wieder besuchen wollen, war jedoch erst zum Hofrath Meyer gegangen, dem innigsten Freund von Göthen, und hatte ihn gefragt, ob er könne zu Göthen gehen, da dessen Zeit doch so eingetheilt wäre. Dieser hatte sogleich ein Billet an Göthen geschrieben, worauf dieser geantwortet, er möge dreiviertel auf 12 Uhr kommen. Als Herr Kersting hingekommen, habe er eine lange Zeit im Vorzimmer gewartet und sich umgesehen. Unter anderem hatte auch ein Napoleon unter einem Thermometer mit Quecksilber gestanden. Auf einmal rauscht es hinter ihm, und er erblickt Göthen; dieser kann nehmlich durchaus nicht das Geknarre der Thüren leiden. Wenn er daher auf Reisen gewesen, so hat er stets ein Bischen Oel mit sich geführt, um in dem Gasthofe knarrende Thüren einölen zu können. In seinem eigenen Hause hat er die Thüren mit Pappier überklebt; sie werden in die Wand hineingeschoben; das Pappier hängt stellenweise an der Thüre lose herab, was natürlich gegen das Andere sehr absticht. Sein Platz ist so gemessen, daß er ein Sopha nur für zwey Personen hat. Herr Kersting hatte doch die Genugthuung gehabt, daß Göthe geäußert, er hätte es ihm übel genommen, wenn er ihn nicht besucht hätte. (Im Jahre 1825.)[26] Ueber der Göthe-Figur hieng ein von Herrn Kersting [85] gemaltes Bild, wo er als Lützowscher Jäger von seiner Braut (jetzigen Frau) Abschied nimmt. Um acht Uhr verließen wir diesen herrlichen Mann.“
Noch ein drittes Mal besuchten sie ihn, und diesmal sprach er von Theodor Körner mit ihnen, gab ihnen auch die Geschichte des Lützow’schen Freikorps von Sievers. In Körners Leyer und Schwert hatte er über die Stellen, die von Tiedge korrigiert, mit Bleistift die eigentlichen Worte Körners geschrieben, da er fast alle Gedichte auswendig kann.
Nachdem sie in Meißen einzig schöne Tage verbracht haben, geht es wieder mit dem Botenwagen nach Dresden zurück. Schon um 4 Uhr stehen sie auf, 1/2 6 Uhr sind sie an der Meißner Brücke; es geht über Sörnewitz, Kötzschenbroda und die Weintraube der geliebten Heimatstadt zu; 1/2 10 Uhr langen sie an der Postsäule vor dem Weißen Tore an. Noch manchmal schauten sie in Sommertagen, wenn sie im Palaisgarten „auf dem Berge“ saßen, sehnsüchtig nach der Meißner Gegend und gedachten der Freunde und der heiteren Mädchen, mit denen sie spaziert und getanzt hatten.
Eine zweite lustige Episode bildete die Wanderung zu Onkel und Tante nach Neustadt bei Stolpen. 1 Taler 8 Groschen gibt ihm der Vater mit. Der Abmarsch von Dresden verzögert sich, denn der mit ihm wandern will, muß erst noch in der Stadt herumlaufen und – sich Geld borgen. Endlich ist es so weit. Vier andere Primaner geleiten die Freunde bis nach Pillnitz. Unterwegs singen sie Studenten- und Liebeslieder, nennen dabei die Namen ihrer geliebten Mädchen und fragen einander trotzig, ob jemand etwas an ihr auszusetzen habe. Geschieht dies, dann bedrohen sie sich mit den Stöcken. Als sie an den königlichen Garten kommen, wurde der Freund, wegen seines Ränzels, von [86] der Schildwache zurückgewiesen. Alsbald geht es unten herum, durch den Ort, nach Ober-Poyritz, Großgraupa hinüber und nach dem als höchst romantisch bezeichneten Wesenitzgrund, über die Lochmühle nach Lohmen; und bald ist man in Neustadt, am ersehnten Ziele.
Eines der ersten Geschäfte war, die Dresdner Gesundheitskarte auf dem Rathaus vorzulegen. Dieses „gebührenfreie“ Papier lautet:
gültig nur für die Dauer der unten bemerkten Reise.
Dem Kreuzschüler Herrn Julius Rachel von hier, 18 Jahr alt, wird zu der Reise, welche derselbe, um Verwandte zu besuchen, von hier über Lohmen, Hohnstein nach Neustadt b. Stolpen und von da nach Dresden zurück innerhalb der nächsten sieben Tage machen und den 30ten Sept. antreten will, in Gemäsheit der Verordnung vom 13ten August 1831, zum Ausweis über den guten Gesundheitszustand der hiesigen Residenzstadt die gegenwärtige Legitimationskarte hierdurch ertheilt.
Gegeben zu Dresden den 29ten September 1831.
von Oppell.
Anmerkungen: 1.) Diese Karte ist in jedem Nachtquartier zu visieren. 2.) Wenn der Inhaber derselben sie einem Andern giebt, um ihm dadurch zu seinem Fortkommen zu verhelfen, so verfällt er in eine Strafe von acht Tagen bis zu vier Wochen Gefängniß. – Das Neustädter „Visum“ aber lautet:
Herr Produzent hat sich seit dem 30ten September c. ai. in hiesigem Orte aufgehalten, woselbst der Gesundheits Zustand gut ist.
Neustadt bei Stolpen den 3ten October 1831.
Die Oktobertage in Neustadt und Hohenstein bringen nun außer Gesellschaften im Hause Kirmesmahlzeiten, lustige Tanzabende, überhaupt kleinstädtisches Idyll, Festzeiten für Herz und Magen, in denen sich der junge Mensch gar glücklich fühlt. Es fehlt beim Residenzler nicht an Kritik. So nennt er einmal die Tanzmusik aus Schandau nicht Schandauer, sondern Schandmusik. [87] Er wundert sich, daß der Apotheker in Hohnstein zugleich den „Italiener“ mache, d. h. Delikatessen verkauft. Manches neue lernt er kennen. So spielt der alte Vater seines Onkel Zumpe die aus lauter Glasglocken bestehende Harmonika, ein Instrument, das Ende des 18. Jahrhunderts zu Zeiten des Kapellmeister Naumann und Elisas von der Recke soviel Aufsehen erregt hatte, nun aber fast vergessen war.
Bedeutenden Eindruck machte die Schwester seiner Tante auf ihn. Ein französischer Offizier, der 1813 in ihrer Heimatstadt Wittenberg in Quartier gelegen, hatte sie kennen gelernt, um sie geworben und sie mit nach Frankreich als angetrautes Weib nehmen können. Sie hatten lange in Givet, an der belgisch-französischen Grenze gelegen, gelebt, von dort aus große Reisen nach Paris, Florenz und Rom unternommen. Nach dem Tode ihres Mannes hatte sie als Madame Lamarc ihre Verwandten in Deutschland besucht und lebte nun für einige Monate bei der Schwester in Neustadt. Sie war nach Sprache und Sitte in den 17 Jahren – echt deutsch! – sehr stark französisch geworden und veranlaßte auch sofort den Dresdner Primaner, sich seiner geringen Künste im Französischen zu bedienen. Im übrigen war sie eine heitere, aufgeräumte Person und wußte den jungen Mann sehr geschickt zu nehmen. Als es zuletzt zum Abschied kam, gab sie ihm für sein künftiges Studentenleben noch allerhand gute Ratschläge und war dabei so liebenswürdig, daß er ihr die Hand küßte. Ja, als er im Laufe des Jahres noch einmal kurz nach Neustadt kam, fehlte ihm in der etwas „kräftigen“ gesellschaftlichen Luft der Kleinstadt die Vertreterin feineren Lebens. Sie hat sich nach ihrer Rückkehr ins Land der Franzosen noch einmal verheiratet, kam, zum zweiten Male verwitwet, wieder nach Deutschland und zwar nach Dresden zurück. Sie steht als ein Überbleibsel napoleonischer Zeit noch vor meinem geistigen Auge mit ihren seidenen Vorstecklöckchen, ihrem halb deutsch, halb französisch gehaltenen Gerede, ihrem Lächeln und ihrer Sehnsucht nach den Tuilerien und dem Louvre und anderen französischen Herrlichkeiten – die alte Madame Lorget, geb. Neumann!
Damals im Oktober 1831 verlebte der junge Kreuzschüler herrliche Zeiten bei den lieben Verwandten. Wie gern wäre er [88] noch länger geblieben, wie gern hätte ihn die Tante und Madame Lamarc noch festgehalten, aber, wie er schreibt, „die Pflicht rief mich hinweg“; er fuhr in des Onkels „Holsteiner“ bis nach Wilschdorf, dann lief er über den Weißen Hirsch und die Saloppe zurück nach der Heimatstadt!
Und nun zu den Freuden, die der Winter damals einem Primanerherzen bot. Der Vater nahm ihm eine Tanzkarte für die Harmoniegesellschaft. Aufs feinste herausgeputzt, im Knopfloch ein zierlich geschnittenes Röschen, von einer kunstgeübten, gemütlichen Familientante gespendet, eilt er hin. Nun tanzt er mit den Schwestern des Freundes, denen er, wenn sie abends spannen, gar manchesmal vorgelesen hatte. Er bewunderte die jungen Polen, die sich damals in Dresden aufhielten, wie sie die Mazurka so ganz einzig tanzten. Wohl machten diese selbst ihre Randglossen über das Mazurkatanzen der jungen Deutschen, konnten dafür aber die deutschen Tänze, namentlich Walzer, nicht sonderlich gut tanzen.
Einen Glanzpunkt im Winter bildete der Ball bei einer aus Polen stammenden, vielleicht jetzt geflüchteten Gräfin Flemming. Madame Klengel, bei der damals die Jugend besserer Kreise in die Tanzstunde ging, hatte den Auftrag, Tanzbeine für einen Flemmingschen Hausball zu besorgen. Er und seine Freunde werden mit dazu auserwählt. Es war ein stolzer Abend für das junge Volk. Gustav Blöde, der einst 1849 wegen Beteiligung an der Revolution nach Amerika flüchten sollte und dort zuletzt Redakteur einer großen Zeitung wurde, wollte der Gräfin Flemming die Hand küssen; sie litt es nicht. Er eröffnete den Ball mit einer jungen Gräfin Henckel von Donnersmark; der Tagebuchschreiber führte eine reizende junge Polin. Erst lagerte feierliche Stille über allen, während deren er die Blumenausschmückung des Zimmers, die angeschraubten Topfgewächse, die nach Art eines Himmelsgewölbes bemalte Decke und die auf einem Diwan thronende Gräfin Flemming betrachtete.
Seltsamerweise war ein sehr mangelhafter Spieler genommen, der sein schlechtes Spiel, ganz ohne Takt, damit entschuldigte, daß die Noten so teuer seien. Als man ihn nach neuen geschickt hatte, kam er nicht wieder, und so spielten junge Leute aus der [89] Gesellschaft abwechselnd, darunter eine Lady George. Selbst die Gräfin mischte sich einmal als Herr in den Schrittanz und besprengte zum Schluß die um sie Stehenden mit duftendem Bergamottöl. Nach einem lustigen Großvatertanz zog sie sich um 1 Uhr zurück. Unter den Damen saß eine in einer grün ausgemalten Nische. Julius war so begeistert von ihrem Profil, daß er ihr sagte, sie komme ihm wie Diana vor. Sie schien das „aber nicht zu kapieren“.
Mit einer gewissen Regelmäßigkeit wurden die Tanzfeste in der Singakademie und in der Harmonie besucht. In dieser ging es damals noch recht einfach zu. Eines Abends singen dort „Tyroler“, 3 Mädchen und ein Mann. Hervorgehoben wird einmal ein vom Weimarer Kapellmeister Hummel geleitetes Konzert, sowie ein Duett, das die Kammermusiker Schubert und Kummer – letzterer aus der bekannten Künstlerfamilie – viel beklatscht, auf Violine und Bratsche spielten. Einmal deklamiert der „andere“ Devrient, ob Eduard, Emil oder Karl, bleibt ungewiß. Zur Tafel bringen die Mitglieder der Gesellschaft, so auch der Stadtrat Rachel, genau wie noch der Weinhändler Piepenbrink in Gustav Freitags Journalisten, den eigenen Wein mit; er wird von den von ihm eingeladenen Gästen für Madeira gehalten. – Einfacher sind die Leistungen der Singakademie; wie so oft, ist auch dieser Musikverein eine Verbindung von Kunst- und Geselligkeitspflege, wobei denn oft weder das eine, noch das andere zur vollen Entfaltung kommt. So heißt es auch: es wurde russische Motion gespielt; zu Sylvester der Sprung ins neue Jahr; von einem dritten Abend heißt es: es war schauderös langweilig.
In jedem Winter gab es für ihn und seinen jüngeren Bruder ein wichtiges Fest: der Maskenball oder die „Redoute“ beim Hofrat Pienitz. Dieser damals sehr angesehene Arzt (med. practicus), mit dem der Vater Rachel sehr befreundet war und oftmals jagen ging, wohnte mit seinem Sohne, Dr. Pienitz jun., auf der Pirnaischen Gasse 227. Der jüngere Bruder Gustav ging einmal als Pole, ein andermal als Korsar, ein drittes als Romeo verkleidet. In seinem Stolze ging er wohl vor dem Balle zur Familie Blöde, um sich den Mädchen des Hauses [90] vorzustellen. Bis zu 200 Personen versammelten sich bei Hofrat Pienitz; doch gab es auch damals schon viel tanzfaule junge Herren, so sehr auch in jeder Generation behauptet wird, früher sei das nicht gewesen, das sei ein neuer Fehler des Zeitalters!
Verkleidungen waren in den Familien, namentlich zu Fastnächten, viel üblicher als jetzt. Als Bierfiedler, als Handelsjuden, als Gärtner mit freundlichen jungen Gärtnerinnen traten die Brüder auf; auch führten sie wohl einen wilden Zigeunertanz auf.
Familienleben, Schulleben, gesellschaftliches Leben, Wanderleben des jungen Mannes sind nun geschildert worden, wie er es aus täglichen kurzen Notizen sich in geordneter Form selbst vorgetragen und festgehalten hat.
Es wäre noch zum Schlusse zu fragen, inwiefern Gemeinde- und politisches Leben von ihm beobachtet worden ist, wie es auf ihn eingewirkt hat.
Das wirtschaftliche Leben in der Stadt selbst hat man sich ja, und mancher Beweis dafür ist schon erbracht worden, recht einfach vorzustellen.[27] Nur einige Proben: So begegnet er einmal dem Vater eines seiner Freunde, dem Herrn von Oppen, als dieser nach der Papiermühle geht, um sich einen größeren Vorrat einzukaufen; er lebte ständig in Loschwitz. Als die Schüler zu ihrem französischen Unterricht ein bestimmtes Buch brauchen, ist es in keiner Buchhandlung aufzutreiben. Freund Schnabel tröstet: sein Onkel, der bald nach Leipzig reise, werde es für sie besorgen. Dieser selbe Schnabel wohnte (Hinter der Frauenkirche 632) so, daß er die von Leipzig kommenden Eilpostpassagiere aussteigen sehen konnte; war Besuch angesagt, so stand er mit dem Gucker am Fenster. Auch erfuhr er gar bald, wenn der Eilpostwagen wieder einmal umgeschmissen war und alle Passagiere im Graben gelegen hatten. Wie selten sich neben den wenigen Herrschaftsequipagen und den Postwagen Personenfuhrwerk durch die Stadt bewegt, beweist die Bezeichnung eines Gutsbesitzerswagens aus der Umgegend als einer Troschke; dieses städtische Verkehrsmittel war eben noch nicht üblich.
[91] In den Hausfluren der Bäcker sah es noch recht kleinstädtisch aus; einmal wollte der Gymnasiast ein eben gekauftes Musikheft schnell einsehen: er ging ins Bäckerhaus und schnitt das Heft auf dem Mehlkasten auf. Noch blies der Nachtwächter in den Straßen der Stadt. Als sie einst vom Linckeschen Bade ans schwarze Tor kamen, blies einer so, daß er überschnappte. Die übermütigen Burschen klatschten ihm Bravo und machten es ihm nach. Noch war es abends schwierig, an entlegenen Stellen von der Elbe zur Stadt heranzugelangen. Sie fahren bei Regenwetter vom Linckeschen Bade über und kommen an das Elbpförtchen, das aber geschlossen ist. Der dabeistehende Soldat rät ihnen: viele Leute gingen auf dem zunächstliegenden Floße hin, sonst müßten sie über die alte Vogelwiese bis zum Ziegelschlage gehen. So war denn nichts anderes zu tun, als sich über das Floß hinwegzuwagen.
Von der sehr mangelhaften Beleuchtung der entlegenen Gassen war schon die Rede. Gerade im Herbst 1831 ging man daran, Gas zur Beleuchtung einzuführen. Am 23. und 25. September sah er die Gasbeleuchtung auf der Brücke vorbereiten; am 12. Dezember, am Geburtstag des Prinzen Johann, brannten die Laternen da zum ersten Male, doch wirkte es wegen des Mondlichtes nur sehr schwach. An demselben Abend gab es zu Ehren des Prinzen im Hotel de Pologne auf der Schloßstraße ein Festmahl. Das dabei aufgestellte Transparent verurteilt er sehr stark; es hätte in einer Dorfkneipe nicht schlechter sein können. Selten hat er, wie’s scheint, jemand von der königlichen Familie gesehen. Als er dem alten König Anton im Großen Garten begegnet ist, bucht er es ganz anschaulich: Er ritt in blauem Frack, hellgelben Lederhosen, gelben Stulpenstiefeln und im runden Hut.
Wenige Tage darauf sah er mit seinem Freunde zusammen im Großen Garten, der damals, wie die Zwingeranlagen, manche Erneuerung erfuhr, wie vor dem Palais die bekannte Gruppe aufgerichtet wurde: der Tod, der in den Armen ein junges weibliches Wesen fortträgt, unter ihm der weinende Amor; es ist die jetzt unter der Bezeichnung: die Zeit entführt die Schönheit bekannte Marmorgruppe Pietro Balestras. Sie sehen bei der [92] Gruppe den Grafen Vitzthum mit seiner Tochter und einem Herrn stehen, die sogleich anfingen, französisch zu sprechen, als die jungen Leute herantraten. Dem Vater des jungen Mannes gefiel das Marmorbild so, daß er wohl scherzend sagte: er wolle sehen, ob er es in der Tasche nach seinem Garten schaffen könnte.
Noch war es damals üblich, die Herrschaften aus der katholischen Kirche über den Gang ins Schloß gehen zu sehen. Die Schüler führten die von ihnen begleiteten Mädchen am Ende des Gottesdienstes auf die Gänge ins Schloß. „In dem einen Zimmer standen schon Menschen, wir gingen daher in das andere, wo gewöhnlich die Supplikanten stehen. Aber da die Herrschaft um 12 Uhr noch nicht da war, gingen wir fort.“ Auch gelang es ihnen einmal durch eine befreundete Familie, einen Hofball von der Galerie aus anzusehen.
Lebhaftes Interesse erregten natürlich irgendwelche unheilvollen Vorgänge: ein Diebstahl im königlichen Schloß oder ein gewaltiges Feuer auf der Hauptstraße. Die Sturmglocke ertönt, der Nachtwächter bläst, der Hornist im benachbarten Zeughofe auch, ja der Tambour rührt seine Trommel, Vater und Söhne werfen sich mitten in der Nacht um 2 Uhr in die Kleider und eilen auf den Brühl. Prachtvoll wirkt das Feuer, das um deswillen ganz gewaltig ist, weil die Getreidevorräte eines Bäckerhauses aufgehen und einen Glutregen hervorrufen.
Am andern Morgen um 6 Uhr ist er schon drüben in der Neustadt, sieht die Sachen der Bewohner noch auf der Straße stehen, sie selbst in Schlafpelz und Unterhosen daneben. Der keckere zweite Bruder, ein künftiger Techniker, ist noch am Nachmittag ins Dachgerüst geklettert.
Mehr als diese schnell vorübergehenden Ereignisse mußten aber drohendes oder tatsächlich eintretendes Unheil das Gemüt der jungen Menschen beschäftigen: ich meine die drohende Cholera, die polnische Revolution und die Unruhen in der Stadt Dresden selbst. Im Mai 1831 kommt die erste Kunde vom Herannahen der unheimlichen Krankheit. Struve, der Sohn des berühmt gewordenen Mineralwasserfabrikanten, 1830 / 31 aus Sekunda abgegangen, aber mit seinen alten Kameraden in enger Verbindung, konnte berichten, daß sein Schwager Hedenus erfahren [93] habe, in Breslau lägen 20 000 krank darnieder und daß Herr Dr. Himmel mit noch zwei Ärzten dahingereist sei. Im Juli steigert sich die Furcht der Leute; alles spricht von der tückischen Natur der Krankheit. Wer angehaucht sei, brauche aber nicht krank zu werden. Die Stadt hatte sich mittlerweile schon gerüstet, dem unheimlichen Gast zu begegnen. Am 15. Juli ging der Vater mit den Söhnen hinaus nach Löbtau auf das Probierhaus, das zu einer Quarantäne eingerichtet wird. Die Betten wurden, da die großen Ferien gerade begannen, aus dem nahen Freimaurerinstitut geborgt, schienen aber doch wohl als Knabenbetten zu kurz zu sein. Die Dielen waren so schadhaft, daß Flüssigkeiten, die vom Kranken ausgingen und nicht gleich gut beseitigt werden konnten, ansteckend wirken mußten. Es waren drei Häuser vorgesehen: A. Kontumazanstalt, B. Cholerakrankenhaus, C. für andere Fieberkranke; weiter hinten im Garten waren die Kloakgruben und der Totenacker vorgesehen. Der Haussekretär zeigte ihnen noch eine Dampfmaschine in B., mittelst deren Kranke mit Essigdämpfen ausgeräuchert werden sollten.
Während man hier in Ruhe und Gemessenheit bedachte, kamen aus Petersburg Nachrichten, nach denen man die Tore gesperrt habe und die gemeinen Russen 14 junge deutsche Ärzte ermordet hätten. Im September heißt es, daß in Stettin wegen der Cholera Aufstand ausgebrochen sei; man habe mit Kartätschen geschossen. Die wachsende Zahl der Erkrankungen und der Todesfälle in Berlin bucht er in dieser Zeit. Aus demselben Berlin schreibt er sich die tollsten Witze über die Cholera ab, die Saphir in seiner Zeitschrift: „Der deutsche Horizont“ losgelassen hat. Besonders die furchtsamen Hasen werden darin verspottet. Die Vorkehrungen draußen in der Stadt wirken bis in die Hauswirtschaften hinein. Unter dem 9. September heißt es: Bei uns ist jetzt eine lebendige Apotheke, die Mutter läßt Rezepte schreiben, kauft Räucherwerk und alle Arten Pestessig. Gemüsevorräte werden angeschafft, Reis usw., daß die ganze Garderobe bald vollsteht.
Die Furcht anderer Gemeinden wirkte dahin, daß nicht nur, wie schon erwähnt, im September 1831, sondern noch im Mai 1832, als der junge Studio nach Leipzig fuhr, eine Gesundheitskarte beschafft werden mußte.
[94] Und nun die polnische Revolution. Natürlich hat sie auch ihn sehr beschäftigt. Mit dem Vater, mit den Freunden werden die angeblichen Schlappen, die angeblichen Siege der Polen besprochen; da heißt es, Warschau sei gefallen, ein andermal, es sei in die Luft gesprengt worden; General Diebitsch habe sie über die Weichsel gelockt, 20 000 Aufständische und 8 Generale seien gefallen; dazwischen geht es auch wieder einmal gut. Daß das Mantellied gar gewaltig gefiel, wurde an anderer Stelle erwähnt. Natürlich ragt auch hierin der Berliner Witz bis nach Dresden. Da heißt es: „Diebitsch Sabalkansky, sobald erlangst’s ni.“ Als man hört, dem Grafen Diebitsch sei, wenn er die Weichsel passiere, der Fürstenhut versprochen, sagen die Berliner: bis jetzt habe er nur einen Weichselzopf errungen. Und wenn die Frage aufgeworfen wird, warum die Polen ihre Bauern mit Sensen bewaffnen, lautet der Berliner Kalauer: um Sensation zu erregen.
Als Diebitsch an der Cholera starb und gleichzeitig der russische Gesandte Alopëus in Berlin an einer anderen Krankheit, wurde auf die Frage, wer von ihnen zeitiger in den Himmel komme, geantwortet: Alopëus, denn Diebitsch müsse erst 21 Tage Quarantäne halten.
Die Nachwirkung der Julirevolution zeigte sich darin, daß der Primaner seinem Tagebuche anvertraut, er habe, wie er zunächst fälschlich schreibt, die Marseillade auswendig spielen gelernt, die er am 7. Mai zu seinem Vergnügen, als er auf dem Brühl spazieren ging, vom Orchester spielen hörte.
Mehr als all dieses aber interessierten die politischen Vorgänge in der Heimatstadt. Er hatte die Septembertage von 1830 mitdurchlebt, zu einer Zeit, als er noch nicht Tagebuch führte, wußte aber, daß seinem Vater befreundete Männer in jener Zeit solches geführt hatten. Der Vater selbst hat so gut wie nichts davon in sein Buch eingetragen. Der 31. Oktober des Jahres 1830 hatte in der Einführung der am 14., 15. und 16. gewählten Stadtvertretung in den sogenannten Kommunalrepräsentanten einen mächtigen Fortschritt gebracht. Obwohl nun der Konrektor der Kreuzschule Baumgarten-Crusius zum stellvertretenden Vorsitzenden für den Obersteuerprokurator Eisenstuck gewählt worden war, [95] wird diese neue Versammlung nicht erwähnt. Nur als der Konrektor einmal einige kräftige deutsche Redensarten als Beispiel bringt, bezeichnet der Chronist diese Bemerkungen als recht „kommune“ Witze.
Die Befürchtung, daß bei den vom neuen Ministerium Carlowitz geleiteten Beratungen über die Verfassung nicht viel herauskommen werde, war vielfach vorhanden. In Berlin kristallisierte sie sich natürlich zu Witzelei, und so wird gebucht, man sage dort, da ja neben dem alten König Anton der Prinz Friedrich August als Mitregent bestellt worden war, Sachsen habe nun einen zweischläfrigen Thron.
Die ersten Unruhen im Jahre 1831 entstanden am 16. März. Liederliches Gesindel hatte die Schildwache beim Pulvermagazin überfallen, zu Boden geworfen und hätte sie erwürgt, wenn nicht Ablösung gekommen wäre. Dann hatten sich die Unruhstifter zerstreut, auch Steine in den neuen Weißeritz-Durchstich geworfen und gerufen: Arbeit für uns! Später waren sie vor des Minister Carlowitz Haus gezogen, hatten aber, als sie hörten, er sei nicht daran schuld, daß niedrigere Löhne gezahlt wurden, sondern die Straßenbaudirektoren, gerufen: Vivat Carlowitz! Sogleich war nach Gorbitz eine Signalkanone gefahren worden, und jeden Abend ritt ein Pikett von 12 Kavalleristen dahinaus. Zwei Tage nach dem Vorfall waren auch 150 Kommunalgardisten aufgefordert worden, zur Aufrechterhaltung der Ruhe in der Friedrichstadt aufzumarschieren. Nur 80 kamen, und als sie auf Befehl ihres Herrn Hauptmann luden, lief unter allgemeinem Gelächter der Schneidermeister Beck vor Schreck davon. Einen Monat später, Sonntag den 17. April, brechen nun aber ernstere Unruhen aus.
Die unzufriedenen Elemente unter den Bürgern hatten sich zu einem sogenannten Bürgerverein zusammengeschlossen. Sie bestanden vielfach aus früheren Nationalgardisten, die nach der Septemberrevolution durch die Kommunalgarde unter dem Kommando des Prinzen Johann ersetzt worden waren.
Diese Nationalgarde, die in den aufregenden Monaten des Jahres 1809 gegründet worden war, war, weil sich etliche in den Unruhen des Jahres 1830 als unzuverlässig gezeigt, sich [96] geradezu dem Dienste entzogen hatten, am 4. Dez. dieses Jahres im Gehege kurz und bündig, ganz militärisch aufgelöst worden. Die Unzufriedenen hatten den Wunsch, in irgend einer besonderen Form der neu gegründeten Kommunalgarde, die in fünfunddreißig Sektionen gegen 6 000 Mann zu stellen hatte, eingegliedert zu werden. Die Gleichgesinnten trafen sich häufig im Café Creutz an der Schreibergassenecke und bildeten bald den sogenannten Bürgerverein. Da in der Kommunalgarde auch Adlige und Beamte waren, wollten sie, den Begriff Bürger im engeren Sinne fassend, eine eigene Bürgerabteilung bilden.
Allmählich, besonders als am 1. März 1831 der Entwurf der Verfassungsurkunde bekanntgegeben worden war, schwand das Interesse an dieser sehr lokalen Frage der Nationalgarde oder Kommunalgarde; man beschäftigte sich, namentlich seit dem 25. März, mehr mit allgemein politischen Dingen. Es wurde über einen Gegenentwurf zu der in Aussicht gestellten Konstitution beraten, und man dachte daran, die Kommunrepräsentanten, die ja ebenfalls eine neue Städteordnung zu erwarten hatten, zu gemeinsamen Beratungen über die künftigen Staatsverhältnisse heranzuziehen.
Damit verließ der Bürgerverein tatsächlich den gesetzlichen Boden. Die Regierung verbietet dieses Auftreten; trotzdem fordert der Verein am 30. März die Bürgerschaft von neuem dazu auf, sich an ihn zu wenden. Darauf verfügt die Regierung am 6. April die Auflösung. Sie war um so mehr dazu verpflichtet, als sich im Monat März, wie schon berichtet, Tumulte und mancherlei gesetzwidrige Haltung in Dresden bemerkbar gemacht hatten. Aber diesem Befehle wurde nicht Folge geleistet. Der vom Branntweinbrenner Petzold, einem früheren Kaufmann Schramm, einem Schneider Drabitius, einem Schuhmacher geleitete Verein, den der auf der Königstraße wohnende Advokat Mosdorf stark beeinflußte, hielt noch weiterhin geheime Zusammenkünfte ab, deren Ergebnis ein in einer geheimen Winkeldruckerei zusammengestellter Verfassungsentwurf von 133 Paragraphen war. Die verzweifelte Stimmung der Verfasser dieses Entwurfes geht aus ihrem Wahlspruch hervor: – und wird sie nicht gewährt, so klopfen wir mit Flintenkolben an. Noch am 16. April wurden [97] zwei der Hauptführer verhaftet. Als dies Sonntag den 17. April ruchbar wurde, sammelte sich auf dem Altmarkt nachmittags allerhand Volk; Kommunalgardisten, bewaffnet, aber ohne Binde, schlossen sich an; man drängte gegen das Rathaus, in dessen Wachtstube die Gefangenen saßen, und verlangte mit dem Rufe: Bürger heraus! deren Befreiung. Da das Rathaus wenig geschützt war, gelang es auch, wirklich die zwei zu befreien. Nun aber wurde Alarm geschlagen: Kommunalgardisten kamen aus allen Teilen der Stadt; ihre Kommandanten, Prinz Johann und Oberst Krug von Nidda, eilten herbei, bald auch der Stadtgouverneur von Gablenz mit einem Bataillon Infanterie. Unter großer Mühewaltung gelang es, nach Besetzung der Zugangsstraßen den Altmarkt von schreienden, johlenden, drohenden, auch mit Steinen werfenden Leuten zu befreien. Die Gefangenen kamen wieder in die Hände der Behörde. Andere wurden dazu gebracht, verhört, entlassen oder unter Bedeckung in die Neustädter Militärstrafkaserne geführt. Die starke Besetzung wichtigster Punkte und eingetretenes heftiges Regenwetter bewirkten, daß die Nacht wenigstens ruhig blieb bis auf Störungen in der Nähe der Annenkirche.
Am andern Tage, Montag den 18. April, erhob sich von neuem große Unruhe, die in den Nachmittagsstunden stärker und stärker wurde. Auf dem Gewandhaus beschäftigte sich eine Volksversammlung in immer stürmischer werdender Verhandlung mit Abfassung einer Beschwerdeschrift, mit drohender Forderung der erneuten Freilassung der Gefangenen. Der vorüberreitende Prinz Johann wurde von Heraustretenden um all diese Dinge stürmisch angerufen, lehnte aber fest und entschieden ab.
Inmittelst drängten beim Dunkelwerden aus allen zum Markte führenden Gassen allerhand Leute, von denen einzelne gedungen oder durch Geldausstreuung herbeigelockt gewesen sein sollen, darunter viele Gesellen, Lehrlinge, Handarbeiter, natürlich auch viele Neugierige, nach dem vom Militär besetzten Markte. Dieses war, da sich die Kommunalgarde nicht allzu zahlreich und nicht völlig zuverlässig gezeigt hatte, in verstärkter Zahl gekommen. Artillerie deckte die Schloßstraße und das Schloß, in dem Prinzessin Amalie mit dem vor 12 Tagen geborenen Prinzen Ernst [98] in den Wochen lag. Auch die Neustadt war durch Artillerie gedeckt. In Altstadt erschienen auch Reiter. Das nach dem Markte vordringende Volk wurde, da es an strenge Maßregeln nicht recht glauben wollte, immer gewalttätiger im Vordringen, im Höhnen und Bewerfen des Militärs, riß das Pflaster auf, benutzte Buden zu Barrikaden, bis zuletzt wirklich geschossen wurde, erst in die Luft, was die Leidenschaft zunächst erhöhte, dann scharf. Tod und Verwundung etlicher bewirkte nun doch aber Flucht der übrigen; erst auf dem Bauplatz der neuen Post sammelten sich wieder einige. Als auch sie nach der Annenvorstadt gedrängt worden waren, erwachte dort auf einmal der Fanatismus; ein Bäckermeister lief auf den Annenkirchturm und läutete Sturm. Schüsse und Säbelhiebe mußten die Menge, aus der ebenfalls Schüsse fielen, auseinandersprengen.
So endigte der fast nur auf das Innerste der Stadt beschränkt gebliebene Aufstandsversuch; große Teile der Stadt waren nicht davon berührt worden.
Die folgenden Tage lag noch allenthalben Militär auf den Straßen, in den Häusern; beruhigende Aufrufe, von der Regierung, der Stadt, den Kommunrepräsentanten oder von einer Gruppe verständiger Bürger erlassen, suchten nach Kräften die Wogen zu glätten. Die Gerichtsbehörden mußten noch viele Wochen verhören, entlassen oder verurteilen.
Wenig erfreulich war es, daß die von der Hauptleitung der Kommunalgardenabteilung eingeforderten Berichte vielfach zugestehen mußten, daß viele Bürger gar nicht gekommen waren, andere sich nicht ganz einwandfrei benommen hatten. Die 33. Kompanie hatte geradezu den Gehorsam verweigert; die 5. Kompanie war nur in geringer Anzahl auf den Sammelplatz gekommen; als der Regen sehr stark wurde, nahm sie Unterstand in Häusern. Dagegen hatte sich die 6. Kompanie in jeder Beziehung recht gut gehalten.
Die 8. Kompanie hatte zwar meist unsichere Elemente, hielt sich aber sehr gut; der Gardist Devrient entriß den Zugführer Heim im entscheidenden Augenblick der höchsten Todesgefahr; da die meisten keine Patronen hatten, mußten sie mit Säbel und Bajonett vorgehen. Die 10. Kompanie mußte in [99] der Wilsdruffer Vorstadt nach langen Versuchen, Ruhe zu schaffen, ebenfalls mit Säbel und Bajonett vorgehen: Diese Angriffe zerstreuten die Elenden im Nu. Die eingelieferten Berichte sind in Stil, Grammatik, Rechtschreibung sehr verschieden, je nach Bildung und Stand. Wird doch einmal statt Laboratorien Labritorien geschrieben.
Dabei waren wohl Leute mit erschienen, die sich früher nie gezeigt hatten, jetzt betrunken antraten und Waffen haben wollten. Sie wurden abgewiesen und beteiligten sich nun am Aufruhr. Die Zahl der Erschienenen schwankt zwischen 2 und 150 Mann. Im ganzen sind 35 Kommunalgardisten verhaftet, nur wenige davon bald wieder freigelassen worden.[28]
Doch nun genug von den allgemeinen Voraussetzungen. Es sei gestattet, von den Eindrücken und Erlebnissen zu sprechen, die in dem Tagebuch des Kreuzschülers und seines jüngeren Bruders, eines angehenden Technikers, berichtet werden.
Der Kreuzschüler erfuhr erst 1/2 6 Uhr auf seinem Gange von der Schießgasse nach der Rampischen Gasse durch Geschrei seines jüngsten Bruders: „’s ist Rebellion, es wird Alarm geschlagen!“ von den Vorgängen. Er sah die Pirnaische Torwache nach dem Zeughaus ziehen und eilte in die Lochgasse hinein, wo er vor lauter Regenschirmen zunächst nicht viel sah. Um so mehr hörte er von den Kämpfen, vom Steinwerfen, vom Durchprügeln. Nach den Erzählungen hatte er den Eindruck, als wenn Kommunalgardisten mit weißer Binde gegen solche ohne weiße Binde gefochten hätten. Die Verhöhnungen des Generals von Gablenz, die entschlossene Haltung des Prinzen Johann haben sichtlich starken Eindruck auf den jungen Menschen gemacht. Als aber der Regen zu stark wurde, zog er sich zurück, um der Familie Blöde viel zu erzählen. Wie zentral die ganze Bewegung war, geht daraus hervor, daß der zweite Bruder in der Reitbahngasse bei befreundeter Familie bis 9 Uhr nichts vom Aufstand vernommen hatte; nur Unruhe in der Kavalleriekaserne war von ihm wahrgenommen worden; erst auf dem Heimweg hörte er davon und drängte nach dem Altmarkt [100] zu; aber es war unmöglich, dahin zu gelangen; so eilte er nach Hause. Als er hier von den Vorgängen hörte, lief er sofort wieder hinaus. Da sah er noch im Halbdunkel der Nacht das Militär in Karree vor dem Rathaus stehen, die Kommunalgarde sich wegen des Regens in die Häuser zurückziehen. Den Lärm vom zweiten Angriff des Pöbels in der Wilsdruffer Vorstadt hörte er. Die Nacht im Hause war unruhig genug. Als neues Trommeln ertönte, warfen sich Vater und Söhne in die Kleider, liefen hinab und fragten den vor dem Hause wachhaltenden Kommunalgardisten, beruhigten sich aber bald und erfuhren noch durch Zurufe den endlichen Ausgang der Bewegung; 1/2 2 Uhr legten sie sich schlafen.
Am Montagmorgen eilte der Kreuzschüler, natürlich ohne viel zu sehen, über das Schlachtfeld, freute sich in der Schule über den Konrektor, auf den als stellvertretenden Kommunerepräsentantenvorsteher das Volk ziemlich erbittert war, und der nun erklärte: „in solchen Zeiten müsse man sich zu einer Parthey schlagen und jeder für seine Parthey reden, nicht wie die stummen Hunde“. Erst nach dem Schluß der Nachmittagsstunden wurde es interessanter. Er hörte, nachdem er alle wichtigen Posten an der Brücke, auf der Schloßstraße und dem Altmarkt abgeschritten war, erneutes Gebrülle. Prinz Johann erklärte auf der Moritzstraße sehr energisch: die Verhafteten seien straffällig, ebenso jeder, der ihre Befreiung erzwingen wollte. Da liefen sie ihm nach und schrien „Brod, Brod, herunter vom Pferde!“, warfen Steine nach ihm, so daß er im Trabe nach dem Altmarkte ritt. Daß die niedrigsten Instinkte sich lebhafter offenbarten, beweist auch der Ruf: „Jude heraus! Heraus mit den Spitzbuben!“, der auf der Rampischen Straße ertönte. Beide Brüder, der eine auf der Schössergasse, der andere auf der Lochgasse, hörten nun das Heranrücken des Militärs, das Rasseln der Kanonen. Der auf der Lochgasse hörte deutlich die Aufforderung des Offiziers, zurückzugehen und aufzuschreiben, was sie eigentlich wollten. Dann waren sie, jeder an seiner Stelle, Ohrenzeugen des Schießens und entfernten sich aus dem Bereiche der Gefahr. Als sie zurückkamen, stand der Vater besorgt an der Haustür und tadelte sie wegen ihrer kecken Neugier. Gar bald zeigte sich’s, daß gerade [101] viel junge Leute, selbst Knaben verletzt worden waren. Verwundete wurden nach dem Klinikum, d. h. dem Kurländer Palais gebracht und bald wieder verbunden herausgeführt. Noch lange erzählten die Brüder, die mehr als der Vater gesehen, von den zerschlagenen Laternen auf der Wilsdruffer Gasse und nach der Annenstraße zu, von den Barrikaden aus Brettern und Steinen, die die Infanterie mit Sturm genommen hatte. Am greulichsten hatte es auf dem Postplatz ausgesehen, wo eine frühere Tierbude und die Bude eines Schweizers, der Automaten gezeigt hatte, wirr durcheinander lagen.
Auch am 19. April waren die jungen Menschen noch stark beschäftigt mit dem Geschehenen: sie durchwanderten die Loch- oder Badergasse, um das vergossene Menschenblut zu sehen. Mitten in der Herodotstunde wurde dem Konrektor ein Brief von einem hohen Staatsbeamten gebracht, aus dem er eine Stelle vorlas, daß die Regierung alles tun würde, wenn die Bürger auch ihrerseits ihre Obliegenheiten erfüllten. Der Brief war vermutlich vom Kanzler v. Könneritz. Magister Sillig aber erklärte gleich zum Anfang der Stunde, daß vielleicht eine Störung durch Sturmläuten kommen könnte, dann möchte jeder eilen, vor dem 14. Schlage zu Hause zu sein. Sofort fangen die Primaner an zu lachen, worüber er sich ärgert. Um 3 Uhr wurden nun alle entlassen, doch von demselben Magister dringend gebeten, nach Hause zu gehen. Wer über den Markt zu gehen hätte, sollte lieber die Nebengassen benutzen. „Jedoch wer das nicht that, waren die, zu deren tauben Ohren er es predigte!“
Es war auch gar zu interessant geworden: an den Hausmauern klebten die beruhigenden Anschlagzettel der Regierung, des Gouverneurs, des Rates. Es waren aus Freiberg und Meißen Truppen gekommen, die zum Teil auf den Straßen und den Plätzen lagerten. Viel Stroh war für die Pferde und die neben ihnen liegende Mannschaft gegeben; Sofa, Tische und Stühle und ein Faß Bier dazu standen für die Offiziere vor einem Hause des Neumarkts bereit. Die Offiziere tranken und aßen, die Gemeinen hatten Holzböcke, worauf Bretter gelegt waren, zu Sitzen. Die Wachen und die „Schläge“ waren doppelt besetzt, Streifpatrouillen durchzogen die Stadt. Die Kommunalgarde [102] hatte gelegentlich höhnische Worte zu hören. Als ein Geselle sich sehr nahe an Gardisten herandrängte, aber zurückgewiesen werden sollte, sagte er auf den Zuruf: „Treten Sie zurück!“ ironisch: „Nur gemach! Ich wollte nur auf ewig von Sie Abschied nehmen, da Sie heute Abend aus dem Leime gehen!“ Die Prophezeiung dieses Mannes hat sich erst achtzehn Jahre später, 1849, erfüllt!
Noch Tage lang sah man Militär in den Straßen Dresdens hin- und herziehen oder lagern; aber im ganzen wurde die Ruhe nicht mehr wesentlich gestört. Dagegen verlauten nun in den Niederschriften der Brüder mehr und mehr Mitteilungen über die Untersuchung der Gefangenen, über zum Teil sehr schnelle und schwere Verurteilungen. Merkwürdig ist die Eintragung, daß Advokat Mosdorf, der als der geistige Leiter der Verfassungsbewegung galt, sich habe durch Hunger töten wollen, daß man ihm das aber ausgeprügelt habe. In Wirklichkeit hat er sich Monate nachher, ebenso wie der Nudel- und Maccaronimüller Bertholdi das Leben genommen, da sie zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt worden waren. Von 80 Verhafteten, deren Namen einer der Brüder sehr gewissenhaft einträgt, wurden 37 entlassen; 25 erhielten 1–10 Jahre Zuchthaus, 16 einen halben bis zu 6 Monaten Gefängnis; einer 1 Jahr. Die gefährlichsten wurden auf den Königstein geführt. Selbstverständlich hieß es von den Rädelsführern wohl auch, sie hätten die königliche Familie ermorden und die rote Republik einführen wollen. Einmal wird der Dienstag, ein andermal der Freitag als der Tag des geplanten Ausbruches genannt.
Als dann nun wirklich mehr Beruhigung eingetreten war, beschäftigte man sich lebhaft mit den Gerüchten, die in anderen Städten über die Dresdner Rebellen ausgesprengt waren. Und man empfand eine gewisse Genugtuung, als in Leipzig, der Nebenbuhlerin Dresdens von altersher, auch Unruhen ausgebrochen waren; und doch hatte der Rat der Stadt Leipzig sich gleich nach den Apriltagen an den König gewandt und ihm bei der Unsicherheit des Aufenthaltes in Dresden für ihn und die königliche Familie einen sichereren Aufenthalt als in seiner Residenzstadt bei sich angeboten.
[103] Kein Wunder, daß man in Dresden bei der Nachricht über heftige Unruhen in Leipzig eine gewisse Schadenfreude empfand.
Dem jüngeren Bruder ist lebhafte Teilnahme an politischen Vorgängen lange geblieben. Es zeigt sich, wie so oft in jüngeren Jahren, ein überschäumender, freiheitliebender Sinn und ein gewisser Groll gegen die Feinde freier Entwicklung. Oft kommt er in seinen Gesprächen mit den Leuten, bei denen er auf seinen beruflichen Reisen über Land zusammentrifft, auf politische Dinge zu sprechen, auf die eigenen Erlebnisse während der Revolutionsjahre in Dresden 1830 und 31 oder auf die zu erhoffende Preßfreiheit. Als er hört, daß Prinz Johann in der Kammer von Bedienten gesprochen und damit Staatsdiener gemeint habe, schreibt er wütend in sein Buch: Schande über den Kerl! Da sein eigner Vater in den für Sachsen schmerzlichen Jahren 1813 bis 1815 Staatsbeamter gewesen war, ist es erklärlich, daß noch in den dreißiger Jahren ein Preußen wenig günstiger Sinn im Hause herrschte. Daraus erklären sich die etwas kleinlichen Eintragungen im Anfange des Jahres 1834, als der deutsche Zollverein unter Preußens Führung ins Leben getreten war. In der Nacht zum 1. Januar war ein heftiger Wind gewesen; daran heftete sich das boshafte Wort: „man sagt, daß der gestrige heftige Sturm davon herrühre, weil dem preußischen Zollverbande die Grenze eröffnet worden wäre und nun der ganze preußische Wind auf einmal herübergekommen wäre“. Oder: als man in Tauchwitz bei Eröffnung der preußischen Grenze den Adler in Prozession wegnehmen wollte, fehlte er, und statt seiner hing ein Zettel da, worauf stand: den Adler hat der Geier geholt; wollte Gott, daß er Euch alle holte!
Als der Sommer 1831 so ziemlich vergangen war, kam nun die Zeit, da die Konstitution abgeschlossen war und dem Volke verliehen werden sollte. Von den erhabenen Gefühlen, die vielleicht schon damals, sicher, als die Verfassung etliche Jahre bereits gewirkt hatte, die Dresdner beim Konstitutionsfest erfüllt hat, war bei Julius nicht viel die Rede. Als er die Schmückung des Rathauses sah: Beile und Spieße über den aufgerichteten Innungsfahnen, so sagte er sich mit seinen Freunden wohl: „Als wie: muckst ihr euch unten, so drücken wir euch [104] nieder! Der Bürger unter dem Konsul! – an sich gut ausgedacht, aber schlecht ausgeführt!“ Später interessierte das Schießen vor dem schöngeschmückten Schlosse, ehe oben drin die Verfassungsurkunde überreicht worden sei. Das Schießen der Infanterie ging gut; die Kommunalgarde hatte 2 Vorschüsse und 3 Nachschüsse – worüber herzlich gelacht wurde. Als sich das wiederholte, wurde der Kommandant Oberst Krug von Nidda wütend. Nun dringen die jungen Leute in das Schloß, sehen das „herrliche Marketendermädchen“; einer von der Gesellschaft berichtet von ihren Taten mit Marcolini.[29] Jetzt wollen sie auf den Schloßturm hinauf, aber die Posten verbieten es. Da kampieren sie, wie er sagt, im Hofe. Der Staatswagen für den Landtagsmarschall kommt mit 6 Pferden bespannt. Die Hengste der königl. Vorreiter entzücken sie. Da – die Konstitution ist vom König dem Landtagsmarschall Grafen von Bünau übergeben! – 101 Kanonenschüsse. Endlich kam der stolze Steuerrat Schmieder und trug das Kissen mit der Verfassungsurkunde. Nun stürzten sie hinaus nach dem Neumarkt und sahen zwischen der Haie, die Militär und Kommunalgarde bildeten, den Zug der Landtagsmitglieder nach dem Landhaus. Am Abend aber wurde ein Kahn gemietet, und die Familie fuhr auf der Elbe einher und sah von da aus das Feuerwerk an, das zur Feier des Tages auf der der Brühlschen Terrasse gegenüber gelegenen Elbwiese abgebrannt wurde. Wanderung durch die Stadt, Bewunderung oder Bekrittelung der öffentlichen Illumination beschlossen den Tag.
Am kommenden Sonntag wohnte er bei strömendem Regen der Abholung der Fahnen bei, die von den Innungen wieder von dem Säulenbau vor dem Rathaus abgebracht werden sollten. Trotz der Unbill der Witterung ging es gut vonstatten; auf dem Neumarkt wurde noch zum Schluß „Den König segne Gott“ gesungen; dann freilich passierte es dem Fahnenträger der Schneiderinnung, daß er die Fahne in den Straßenschmutz fallen ließ.
Da war denn all die lebhafte Bewegung, die gerade etwa ein Jahr lang die Sachsen und namentlich die Dresdner beunruhigt hatte, zum Abschluß gekommen.
[105] Ein merkwürdiges Jahr, reich an gesunden Anregungen, reich an mancherlei abenteuerlichen Plänen. Von jedem ein Beispiel. Ein Posamentierer Eccarius, der wegen mancher unreifer Ideen, die er zu Haus zu Papier gebracht hatte, eine Zeitlang verhaftet gewesen war, hatte u. a. folgende Pläne entworfen: Eine Staatsverfassung für Deutschland, Ungarn und Böhmen; einen Vorschlag, daß der 1828 geborene Prinz Albert evangelisch getauft werden sollte, und eine Schrift: Bürgerkunde nötig für die Jugend, weil man oft Fehler begehe, ehe man die betreffenden Gefahren kenne. Man muß dem einfachen Manne zubilligen, daß er mit dem zuletzt genannten Vorschlag seiner Zeit wenigstens in Sachsen um beinahe 80 Jahre vorausgeschritten ist. Ein anderes seltsames Beispiel: In der Nähe von Neustadt bei Hohnstein lernte der Kreuzschüler während seines glückseligen Ferienaufenthaltes einen Baron Zenker kennen, der zu Langburkersdorf auf seinem Gute große Brutöfen für Vogeleier unterhielt, worin schon 200 Enten- und Hühnereier ausgebrütet worden waren, damals wohl noch etwas Neues. Er beschäftigte sich in Mußestunden auch mit politischen Dingen und äußerte sich stark über die mangelhaften Gesetzbücher in Sachsen. Er schlug vor, er wolle in einem Jahre eins schreiben, das aber aller 5 Jahr, je nach den hervortretenden neuen Bedürfnissen, wieder umgestürzt werden solle. Da schreibt der junge Mulus verzweifelt in sein Buch: „Da möchte ein Teufel Jurist werden!“
Denn Jurist wollte er werden, nicht Theolog, wie er noch bis zwei Jahre vorher geplant gehabt hatte.
Jetzt galt es nun, nach der Stätte zu ziehen, wo er sich die Bildung fürs Berufsleben aneignen sollte. Die Abreise nach Leipzig stand bevor. Im Hause wurde dafür gerüstet, Besuche wurden gemacht bei Lehrern, bei befreundeten Familien, vor allem da, wo man mit den liebenswürdigen Haustöchtern in französischer Komödie, auf dem Ball, beim Gesellschaftsspiele, bei lustigen Spaziergängen und Ausflügen allerhand Kurzweil erlebt hatte.
Vertraute Stätten wurden noch einmal besucht, und bezeichnend ist es für den jungen Dresdner jener Zeit: Es wurde noch einmal Moreaus Denkmal begrüßt. Die Vaterstadt lag im [106] Maiensonnenglanze vor den Jünglingen, die der herrlichen Studentenzeit entgegengingen.
Vielleicht darf ich noch einiges von des jungen Mannes Reise nach Leipzig, von seinem ersten Dreivierteljahr, das er in Leipzig zubrachte (Mai bis Dezember 1832) als Abschluß hinzufügen.
Mittwoch den 23. Mai waren ihrer sechs Studenten von Dresden aufgebrochen. Da das Tagebuch in diesen stürmischen Tagen des Abschieds unregelmäßig geführt worden ist, erfahren wir nicht, wo sie abends gehalten haben, um zu nächtigen. Sicher hatten sie im Wirtshaus tüchtig gesungen, denn er und Blöde waren am Morgen noch heiser, als sie zum Wagen hinabgingen, um die Gitarre zu verpacken. Früh 4 Uhr bereits erschien der „Marqueur im Schlafpelze“ mit einem Licht, um zugleich die Zahlung in Empfang zu nehmen. Jeder hatte 12 Gr. zu zahlen, einschließlich des Bettes zu 5 Gr. Als sie nun zu sechs, gehörig gequetscht, im Wagen saßen, unter ihnen auch der Sohn des damals sehr angesehenen Kultusministers Müller, wurde wieder gesungen: Lützows wilde verwegene Jagd, Das Volk steht auf, Wir hatten gebauet usw. In Luppe wurde ein Schnaps getrunken; hinter Wurzen, durch das ohne Anhalten gefahren wurde, stiegen sie aus, um einen gehörige Tannenzapfenschlacht abzuhalten. Nun aber erschien die Gegend den jungen Dresdnern „unausstehlich langweilig“, und etliche schliefen ein. Noch einmal wurde in Borsdorf gerastet und in der Laube des Wirtshauses, dessen Gastzimmer übervoll war, Butterbrot und Schinken gegessen. Ein Sandkuchen, den sich jeder mitnahm, kam ihnen für 1 Gr. „sündlich“ teuer vor. „Eine Straße über Borsdorf hinaus sah man Leipzig liegen. Jetzt verstummten unsere Lieder; o, je mehr ich mich Leipzig näherte, desto banger ward mir es um das Herz, so daß mir vor dieser Stadt graute. Jedoch der Eindruck ward angenehmer, den die Vorstädte auf mich machten; dieses ging in eine Freude über Leipzig über. Wir kamen um 2 Uhr an; am Grimmaischen Thore mußten wir lange halten. Die Märkte und Gassen waren noch voll Buden.“
Der Wagen hielt vor dem Hotel de Pologne auf der Hainstraße, der Kutscher Weber bekam sein Trinkgeld; dann aber [107] eilte er selbst mit Freund Schnabel, mit dem er Stube und Kammer in einem Hause der Hainstraße nahe dem Brühl teilen wollte, geleitet von den Packern und dem Gepäck, nach der neuen Behausung, in der sie sich bei freundlichen Wirtsleuten bald sehr heimisch fühlten. Ein hübscher Grundriß mit Einzeichnung der in beiden Zimmern aufgestellten Möbelstücke wurde gleich in der ersten Zeit angefertigt und den Eltern geschickt, damit sie über die Unterbringung der Söhne beruhigt seien.
Am andern Tage war sogleich das nächste Geschäft, den Leipziger Torzettel auf dem Rathaus abzugeben und sich dafür den Dresdner zurückgeben zu lassen, der zugleich ein Gesundheitszettel, d. h. eine Bestätigung war, daß in Dresden keine ansteckende Krankheit herrsche.
Nun galt es, die Inscription zu erlangen und die richtigen Kollegien auszuwählen.
Sie begrüßten Montag den 28. Mai früh den Rektor Professor der Rechte Karl Klien im Juridico und hörten von ihm, daß er nachmittags 3 Uhr die Ehre haben werde, die Inscription vorzunehmen. Sie erschienen denn auch pünktlich, zählten im Auditorio ihr Geld auf, der Pedell nahm es ein, dann wurden sie zum Rektor hinausgerufen. Sie mußten nun ihren Namen ins Buch und auf das Zeugnis schreiben. Nachdem dann die Gesetze in gedrängter Form vorgelesen worden waren, hielt der Rektor eine sehr gute Rede. Er ermahnte die jungen Leute zum größtmöglichen Studium; sie sollten die akademische Freiheit nicht in allen möglichen Ungebundenheiten suchen, nicht das Schwert für ihr Szepter halten; nein! wer in den Wissenschaften die Feder gut führe, der könne auch das Schwert zur nötigen Zeit führen.
Von der Wahl der Kollegien sei hier nur erwähnt, daß außer den für das erste Semester üblichen juristischen Vorlesungen auch ein philosophisches, und zwar bei Drobisch, gewählt wurde, eines über griechische Geschichte. Hier zeigte sich wohl noch die Nachwirkung des so anregenden Geschichtslehrers Baumgarten-Crusius, den die Dresdner Kreuzschüler gehabt hatten. Im zweiten Semester beteiligten sich die Füchse bereits an einem Disputatorium, [108] einer Übung, die sicherlich noch fruchtbarer gewesen wäre, wenn sie deutsch und nicht lateinisch betrieben worden wäre. Julius Rachel disputierte am 11. Dezember über den Satz: exercitus perpetuos hodierno tempore solvendos esse, d. h. die stehenden Heere sind in jetziger Zeit aufzulösen. Ein Thema, das sicher von der Strömung jener Zeit beeinflußt ist, die für die Bürger in Waffen eingenommen war gegenüber dem berufsmäßigen Soldaten. Ob er sich dabei für das Volk in Waffen mit allgemeiner mehrjähriger Dienstpflicht, wie wir es nun selbst und andere Staaten in Europa, unserem Beispiele folgend, haben, erklärt hat oder, was wahrscheinlicher ist, für ein Milizheer ausgesprochen hat, stehet dahin.
Dies führt von selbst zu einem kurzen Blick auf die politischen Interessen, die dieser Leipziger Student im Jahre 1832 empfand.
Es sei zunächst noch einmal daran erinnert, daß das freie Lied die jungen Leute, ohne daß sie einem Verein, einer Landsmannschaft oder einem Korps beigetreten wären, lebhaft beschäftigte. Wenn die Freunde über Land gingen, oder wenn die zwei Stubenburschen abends zu Hause saßen, sangen sie, nachdem sie ihr Butterbrot genossen (und manchmal ein Stück Schweizerkäse, vom „Italiener“ geholt, dazu) solche Burschenlieder: Kosziusko, Wir hatten gebaut, und namentlich gern Körnersche Lieder! Ihre Kenntnisse in politischen Dingen suchten sie sich zu vermehren und zu klären dadurch, daß sie, angeregt von Blöde, der etwas Feuriges hatte, bei einem jungen Notar für 6 Gr. monatlich den „Freisinnigen“ abonnierten. Sie hatten schon in Dresden als Pennäler gern darin gelesen, fanden, daß das in Freiburg i. Br. auf Aktien erscheinende Blatt die interessanteste politische Zeitung sei, die auch schon mehrmals „belegt“ worden sei. Die liberal gesinnten Professoren Rotteck und Welker hatten großen Einfluß auf diese „Freiburger politischen Blätter“. Sie nahmen die Zeitung auf ihrem Dorfbummel mit und lasen im Gohliser Wirtsgarten darin. Dann begann wohl ein politisches Gespräch. Einer kam ganz offen darauf zu sprechen, wenn es so weitergehe, wie bisher, würde es zu einer Mediatisierung Deutschlands durch Rußland kommen; ein Krieg [109] gegen dieses Land sei daher nötig. Ein anderer erklärte wenig mutvoll: dies Wiederstreben nütze garnichts, indem Rußlands Übermacht alles erdrücke. In dem darauf ausbrechenden Wortgefecht behielt Schnabel, Rachels Stubenbursche, der diese Äußerung getan hatte und nun verfocht, „entschieden Unrecht“. Den Beschluß machte wieder, „da nicht viel Menschheit da war“, der Gesang Körnerscher Lieder.
Daß damals der deutsche Liberalismus auf Frankreich, das unter der Julidynastie eine mehr vermeintliche, als wirkliche parlamentarische Freiheit genoß, blickte, ist bekannt, und so wird denn ausdrücklich gebucht, daß, als in einem Gartenkonzert des Hotel de Prusse bei Illumination die Marseillaise gespielt wurde, lärmende Rufe Bravo, Bravo, da capo, da capo erschallten und die revolutionäre Weise noch einmal gespielt werden mußte. Einige Tage später zeigt ihm ein Freund einen Plan der französischen Deputiertenkammer. Er war ihm so interessant, daß er sich ihn alsbald abzeichnete.
Am Sonntag den 22. Juni 1832 wollten die jungen Leute früh nach Schleußig, nachmittags auf die Bürgerau gehen. Die Wasserfahrt nach Schleußig wurde jedoch durch das schlechte Wetter vereitelt. Bei Tische erzählte im Speisehause der Prof. Klotz, daß sich die Kommunalgarde um halb 5 Uhr stellen müsse, um auf die Bürgerau zu marschieren. Der Hofrat von Langenn war nämlich ergötzlich mystifiziert worden, daß die Burschenschaften von Leipzig, Jena und Halle sich vereinigt hätten, ein Hambacher Fest auf der Au zu feiern (was dann auch später im Freisinnigen 120 zugegeben wurde!). Deswegen waren für den Notfall in allen drei Kasernen die Soldaten unter Waffen; die Bürgergarde marschierte bis vor das Tor hinaus, kehrte dann wieder um. Alle Wege waren mit Spürnasen oder verkleideten Polizeidienern bedeckt. „Hätten sie sich, so schließt der Bericht, noch ein bischen ängstlicher gezeigt, hätten sie wohl ein Revolutiönchen zu Stande bringen können“.
Viel aufregender war ein in jener Zeit veröffentlichter Bundestagsbeschluß. Nach dem Hambacher Fest erschienen im Juli 1832 die Sechs Bundestagsartikel, die zwar nichts Neues, [110] sondern nur den bestehenden Gesetzen eine schärfere Auslegung brachten.[30]
Aber da sie ganz ausdrücklich Vereine, Versammlungen und Presse neuerdings bedrohten, da sie die Rechte der Landstände einengten, die Regierungen aufforderten, jeden Angriff der Landtage auf den Bund zu verhüten, und erklärten, daß die Auslegung der Grundgesetze des Bundes allein der Bundesversammlung zustehe, gaben sie Grund genug zur Erregung, zur Unzufriedenheit. Hören wir den Bericht des jungen Mannes hierüber: „Zu Mittag las ich die Beilage der Leipziger Zeitung, die die Bundestagsbeschlüsse enthielt, die mich natürlich mit nicht geringem Unwillen erfüllten und überhaupt große Sensation erregten; besonders waren es einige Artikel, die völligen Umsturz aller Constitutionen drohten. In dem Kolleg bei Wachsmuth waren alle von dem Gedanken und den Folgen erfüllt, die dieser Beschluß haben könnte. Einer nahm es von der spaßhaften Seite und behauptete, es könne nichts wohlthätiger auf die Constitutionen wirken, als gerade dieser Beschluß, und er hatte wirklich die richtigere Ansicht, während Blöde ihn für das Signal zum Aufruhr hielt. Devrient schrieb einen Zettel und wollte im Tageblatt die Bitte um die Veranstaltung einer Prachtausgabe des Bundesbeschlusses (unterschrieben unus pro omnibus) einrücken lassen; es erschien jedoch nichts in dem Tageblatt, sey es nun, daß die Bitte die Censur nicht passiert hatte oder, was wahrscheinlicher war, garnicht abgegeben worden war. Vor der Stunde war verabredet worden, daß wir mehrere in pleno auf die Expedition ziehen und uns die Beilage holen wollten. Dies geschah, und siehe da, wir waren nicht die Einzigen; eine zweite Auflage zeigte den starken Absatz an. Ich ging noch zu Blöde, der das Blatt Bary vorlas und dann nach mehrmaligem Anspeien an die Thüre nagelte“.
Diese kräftige Verurteilung des berüchtigten Beschlusses wird man richtig einschätzen, wenn man bei Treitschke liest[31], daß [111] zwar der Prinz-Mitregent bei der Veröffentlichung der Beschlüsse die Gerechtsame seiner Landstände ausdrücklich verwahrte, die Minister aber große Ängstlichkeit zeigten. Hatte doch die Sachsenzeitung schon den Bund mit Frankreich gegen die Großmächte empfohlen! Verbreitete doch im Vogtlande ein neugebildeter Preßverein radikale Schriften! Und mehr noch: in der Dresdner Adligen Ressource hatte Otto von Watzdorf einen Protest gegen die Sechs Artikel zur Unterzeichnung ausgelegt.
Mit dieser ehrlichen Erregung stand in starkem Widerspruch der vom Wirte des bekannten Hotel Stadt Berlin in Leipzig geäußerte Wunsch, daß der Bundestag, wie eine ziemlich verläßliche Nachricht melde, nach Leipzig verlegt werden solle. Dies werde der Stadt und den Bürgern bedeutend mehr einbringen. Diesem kahlen und wohl nicht ganz sichern Nützlichkeitsstandpunkte hielt der junge Rachel entgegen, daß dies auf die Universität Leipzig den übelsten Einfluß ausüben werde, teils auf die Professoren, teils auf die Studenten, denn die Wohlhabendsten unter diesen seien Fremde (darunter damals Nichtsachsen gemeint!); um dem bestimmt eintretenden Drucke ihrer Gesandten zu entgehen, würden diese größtenteils fortgehen. Diese Ansicht zeugt erstens von dem großen Mißtrauen, das die Jugend jener Zeit der obersten diplomatischen Vertretung des „deutschen Vaterlandes“ entgegenbrachte, zweitens aber von dem scharfen Blick des jungen Mannes. –
Eifrig nehmen die jungen Leute, die auf ihrer Dresdner Kreuzschule wahrhaftig nicht zur körperlichen Betätigung angehalten worden waren, muskel- und augenstärkende Übungen vor. Tüchtig fochten sie auf verschiedenen Buden in höchster Begeisterung, und mancher „Rappierjunge“ wurde ausgemacht. Außerdem schlossen sie sich einer Exerzierschule an, die sich in Gohlis aufgetan hatte. Ein ehemaliger Unteroffizier, namens Fritzsche, unterhielt diese Schule; sie war so besucht, daß er drei Kompanien bilden konnte. Der junge Rachel gehörte der dritten an. Zu seinem Leidwesen übte in ihr auch ein Student, Tr. mit Namen, der als der „liederlichste unter den Burschen“ galt; doch wurde er sehr bald „consiliert“, verschwand also wohl aus der Exerzierschule und von der Universität.
[112] Bei diesen Übungen trat Rachel auch einem jungen Griechen näher, Manuel Rizos, mit dem er sich bald auf „Du und Du“ befreundete. Daß er einem Volke entstammte, das eben erst nach begeisternden Freiheitskämpfen seine politische Selbständigkeit errungen hatte, machte ihn dem deutschen Studenten gewiß interessant genug. Durch ihn trat auch in den Kreis ein Perser, namens Sacher, von dem aber nichts Näheres berichtet wird.
Das gesellige Leben, das der junge Fuchs in Leipzig führte, war sehr bescheiden. Hie und da wurde er, was stets mit Freuden notiert wurde, in gute Familien geladen, so zu Dr. Friderici, einem nachmals hochangesehenen Leipziger Juristen. Dort lernte er mit seinem Kreuzschulfreund Osterloh, dem späteren rühmlichst bekannten Zivilprozeßprofessor, interessante Menschen kennen und eignete sich unter Anleitung der feingebildeten Hausfrau die Sitten und Gebräuche der höheren Leipziger Gesellschaft an. Der Braten schmeckte, wie auch der Wein; daß dazu sehr gut mundendes Selterserwasser getrunken wurde, wird als Besonderheit eingetragen. In einfachen Bürgerkreisen, in die er geriet, wurde der Gesang gepflegt. Beliebte Lieder und Duette aus der „Schweizerfamilie“ und dem „Opferfest“ wurden immer und immer wieder gesungen. Er nennt am häufigsten die Liederanfänge: „Wenn mir dein Auge strahlet“, „Rose, wie bist du“ und das himmlische: „Du gibst mir also nicht dein Herz?“ Dies letztgenannte stammte vom so sehr beliebten Komponisten des Tiedge-Liedes: An Alexis send ich dich, von F. H. Himmel, und hatte den Titel Herzenswechsel.
Mit Freunden oder befreundeten Familien wurde auch gern spaziert. Der durch die Schönheit Dresdens und dessen Umgebung verwöhnte junge Dresdner fand zwar den Kuchengarten sehr hübsch, das Rosental oder vielmehr „Knoblauchstal“ wollte dem eifrigen Besucher des Großen Gartens nicht gefallen. Größere Studentenbummel führten ihn im Juli seines ersten Semesters nach Grimma, im August nach Altenburg, doch fehlen hier die näheren Angaben. Hauptspaß gaben die Wanderungen am Ende des Semesters nach Dresden.
Am 13. September 1832 – so spät erfolgte damals der Schluß des allerdings erst im Mai begonnenen Sommersemesters – [113] machte er sich auf nach Dresden. Sechs Mann hoch gingen sie schon nach 5 Uhr früh nach Liebertwolkwitz, tranken dort ihren Kaffee und trafen elf andere Studenten, die aber nach Colditz strebten. Sie selbst gingen nach Grimma, von da nach Leisnig. Der Anblick der alten Muldenstadt mit ihrem überragenden Schloßberg entzückte sie alle. Gern wären sie im Ratskeller untergekommen, er war aber durch „eine Schauspielerbande“ belegt. Sie mußten daher in einen Gasthof gehen, der ihnen aber nicht die genügende Anzahl Betten stellen konnte. So gaben sie sich mit einfachem Strohlager zufrieden. Da zu viele „Knoten“ im Wirtszimmer saßen, fehlte ihnen der rechte Geist, zu kommersieren und zu singen. Nach einer tüchtigen Zankerei über diese wichtige Frage zogen sie sich auf ihr Strohlager zurück. Am zweiten Tage ging es über Döbeln und das Kloster Zelle, in dem sie sich gern herumführen ließen, bis nach Limbach, das ihnen das zweite Nachtquartier bot. Am dritten Tage jauchzten sie früh beim Antritt der Wanderung Dresden entgegen. Von der Gorbitzer Höhe sahen sie es begeistert liegen, eilten zum Freiberger Schlag, wo die „gute Police“ sie erst nicht hereinlassen wollte. Wie wunderten sie sich über „die enorme Stille“, die im Gegensatz zu Leipzig in Dresden herrschte! In den folgenden Jahren ist er auch Ende März zu Fuße nach Dresden gereist, kam dabei auch einmal „recht marode“ an.
Es ist hier nicht mehr der Platz, von der Weiterentwickelung des jungen Mannes zu reden. Würde es ja auch unmöglich sein, sein tägliches Leben weiterhin zu verfolgen und zu besprechen. Wohl hat er vor und nach 1840 Ansätze zu Tagebüchern gemacht, auch viele Jahre später 1864 neuerdings; aber sie sind kurz und abgebrochen und verbreiten sich mehr über innerste Erlebnisse als über sein Leben in Haus, Familie, Stadt oder Staat. Daraus zu berichten, gehört nicht hierher. Er hat die freie Zeit, die er seit 1835 als Rechtskandidat genießen durfte, mehr zu eindringlichem Lesen und, was uns jetzt seltsam vorkommen würde bei einem jungen Juristen, zu oft recht umfänglichen Auszügen daraus verwendet. Seit 1833 hat er solche angefertigt; in den Jahren 1834 und 1835 erreichte diese zeitraubende Beschäftigung ihren Höhepunkt. Als er Advokat [114] geworden (1841), hörten auch diese Niederschriften auf. Der Geschäftsmann überwog, das literarische Genießen und Verarbeiten verschwand.
Vielleicht ist es aber für eine spätere Zeit nicht ohne Interesse, die Zeitungen, Zeitschriften und Bücher zu nennen, die ihn zu oft recht umfangreichen Auszügen veranlaßten. Es sind dies das Stuttgarter Morgenblatt, die Staatsbürgerzeitung, die Sachsenzeitung, das Journal La France, Statistische Lehrbücher. Von dichterischen Werken stehen voran Jean Pauls Werke, Goethes Wahrheit und Dichtung, Tiecks Novellen, allerhand Lieder aus des Knaben Wunderhorn, von Rückert, lateinische Kirchenpoesie. Ferner Immermanns Münchhausen, Friederike Bremers Nachbarn, Kortüms Jobsiade. Biographische Werke, wie Rahel Varnhagens Umgang und Briefwechsel, Justinus Kerner von Strauß, Eduard Gans, Rückblicke auf Personen und Zustände. Das junge Deutschland kündigt sich stark an: Heinesche Schriften, Laubes Reisenovellen, Börnes Briefe, Semilasso in Europa, die Hallischen Jahrbücher; auch Schriften der Gräfin Ida Hahn-Hahn. Entsprechend der starken Beschäftigung der Deutschen damals (und wohl noch lange nachher) mit England und Frankreich erscheinen viele Schriften über diese Länder oder aus ihnen: Die St. Simonisten, Paris im Jahre 1835, Theodor Mundts Bücher. Eine besondere Vorliebe hat er auch für Denksprüche, Sinnsprüche aller Zeiten, daher denn aus allen möglichen Schriften eine Fülle oft recht schlagender Worte zusammengetragen ist, sogar auch Grabschriften. Und so gefiel ihm auch Webers Demokrit, der jetzt wohl so ziemlich vergessen ist, diese Sammlung von Zitaten und Aussprüchen aller möglichen Leute aller Zeiten.
Auffällig zurück treten Romane. Um so merkwürdiger ist es, daß er dem historisch aufgeputzten Roman der damals so beliebten Schriftstellerin Gertrud Paalzow „Godwin Castle“ auf 14 Großquartseiten Zitate entnommen hat. Dieses Werk, 1836 erschienen und noch bis 1856 neu aufgelegt, lockte durch den Nebentitel „Aus den Papieren der Familie Nottingham“ und durch eine Art Wetteifer mit Walter Scott. Freilich treten bei ihr die antiquarisch-historischen Momente zurück und die rein [115] menschlichen überwiegen, die aber nicht ohne allerhand Effektstückchen erzählt werden.
Die Sorglichkeit, mit der diese Auszüge in Hefte eingetragen und diese wiederum zu einem stattlichen Pappband von 300 Seiten zusammengefaßt sind, beweist, welchen Wert er auf dieses Bildungsmittel gelegt hat. An dem regeren literarischen Leben, das Ende der dreißiger Jahre in Dresden durch Arnold Ruge und Theodor Echtermeyer, die Herausgeber der Hallischen Jahrbücher, zu bemerken ist, hat er teilgenommen; verkehrten diese beiden doch mit seinem Freunde Gustav Blöde und dessen Familie. Ein Leseverein führte ihn auch mit anderen gleichstrebenden jungen Männern zusammen, in dem Pflege neuer Literatur, eigene literarische Betätigung und einfache Familiengeselligkeit die Losung war.
Seinen Bürgerpflichten hat er durch Dienst in der Kommunalgarde genügt. Unsere Mutter oder das Dienstmädchen mit den Knaben ging wohl hinaus nach der „alten“ Vogelwiese, der Baufläche, auf der jetzt Kunstgewerbemuseum und städtische Gewerbeschule stehen, um dem Vater, der als Hauptmann seine Kompanie exerzierte, zuzusehen. Seine Uniform und sein Säbel haben noch lange Jahre, in einem alten Schranke hängend, ihren Eindruck auf die Kinder des Hauses nicht verfehlt. In der Zeit vor 1848 und im Jahre 1849 stand er auf der Seite der Maßvollen. Notwendigerweise mußte sich die Freundschaft zwischen ihm und Gustav Blöde, der in seiner raschen, leidenschaftlicheren Art an der Maibewegung einigen Anteil hatte, lösen. Blöde, der in jenen bewegten Tagen in der Stadtverordnetenversammlung vielfach der Wortführer der demokratischen Partei war, ist dann, wie schon erwähnt wurde, geflohen und hat bis an sein Lebensende in Amerika als Mitarbeiter an einer großen Zeitung gelebt.
Der Tagebuchschreiber, von dem nun Abschied zu nehmen ist, hat bis 1859 als Advokat gewirkt, war auch Mitte der fünfziger Jahre Stadtverordneter.[32] Später ging er in das Versicherungsfach über, in dem er sowohl in Dresden wie in Wien, wo er am 13. Mai 1880 gestorben ist, schriftstellerisch tätig gewesen [116] ist. Seine Schriften beschäftigen sich mit dem Realkredit in Sachsen, später mit der Einrichtung von besonderen Versicherungskassen und Sparkassen. Ihm schwebte die größtmögliche Ausdehnung von Versicherungen der Mitglieder aller Berufe als erstrebenswertes Ziel vor: Wünsche und Bestrebungen, die von 1887 an nicht so sehr durch die freie Entschließung der Beteiligten, als durch die vorbildliche Versicherungsgesetzgebung des Deutschen Reiches ihrer Erfüllung entgegengehen sollten.
[117]
GustavHeinrich Rachel.
Auch der zweite Sohn des Buchhalters und späteren Stadtkämmerers Heinrich Wilhelm Rachel hat, vom Vater und vom älteren Bruder beeinflußt, etliche Jahre Tagebuch geführt. Es war dies Gustav Heinrich Rachel, geb. am 8. Dezember 1815. Wie sein Bruder ist er, von der Liebe des trefflichen Vaters und der Mutter, die ganz besonders an diesem zweiten Sohn hing, umgeben, im trauten Hause gemütlich aufgewachsen. Eltern, Großmutter, Tanten und Onkel hat er innig verehrt und widmet dem Verkehr und den Erlebnissen mit ihnen gar manches Blatt seiner sorglich gebundenen Tagebücher. Manches davon ist schon in den zweiten und dritten Abschnitt des Buches eingeflochten, so daß hier hauptsächlich von der eigenartigen Entwickelung des Knaben und Jünglings, von seiner Ausbildung zum Techniker und den Erlebnissen, die ihm in dem damals so neuen Berufe beschieden sein sollten, die Rede sein wird.
Sein Bildungsgang war ähnlich gedacht gewesen, wie der des älteren Bruders. Nachdem er die Privatschule des Schulrat Günther besucht hatte, wurde er zur Kreuzschule gemeldet. Aber schon mit 14 1/4 Jahren 1830 wurde er aus Oberquarta weggenommen und sollte sich einem praktischen Berufe widmen. Er eignete sich durchaus nicht zu den Stoffen der Gelehrtenschule; er war eine sehr praktisch angelegte Natur; war ihm doch [118] nach den Schulstunden Graben, Jäten und Pflanzen im Garten am Hause oder beim Freunde eine ganz besonders liebe Beschäftigung, lieber sicher als Lateinisch lernen. Dazu kam, daß er etwas Keckes, Entschlossenes in seinem Wesen hatte und sich wohl manchmal durch allerhand harmlose „Streiche“ das Wohlwollen der Lehrer verscherzte. Er wurde nach kurzer Zeit der Überlegung der technischen Bildungsanstalt anvertraut. An die Stelle der fremden Sprachen, der Disputationen über Stoffe aus der alten Welt, sowie der Dichtungen in der Muttersprache treten andere Stoffe, die sich wohl kurz zusammenfassen lassen in die Worte: Zeichnen und Mathematik! Verlust auf der einen Seite, Gewinn auf der anderen. Der Gewinn bestand hauptsächlich darin, daß er zeitiger als der Gymnasiast einen Blick in Welt und Menschen tat, näheren Anschluß an seine Lehrer fand, die seine persönlichen Führer wurden, eine frühe Selbständigkeit erlangte, ein kräftiges Selbstbewußtsein empfand. In jungen Jahren kam er dann hinaus ins Leben, mußte dies in unruhigem Wechsel verbringen: in der kleinen Stadt oder auf dem Dorfe. Immer aber kehrte er gern in die größere Stadt, vor allem in das liebe Vaterhaus, zu den Freunden und Freundinnen der goldenen Jugendzeit zurück.
Es war damals für die Söhne Dresdner Bürger noch nicht allzulange her, daß sie eine Vorschule für höhere praktische Berufe in ihren Mauern hatten. 1814, also noch ehe für den kleineren Teil Sachsens die alten Verhältnisse zurückkehrten, wurde an die schon seit fast 50 Jahren bestehende Akademie der bildenden Künste eine sogenannte Industrieschule angefügt. Sie sollte im Zeichnen für mechanische Gewerbe ausbilden, für Fabrik und Handwerk. Ihr wurde 1818 eine Bauschule angehängt, die im Winter von jungen Baubeflissenen unentgeltlich besucht werden konnte. Eine Erweiterung und eine Vertiefung für den Bildungsgang solcher jungen Leute brachte 1823 die Erlaubnis des Königs, die Vorträge der an der chirurgisch-medizinischen Akademie im Kurländer Palais angestellten Professoren in Chemie, Physik, Mathematik und Naturwissenschaften zu hören. Die Regierung war dabei sehr entgegenkommend: Prüfung wurde nicht verlangt, etliche Vorkenntnisse wurden aber vorausgesetzt. [119] „Künftige Fabrikanten und andere Personen, denen es in Zukunft nützen konnte, wurden hauptsächlich erwartet“. Außer den dem einfacheren Verständnisse angepaßten Vorlesungen konnten auch ausführlicher gehaltene besucht werden; Zeugnisse nach bewiesenem Fleiß und abgelegter Prüfung konnten hier erteilt werden.
Fünf Jahre später geschah ein bedeutender Schritt nach vorwärts. Die Königlich Sächsische Landes-Ökonomie-Manufaktur- und Commercien-Deputation (später im Königlichen Ministerium des Innern aufgegangen), die schon im 18. Jahrhundert für Gewerbe und Handel Sachsens Ausgezeichnetes geleistet hatte, eröffnete am 1. Mai 1828 die technische Bildungsanstalt. Sie war ausdrücklich bestimmt für Handwerker und Fabrikanten; zugleich aber auch für Künstler zur Erhöhung ihrer Geschicklichkeit, zur Vervollkommnung des Betriebes und ihrer Gewerbe. Der Lehrgang brachte Praktisches und Theoretisches. Zunächst wurden in der Maschinenbauanstalt Rudolf Blochmanns, des um die technischen Verhältnisse Dresdens sehr verdienten Mannes, Übungen angesetzt. Hierauf folgte theoretischer Unterricht. Zum Schluß wurde noch eine praktisch-theoretische Anleitung für Weiterstrebende gegeben. Während in der 1. und 2. Abteilung nur Inländer zu unterrichten waren, sollten in der 3. auch „Ausländer“ zugelassen sein. Wie seltsam kommt es uns vor, daß die Vorbedingungen sehr bescheiden gestellt waren. Der Anzumeldende sollte nicht unter 14 Jahre, nicht über 18 Jahre alt und konfirmiert sein. Verlangt war nur Fertigkeit in Lesen, Schreiben und in den gemeinen 4 Rechnungsarten. Für das unglaublich niedrige Schulgeld von 1 Tlr. 12 Gr. und 8 Pfg. monatlich hatte der Besucher auch noch freie Benutzung der Sammlungen, der Zeichnungen, der Bibliothek und der Modellkammer.
Nach den einfachen und bescheidenen Anfängen der ersten Jahre hob sich die Anstalt unter der Leitung des sehr tüchtigen Oberinspektors Lohrmann.[33] Schon waren in Mathematik Differenzial- und Integralrechnung angesetzt, desgleichen praktische [120] Chemie, Technologie, Statik, Hydrostatik; außer Situations- und Kartenzeichnen auch noch praktische Vermessung. Da die Lehrkräfte auch vielfach anderweit beschäftigt waren, mußte der Stundenplan sich über den ganzen Tag erstrecken; in der ersten Zeit lag der Unterricht zwischen 7 Uhr früh und 7 Uhr abends; sogar zwischen 1–2 Uhr gab es Unterricht, und zwar in deutscher Literatur.
Die Modellmaschinensammlung war im Anfange noch sehr dürftig; es kam wohl auch vor, daß etliche der Modelle vom „Hohen Ministerium“ des Innern an Fabrikanten des Inlandes auf Zeit abgegeben wurden, damit sie diese Maschinen kennen lernten und deren Vervielfältigung veranlaßten, z. B. an die bekannte Tuchfabrik von Herrmann & Söhne in Bischofswerda. In dem Kabinett gab es damals, als der junge Gustav Rachel eintrat, 76 Modelle, teils aus Eisen, teils aus Holz; darunter 10 Handschrotmühlen, Feuerspritzen, Feuerleitern, Blitzableiter, Spinnräder, Thermometer, von Holzsparöfen (besonders charakteristisch für die Zeit des Übergangs von der Holz- zur Kohlenfeuerung) 20 Arten. Damit auch Besucher aus der Provinz Vorteile von dieser Aufspeicherung von „Mustermaschinen“ hatten, wurde die Sammlung, die sonst nur Freitags von 2–5 Uhr geöffnet war, auch an Jahrmarktstagen Gewerbetreibenden zugänglich gemacht.
Daß die so ausgestattete und so geordnete Schule dem Bedürfnisse entsprach, geht daraus hervor, daß sie 1831 schon 276 Besucher zählte; 5 % waren Ausländer (darunter auch die nichtsächsischen Deutschen gerechnet); 30 % waren aus Sachsen (mit Ausnahme von Dresden), 65 % waren Dresdner.
Untergebracht war die Schule zuerst in dem auf der Terrasse stehenden Brühlschen Lusthaus, das später Rietschels Lehratelier war; deshalb erhebt sich an der Stelle, wo es einst stand, jetzt das Rietscheldenkmal. Es war damals ein gefälliger Rundbau mit zwei Sälen, zur Rechten, zur Linken. Einige Unterrichtsräume waren auch zeitweise im alten Kuffenhause auf der kleinen Schießgasse, wo jetzt das Polizeigebäude steht. Später, 1833, wurde noch die ehemalige Rüstkammer, links vom schönen Tor am Jüdenhof gelegen, zu Vortragsräumen eingerichtet. Da
[Bild][-] [121] Familie Rachel, wie früher erwähnt, auf der kleinen Schießgasse wohnte, hatte der junge Mann die Stätten seiner Ausbildung sehr nahe.
Unter den damaligen Lehrern der Anstalt ragte neben dem Leiter, Oberinspektor Lohrmann, namentlich Johann Andreas Schubert hervor. An diesem Manne besaß die Schule aber wirklich auch eine ausgezeichnete, höchst vielseitige Lehrkraft. Zeitweilig hat er in allen wichtigen Fächern der Ingenieurwissenschaften unterrichtet, z. B. in Mathematik, Mechanik, Maschinenlehre, Geodäsie, Astronomie, Brückenbaukunde. Wohl war damals zur Behandlung solcher Aufgaben weniger zu wissen und zu lehren nötig als jetzt; immerhin zwingt die Aufzählung zum Staunen. Nebenher wirkte er in weniger wichtigen Fächern, z. B. in Buchhaltung. Dieser Mann hat für Dresden auch deshalb noch eine ganz besondere Bedeutung, weil er mit großer Zähigkeit den Gedanken geäußert und den Plan betrieben hat, die Dampfschiffahrt auf der sächsischen Elbstrecke einzuführen. Alle Versuche, Konzession hierzu zu erhalten, die seit 1815 von verschiedenen Personen gemacht worden waren, z. B. von Fried. Wilhelm Schaff, dem Engländer Humphrey und von Knab, waren fehlgeschlagen; selbst das Ziehen von Jachten, die mit Rudern und Segeln versehen waren, durch Dampfer wurde nicht konzessioniert. Im Jahre 1833 aber gelang es Schubert doch, im Verein mit dem Zuckersiedereibesitzer Calberla ein hölzernes Schiff zu bauen, das ein Schaufelrad am hinteren Ende besaß und als Schlepper von Rohstoff für die Zuckerfabrik diente.
Es ist begreiflich, daß dieser tätige und weitschauende Mann der lernenden Jugend lieb, ja interessant war; um so mehr, als er Herz und Verständnis für sie zeigte. Als sich Schubert verlobte, wußte sich der junge Rachel in den Besitz einer lithographierten Verlobungskarte zu setzen. Sie war ihm wert und wichtig genug, um sie in sein Tagebuch einzukleben. Als Schubert seine junge Frau von Mittweida nach Dresden geführt hatte, brachten ihm seine Schüler eine Huldigung dar. Mit Fackeln und Musik zogen sie des Abends vor sein Haus. „Die Fensterladen gingen auf, die Stube war herrlich dekoriert, im Hintergrunde standen zwei weißgekleidete Mädchen. In der Mitte aber [122] zwischen Blumen hielten sich Braut und Bräutigam umfangen. Dann trat Schubert vor an das Fenster, die Thränen rannen ihm über die Wangen. Darauf begaben sich beide zurück ins Zimmer, setzten sich auf den Divan. Die Musik spielte den Galopp aus dem Tell – Pauken und Trompeten erschollen; zuletzt zerstoben Schüler und Volk in die Gassen.“
Wie interessierte es den jungen Menschen, als ihm bald darauf sein Vater die fast abenteuerliche Jugendgeschichte Schuberts erzählte. Er war der Sohn eines armen Bergmanns im Erzgebirge gewesen und hatte im Winter Rußbutten gemacht. Im Sommer fuhr er sie mit seinem Bruder auf dem Schiebbock über Land. Einst zogen sie auch auf der Straße nach Leipzig zu. Plötzlich kommt ein Wagen, worin der „seelige“ Präsident Rackel mit seiner Frau saß. Schubert, der gerade den Schiebbock gezogen hatte, war recht müde, überließ ihn seinem älteren Bruder und setzte sich hinten auf den Wagen. Als der Wagen vor einem Gasthofe in Leipzig hält, springt er hinten wieder herunter und will fort. Rackel, der ihn aber von innen heraus bemerkt hatte, fragte ihn, ob er nicht mit hereinkommen wolle. Schubert folgte der Einladung und wurde nach längerer Unterhaltung von Rackel aufgefordert, am andern Tag in das neue Quartier zu kommen.
Als er sich zur bestimmten Zeit einstellt, fragt ihn Rackel, ob er bei ihm bleiben wolle; jener nimmt es mit freundlicher Miene an. Rackel macht ihn nun zu seinem Haussekretär und läßt ihm zugleich Unterricht im Rechnen, Schreiben, Lateinisch, Französisch usw. geben. Gleich im Anfange hatte er schon große Liebe zur Mathematik gezeigt. Als er nun Stunden in Algebra und Geometrie erhielt, so bekam er immer mehr Lust und arbeitete mit rastloser Tätigkeit und unermüdetem Fleiße fort. Präsident Rackel zog dann nach Dresden, und Schubert blieb auch hier bei ihm. Als er nun so weit war, daß er sich von Stundengeben erhalten konnte, zog er allein für sich. Nach und nach bekam er viele Stunden und zuletzt auch eine Anstellung an der technischen Anstalt. Allmählich erhielt er neue Lehraufträge und war bald zu Ansehen und guter Lebenslage gekommen. Gute Anlagen, ausgezeichnetes Streben und die Menschenfreundlichkeit eines klugen Kopfes haben hier eine überraschend glückliche Laufbahn ermöglicht.
[123] Schubert war auch die Seele der sonntäglichen wissenschaftlichen Ausflüge der jungen Besucher der technischen Lehranstalt. Als Beispiel sei hier nach dem Tagebuch berichtet, wie einfach, fröhlich, aber lehrreich ein solcher damals verlief.
Sonntag den 8. Mai 1831, an einem Tage, den der einstige Gymnasiast als dies admirabilis bezeichnet, stand er früh 1/2 4 Uhr auf und holte Punkt 5 Uhr einen Freund ab. 1/2 6 Uhr begaben sie sich nach dem Feldschlößchen, wo sich alle um ihren Lehrer Schubert versammelten. Zuerst gingen sie in die gegenüberstehende Mühle, die sogenannte Kunadmühle, die Müllermeister Flechsig gepachtet hatte. Sie bestand aus einer Mahlmühle und einer Ölstampfe. In der Mahlmühle befand sich auch eine Handschrotmühle. Wie gepudert aussehend, begaben sie sich weiter links in eine Lederwalke, wo es denn nicht zum besten roch, und in eine Gewürzstampfe, wo ihnen der Besitzer eine von ihm selbst gemachte Erfindung zeigte. Durch sie wurde ermöglicht, im Kessel durch ein Sieb gröberes und feineres Gewürzmehl voneinander zu trennen. Ein Stock, der mit der Welle in Verbindung steht, stößt in die Zähne des Kessels und dreht sie schnell herum, prallt aber durch eine besondere Vorrichtung zur rechten Zeit zurück. In zwei anderen Mahlmühlen, die sie am selben Vormittag besuchten, war einer der Müller besonders „menschenfreundlich“ und teilte viel aus seiner reichen Erfahrung mit. Staunend hörten sie, daß er binnen 24 Stunden 35 Zentner Gewürz feinstoße. Von den Mühlen ging es in das Kanonenbohrwerk, wo eigentlich niemand zugelassen war. „Wir aber sagten: ,Wir sind polytechnische Schüler‘, und damit waren wir aufgenommen.“ Den einfachen Vorgang schildert er also: Die Stücke, die ungebohrt dahin kommen, werden mittelst einer Hebemaschine an ihren Ort gebracht, von da in die Höhe gezogen bis ins zweite Stock ungefähr. Dann wird der eiserne Bohrer ganz gerade untergestellt und in ein Zahnrad befestigt. Dieses Zahnrad wird durch ein anderes in Bewegung gesetzt und dreht den Bohrer. Die Kanone aber senkt sich durch eigene Schwere ganz langsam zwischen vier starken Kloben herab und erleichtert so das Bohren. In dem dritten Stock fanden sie ein Modell von einer Mahlmühle und eines von einer Ölstampfe, [124] beide sehr richtig gebaut. Nach vollendeter Besichtigung waren sie recht müde und durstig geworden und begaben sich nach der Königsmühle. Hier aßen sie Buttersemmel und tranken Milch, eine Kost, zu der unter der Einwirkung der segensreichen antialkoholischen Bewegung und der Sportfreudigkeit die Jugend jetzt nach 80 Jahren vielfach zurückkehrt. Hierauf wurden allerlei Belustigungen getrieben. Während etliche über den Mühlgraben zu springen suchten, ging er zur Weißeritz hinab, trat in eine Fähre und pflückte sich zum Andenken an den Tag von einem fast im Wasser stehenden Holunderbaum etliche Blüten, die er seinem Tagebuch, auf einen besonderen Zettel geklebt, einverleibte. Um zehn Uhr gingen dann alle über die Berge nach Dresden zurück.
Donnerstag der 4. Juni brachte in das tägliche Einerlei der Stunden und des Zeichnens eine erwünschte Unterbrechung. Es wurde die Modellkammer besucht, die sich auf dem Zwinger befand; es ist jetzt der mathematisch-physikalische Salon. Schon das Innere des Raumes entzückte ihn: Fußboden, Pfeiler und Bögen aus sächsischem Marmor. Er sah zwei in Holz geschnitzte Grundrisse von der alten Festung Dresden, desgl. einen von der Stadt Düsseldorf. Schubert erklärte den jungen Leuten nun die vorhandenen Spinn- und Webmaschinen, sowie die Modelle von Brücken, Mühlen, Dampfmaschinen, Schiffen usw. Von irgend etwas aus dem Eisenbahnwesen ist nicht die Rede. Eine schöne Holzsammlung und Modelle von Vielecken ergänzten die gewonnenen Eindrücke. Neue Anregungen brachte der 17. Juni, mit der ersten Mechanikstunde, sowie der 18. mit einem Besuche des Silberhammers unter Schuberts Führung.
Sehr sonderbar mutet es uns an zu hören, daß die jungen Leute am 24. Juni in keine Lehrstunde gingen, da sie den „eingegangenen“ Feiertag, den Johannistag, halten wollten. Bald darauf begann das Feldmessen, das hauptsächlich nach Hopfgartens zu betrieben wurde.
Nachdem so der Sommer 1831 im fleißigen Besuch der Stunden und mit eifrigem Zeichnen verbracht worden war, winkte ein Examen bei Kammerrat Oberlandfeldmesser von Schlieben, dem Vorstand der Plankammer, dem der junge Mann übergeben [125] werden sollte. Schlieben, der die Arbeiten Rachels während der verflossenen Monate schon mehrere Male angesehen hatte, machte es am 7. August bei der Prüfung gnädig. Die Beschäftigung des Feldmessens, das an den Sonntagvormittagen mit verschiedenen Freunden betrieben ward, gefiel ihm schon so, daß er daran ging, den väterlichen Garten abzumessen; so arbeitete er in freien Stunden gar oft an der „Mensel“.
Der Bildungsgang, den der junge Mann im Jahre 1831 auf der technischen Anstalt, der Bauschule und in mancherlei Privatstunden genossen, macht im Ganzen einen etwas zerrissenen Eindruck; es ist dies nicht der geordnete Schulgang aus alter Zeit. Er läuft oft nur auf eine Stunde in die eine Anstalt, dann zeichnet er schnell ein paar Stunden zu Hause, hierauf eilt er zur anderen Anstalt. Nachmittags geht es zur Mathematikprivatstunde; früh, oft schon von 7–8, zur französischen Stunde. Wie die Schüler gelegentlich garnicht zur Stunde gehen, so finden sie andrerseits wohl auch den Unterrichtsraum, in dem Mechanik gelehrt wird, verschlossen und drehen sehr vergnügt um. Einmal ist eine feierliche Leichenparade eines Advokaten, der einen höheren Rang in der Kommunalgarde eingenommen hatte. Die Jugend stellt sich am Zeughof auf, bewundert das schön bestickte Leichentuch und zählt wohl an die 30 begleitende Advokaten. Aus der Schar der Leidtragenden ruft ihm der Lehrer, bei dem er Unterricht gehabt hätte, zu, er solle doch schnell auf der technischen Lehranstalt die Stunde abbestellen. Er tut es und eilt dann zum interessanten Begräbniszuge zurück.
Wie die Beschäftigung und der Gang der Vorbildung etwas zerfahren, so auch die Pläne; es war eben in jener Zeit nicht allzu leicht für den, der den technischen Beruf ergreifen wollte, einen festen und klaren Entwicklungsgang zu gewinnen.
Es überkam ihn damals oft der heiße Wunsch, doch noch, wie er dies früher gehofft hatte, Offizier zu werden. Da borgte er sich kriegswissenschaftliche Sachen, zeichnete Schanzen und sah sich schon im Geiste in Uniform einherstolzieren. Und doch beschlich ihn die Furcht wieder, daß ihn das nicht allzu kräftige Auge verhindern werde, Offizier zu werden. Ein andermal wurde [126] ihm von der guten Laufbahn eines Wasserbaubeamten vorgeredet, und etliche Tage beschäftigte er sich eifrig mit diesem Gedanken, lief zum Onkel, der im Finanzministerium als Jurist arbeitete, bat den Vater, sich bei den Amtsvorständen zu erkundigen. Der Gedanke wurde dann aber fallen gelassen. Im Jahre 1832 klang zum ersten Male das Wort „Ingenieur“ an sein Ohr; ein älterer Mann, dem er sich in seinem Drängen und Streben wohl offenbart haben mochte, sagte zu ihm, er sehe ihn schon im Geiste in der Ingenieursuniform. Der Tagebuchnotiz fügte der junge Mann hinzu: „Ich dachte: oh, wollte Gott, es wäre so!“
Montag den 2. Januar 1832 hatte ihn sein Vater auf die Plankammer im Finanzministerium geführt. Er besuchte von nun an die Bauschule nicht mehr, sondern beschäftigte sich eifrig mit Zeichnen und Mathematik, in der er bei seinem geliebten Lehrer Schubert wöchentlich drei Privatstunden nahm. Kammerrat von Schlieben, der der Plankammer vorstand, schickte ihn und seinen Kameraden Preßler häufig auf Feldmessen, teils im Umkreise von Dresden, teils auf benachbarte Fluren, so im Januar 1832 nach Marsdorf und Schönfeld zu. Am 26. Januar zogen beide mit 2 Burschen, 54 Pfählen und 2 Signalstangen vor den Löbtauer Schlag, um Bauplätze abzustecken, westlich von der Schäferei, rechts und links der Straße.
Bei weitem fesselnder, als solche kleinere Fahrten, war für den noch nicht siebzehnjährigen Jüngling eine Vermessungsreise nach Meißen. In der Begleitung eines älteren Zeichners fuhr er in einem von einem Bauern aus Kötzschenbroda gestellten Vorspannwagen nach Meißen. Der erste Blick auf Stadt und Schloß entzückte ihn; die Verhunzung des Domes aber durch Aufsetzen des sogenannten „Schafstalles“ ärgerte ihn. In Zitzschewig wurde gefrühstückt, bei Oberspaar hatten sie, um ein Haus herumbiegend, den vollen Anblick der Stadt. Sie stiegen im blauen Stern ab, suchten alsdann geeignetes Quartier, unterhalb der Stadt, womöglich nahe der Elbe, weil es ihre Aufgabe war, das Klostergut, das Schulholz abzumessen. Aber da nirgends etwas Passendes zu finden war, selbst nicht in der damals beliebten Wirtschaft zur Drossel, mußten sie im Stern bleiben. Die Stube gefiel ihnen zunächst nicht, denn sie erhielt des Nachts [127] eine „grauenhafte“ Beleuchtung durch eine ihren Fenstern gegenüber hängende Gassenlampe. Allmählich gewöhnten sie sich an das Quartier und fanden Gefallen an dem Verkehre im Gasthof, in dem hübsche junge Haustöchter in ehrbarer Weise die Bedienerinnen abgaben. Es gab auch ab und zu stärkeres Leben. Schiffer, die mit ihren Kähnen von Schandau angelangt waren, blieben zu Nacht; einmal lagen in einem großen Raume auch an 20 Fuhrleute auf der Streu. Ja, das politische Leben Europas zitterte bis in diesen Gasthof einer sächsischen Mittelstadt hinein. Eines Tages nahmen – gewiß flüchtige – polnische Offiziere dort Quartier. Sie versuchten, sich, so gut es ging, mit den übrigen Gästen zu verständigen, und sprachen viel von der Schlacht bei Grochow (25. Febr. 1831), an der sie beteiligt gewesen waren. Kein Wunder, daß der junge Mann, wenn er abends auf dem Zimmer saß, sich und seinem Stubengenossen Polenlieder vorsang. Sehr stark belebt wurde der Gasthof wohl auch durch die Anwesenheit von Leipziger Studenten, die, aus Meißen oder Dresden stammend, dort ihre Ferientage verbrachten und so recht nach Studentenart stundenlang, am Tage und in die Nacht hinein, im Wirtszimmer auflagen und gelegentlich ein scharfes Zechen vorschlugen und durchführten. Die Trinklieder und Trinksitten – besser gesagt Trinkunsitten – imponierten dem jungen Meßpraktikanten ganz gewaltig.
Die Wochentage aber galt es, die Aufgabe zu lösen, derentwegen sie nach Meißen geschickt waren: die Vermessung des Gebietes nahe dem Kreuzkloster. Häufig wurde es begangen, die Grenze durch Einheimische möglichst festgestellt, mit Hilfe von Trägern die Geräte, die Signalstangen aufgestellt und der Meßtisch benutzt. Es verlief – vielleicht interessiert es Techniker unsrer Tage, kennen zu lernen, wie es damals gemacht wurde – etwa so: „Donnerstag den 22. März setzten wir uns auf einem Eckpunkte der Standlinie mit dem Tische auf, richteten das Diopter auf die anderen zwei Punkte der Standlinie ein und trugen dieselbe nun aufs Papier, dann visierten wir die 8 Signale und noch mehrere Feueressen und Bäume, die sich auszeichneten. Dann wurde auf dem anderen Eckpunkte der Standlinie der Tisch aufgestellt, in die Linie eingerichtet und alles geschnitten [128] und so auch beim Mittelpunkt der Standlinie, wo sich alle drei Schnitte dann in einen Punkt köstlich vereinigten“.
Häufig war ganz schlechtes Wetter, und es mußte alles eingepackt werden, was mühselig herausgeschleppt worden war. Da aber jeden Tag Revision durch den Kammerrat von Schlieben zu erwarten war, wurde so fleißig als nur möglich gearbeitet. Ja, bis in die Träume hinein verfolgte den jungen Menschen die Sorge um die Arbeit. Einmal schrie er des Nachts laut auf und klagte, daß sie sich verlaufen hätten und nichts Ordentliches fertig werde. Da rief ihm der Kollege aus dem Bett herüber: „Herr Rachel, besinnen Sie sich doch; wir liegen im blauen Stern im Bette!“ Gar oft mußten sie über die Elbe hinüber. Nicht immer fanden sie sogleich jemand trotz häufigem „Hol über“. Oft waren auch die Kähne voll Wasser, der Überfahrende unkundig, so daß sie selbst das Ruder und den Staken nehmen mußten. Gut fuhr sie einmal ein „Pomätzschel“ über.
Gar manches in der Stadt wurde gelegentlich besucht, betrachtet. Ein Jahrmarktstag brachte „fürchterlichen“ Trubel, auch den Aufzug der Kommunalgarde. Im Dome wohnte er am Bußtag einer Predigt bei, zu der ganze 18 Menschen sich versammelt hatten. Zum Karfreitag waren es wenigstens 30; so langweilig ihm die Predigt war, so köstlich erschien ihm die Kirche. Besser besucht war eines Sonntags die Afrakirche. Eingehend wurde die Porzellanmanufaktur betrachtet, die damals noch im „Schlosse“ war. Interessant war den jungen Leuten die Maschine, mittelst deren das Holz durch einen langen, zum Teil unterirdischen Gang nach der Fabrik gebracht wurde. Kurz bevor sie Meißen verließen, sahen sie sich auch noch die Porzellanniederlage an und kauften sich Pfeifenköpfe zum Andenken.
Noch umschloß die Mauer das alte Meißen; auf ihr spazierten die jungen Leute gelegentlich und schmauchten ihr Pfeifchen dabei. Wenn sie später als 10 Uhr vom Buschbade oder sonst von einem Ausflugsort her zurückkehrten, fanden sie das Stadttor schon geschlossen, und sie mußten „den Alten“ herauspochen. Höhepunkte ihres Aufenthaltes waren wohl die Besuche des Vorsitzenden der Plankammer, des Herrn Kammerrat von Schlieben. Sie gingen ihm, wenn er angekündigt war, bis Cölln entgegen [129] und begrüßten zugleich die Damen, die er mitbrachte. Dann wurde die Gegend, in der sie gerade gearbeitet hatten, besucht, die Menselblätter revidiert und das Urteil, das meist günstig ausfiel, gesprochen. Als sie mit ihrer Hauptarbeit fertig waren, ging der junge Rachel noch einmal nach dem alten Kloster, durchstöberte alle Gänge, Treppen und Zellen. Er stellte Vermutungen an, wozu dies oder jenes Gelaß einst gedient haben mochte, kurz, der praktische Arbeiter vertiefte sich in die romantische Seite seines Auftrags. Denn trotz dieser seiner Neigung zum praktischen Berufe fehlte es bei ihm nicht an romantischen Neigungen. Das zeigen seine „tiefgefühlten“ Aufzeichnungen über die Töchter des Hauses und seine leidenschaftliche Neigung zu aufregenden Romanen, die er sich auch in Meißen zu verschaffen wußte. Außer den Venezianern von Herloßsohn las er in dieser Zeit die Wiedereroberung von Ofen, die ihn „fast verrückt“ machte. Ganz gewaltig aufgeregt wurde er durch Caroline Pichlers, einer einst sehr beliebten Erzählerin, Roman „Die Schweden vor Prag“. Es sei gestattet, eine Stelle aus dem Tagebuche hier einzufügen, die unter dem Ostersonnabend 1832 eingetragen ist.
„Welche Beweise von Tapferkeit, Großmut und Vaterlandsliebe! Besonders entzückte mich die Scene, wie Odowalsky die Kleinseite von Prag eingenommen hat und Hynko trotz dem Feuer der Schweden über die Brücke stürmt und ruft: Rettet eure Vaterstadt! Die Schweden sind da! Dann die heldenmütige Verteidigung des Brückenturmes und der ehrenvolle Tod, den er Odowalsky, seinem größten Feind, mit Anstrengung des eignen Lebens verschafft! – Köstliche Scenen! – Die Nacht verging in unruhigen Träumen, bis früh um 4 Uhr mich Herr Kühn weckte, da man eben Ostern einläutete. Ich sprang aus dem Bette, zog mich leicht an und sah zum Fenster hinaus. Es war eine schöne Nacht. Die Sterne schienen noch matt. Es wurde mit allen Glocken gelauten, und hie und da ertönten Kanonenschüsse, die ein herrliches Echo gaben. Ich glaubte mich noch halb fast in fieberischen Träumen nach Prag versetzt, wo man eben Sturm läutete und der Feind mit Kanonendonner vorrückte. Fast wäre ich die Treppe hinunter und ins Freie und [130] an die Brücke gestürzt, um unter Hynko zu fechten, als ich halb zur Besinnung kam, indem mich Herr Kühn anredete. Noch starrte ich eine Weile in die Dämmerung hinaus, dann legte ich mich müde zur Ruhe, um mich zu besänftigen und mein Blut zu beruhigen, aber es kam kein Schlaf wieder in meine Augen, bis endlich der Tag fast anbrach und ich mich überzeugte, daß ich – bloß in Meißen war.“
Am 19. März waren die Landvermesser nach Meißen gezogen, am 2. Mai, also nach etwa 7 Wochen packten sie ihre Sachen, und zwar nachts 3 Uhr, dann gingen sie zu Fuß mit Meißner Freunden bis nach Spaar, setzten sich auf den Botenwagen und waren um 9 Uhr in Dresden.
Er hatte oft bei Wind und Wetter gearbeitet, manches vor sich gebracht und, was ihm besonders wichtig sein mußte, die Zufriedenheit seines Kammerrates von Schlieben errungen. Daneben hatte er die alte Stadt fleißig durchwandert, neue und zum Teil sehr anregende Eindrücke gewonnen, Freundschaften geschlossen, Menschen kennen gelernt, mancherlei Beobachtungen gemacht, dabei auch in zarten Gefühlen geschwelgt, vielerlei Anregendes und Aufregendes gelesen und, was dieser Schilderung zugute kommt, manche Stunde, mit seltener Ausdauer, ins „Tagebuch geschrieben“. Mit dieser seiner Tätigkeit hatte er sogar seinen Mitarbeiter und Vorgesetzten zugleich, Herrn Kühn, eine Zeitlang angesteckt. Dabei verfuhr er, wie schon zu Hause, sehr freimütig. Das Tagebuchheft blieb immer auf seinem Tische offen liegen. Die Haustöchter, neugierig genug, lasen darin und filzten ihn wohl aus, wenn er über sie in begeisterten Worten etwas eingetragen hatte.
Wie sein älterer Bruder hatte auch er die große Freude, einmal die Pfingsttage bei Onkel und Tante Akzisinspektor in Neustadt bei Stolpen zu verbringen. An einem Maitage 1831 ging es mit 2 Freunden an den Elbberg, dort mieteten sie einen Kahn, der sie, 2 Gr. für die Person, bis zur Saloppe brachte. Nun ging es nach dem Weißen Hirsch und weiter östlich auf der großen Straße dahin. In der Hardt am Wegweiser fand er zu seiner Freude seine Namensaufschrift von 1830 noch vor. Im Stolpner Büschchen begegneten ihnen aber 50 Bauernjungen [131] und Bauermädel, die vom Hofe kamen. Einer fragte sie, warum sie so viele Stöcke mithätten; sie antworteten: „Um Euch Städter durchzuhauen“. Da fragte er selbst höchst trutziglich: „Wer wagt es, sich mit mir zu messen? Der komme her! Mit blauen Flecken soll er davon kommen!“ und rannte ihnen mit aufgehobenem Stocke hintennach, worauf sie alle davon liefen und schrecklich brüllten. Nahe bei Stolpen kam ihnen eine Extrapost nachgefahren, in der Bekannte saßen, die sie mitnahmen.
In Neustadt blühen nun alle Herrlichkeiten, die sich so ein 15 1/2 jähriger Junge denken kann. Die Tante war am „Pfingstheiligabend“ schon früh um 4 Uhr zum Bäcker gegangen, um Festtagskuchen zu backen. Täglich trinkt er zu Mittag mit dem Onkel 2–3 Glas Wein. Wie schmeckten die „selbstgebackenen“ Käsekäulchen dazu! Bei ihm meldet er sich, „er dürfe rauchen“, d. h. auf der technischen Schule und in der Bauschule war in den Schulgesetzen nichts darüber gesagt, während es, wie oben erwähnt, in der alten Lateinschule sehr streng genommen wurde. Der Onkel bot dem Neffen darauf selbst eine Pfeife an, und abends setzte sich Gustav mit der langen Pfeife vor die Haustüre.
Mit alten und neuen Freunden tollte er nun im Städtchen und in der Nachbarschaft herum. Einmal gab es einen Ausritt hoch zu Roß bis Burkersdorf; auf einer Fahrt nach Böhmen zu durfte er die Zügel führen.
Blieben sie im Ort, dann gab es zwischen den jungen Leuten eine tüchtige Keilerei, nachdem sie sich über den Wert oder Unwert der von ihnen besuchten Schulen tüchtig gezankt hatten. Müde davon gingen sie in des Postmeisters Scheune, setzten sich behaglich in einen Eilpostwagen und hielten ein Schläfchen.
An einem der Festtage ging es in die Kirche, und er durfte mit Akzisinspektor Zumpes mit in der Fürstlich Reußischen Kapelle sitzen und bewunderte die sehr schönen Demoiselles Hirschhorn. Nach einem tüchtigen Spaziergang gab es eine Milchkaltschale; am Abend aber wurde auf den Stadtwiesen mit seinen Freunden ein tüchtiges Feuerwerk abgebrannt.
Es kam der Abschied mit Schokolade und Kuchen! Der Onkel stiftete ihm einen Meißner Kopf, ein Knie und ein Rohr zu einer Pfeife. Bis Stolpen fuhr er in Onkels Wagen. Dann [132] begann die Fußwanderung. Vom Karrenberge blickte er noch einmal wehmütig nach Neustadt zurück, und ein Vers fiel ihm ein, moralisierend im Geiste jener Zeit:
Wenn des Abschieds Thränen fließen,
Folgsam dem Gebot der Pflicht
Soll es deinem Pfad entsprießen,
Bittend: Ach vergeßt mich nicht!
Nach Abschied vom Herrn Pastor, der bis Stolpen mitgefahren war, nahm er seinen Ranzen, den Stock in die Linke, die Pfeife in die rechte Hand und wanderte zum Tore hinaus. Unterwegs traf er einen Straßenarbeiter, der sehr gern zu diskutieren schien. Zu seinem Staunen hörte er aus dessen Reden, daß er an keinen Gott, keinen Christus, keine Auferstehung, ja an garnichts glaubte!
Über „Biela“ und den Weißen Hirsch ging es wieder bis zur Saloppe; es ward übergesetzt und nach der kleinen Schießgasse geeilt.
Zwei Jahre später, als er denn doch mit seinen 17 1/2 Jahren reifer geworden war, erblühte ihm wieder eine Pfingstfahrt nach Neustadt. Diesmal ging es bei Blasewitz über die Elbe. Früh um 3 Uhr hatten sie gewaltige Mühe, den Fährmann herauszuschreien. Ober-Rochwitz, Gönnsdorf, Schönfeld, Schullwitz, Eschdorf, Dittersbach wurden durchwandert; hier der Quandt’sche Turm auf der Schönen Höhe besucht.
Am ersten Feiertage hört er die Predigt des Herrn Pastor Klien, die er sehr schön findet. Schöner, als sie ihm geschildert[WS 2] worden war, findet er aber Pastors Mariechen, die er für diese Pfingsttage zu seiner Herzenskönigin macht, und sie hat sich ihm gegenüber sehr freundlich, herzlich und dabei sehr klug gezeigt. Schon am selben Nachmittag muß ihn der Onkel beim Herrn Pastor einführen und macht sich den Spaß, ihn als den jungen Grafen Marcolini vorzustellen. Sehr bald aber schiebt der Pastor[WS 3] den Akzisinspektor zur Stube hinaus, indem er zu ihm sagt: „Am ersten Feiertag besucht man keinen Geistlichen“.
Für den jungen Grafen Marcolini kommen nun aber herrliche Tage. Am 2. Feiertag eine Fahrt auf die Bastei. Besuch aller wichtigen Punkte: Kanapee, Ferdinandstein, kleine [133] Bastei; dazu Zusammentreffen mit Wehlener und Hohensteiner „Herrschaften“. Merkwürdigerweise ist der Weg auf der Rückfahrt einige Male so schlecht, daß der junge Mann aussteigt und den Wagen mit halten muß, damit er nicht zu sehr ins Schwanken gerate.
Nun aber große Stadtfestlichkeit: Die Neustädter Schützengilde feiert ihr 50 jähriges Jubiläum! Ein stattlicher Zug, zehn weißgekleidete Mägdlein mitten drin. Der alte Herr Postmeister, der Altkönig, der Schützenmarschall ziehen preislich daher. Wer unter den Mädchen am herrlichsten strahlt, braucht nicht erst gesagt zu werden. Vor dem Schießhaus wird ein Kreis gebildet, der Herr Stadtschreiber hält eine Rede, Lieder werden gesungen und vielmals wird Hoch gerufen. Obwohl es am Vormittag ist, geht es in den Saal und eine Polonaise wird geschritten, ehe man sich stärkt. Der alte Postmeister ist etwas wackelig geworden; „Graf Marcolini“ reicht ihm seinen Arm und führt ihn nach Hause. Gerührt lädt ihn dieser zu Mittag ein, doch er hat andere Pflichten!
Am Abend ist der große Schützenball auf dem herrlich erleuchteten Schießhaus. Freilich treten nur 10 Paare an, und eine Festpolonaise kann nicht getanzt werden, da niemand wagt, sie anzuführen. Er gibt sich dem Tanze mit Leidenschaft hin, so daß der Herr Pastor wohl sagt, man möchte ihm Zügel anlegen. Dabei versäumt er, eine etwas ältliche Honoratiorentochter zum Tanze „aufzuziehen“; er hat gar zu viele und zu herrliche Pflichten. Zum Schluß wird er, der in der Residenz bei Herrn Casorti tanzen gelernt und sich mit seinem älteren Bruder schon in der Harmonie versucht hat, so lange „turbiert“, bis er einen Kotillon anstellt. Zwei Stunden hat der Graf Marcolini den erstaunten Neustädtern immer neue Touren vorgeführt. Onkel und Pastor lachen sich halbtot über den Unsinn, den er erfindet. Die von ihm verschmähte Jungfrau aber ruft wohl: „Herrn Rachel kann der Kuckuck holen mit seinen Extratouren!“ Als sie nun gar dem Herrn Provisor eine Tour abschlägt, da ruft wohl der Onkel zu den Seinen derb, wie er nun einmal war: „Die alte Fiedel, die alte Schachtel, die sollte froh sein, wenn sie jemand zum Tanz auffordert! Ha, ha, ha!“ [134] Als der Tanz zu Ende war, brachte Onkel Zumpe im Namen „aller“ dem Grafen Marcolini, dem maître de plaisir, seinen Dank und lachte wie ein Kobold. Gern hätte sich der Vergnügungsmeister durch einen neuen Tanz für seine Ehrung bedankt, aber der vorsichtige Pastor hatte einstweilen die Musikanten schon nach Hause geschickt. So bleibt nichts anderes übrig, er holt Mäntel und Hüte; im Aufmarsch geht es nach der Stadt zurück.
Die folgenden Tage bringen noch Wanderungen über Land, zu denen er in großer Lust die einzelnen Familien aufsingt, indem er jeder vorschwindelt, daß die und die auch kommen werden. Wirklich geht es zum Pastor Otto nach Burkersdorf. Nach allerhand Spielen hilft er „den Kaffee servieren“.
Als man nach Neustadt zurückkommt, wird er vom Herrn Pastor „geleimt“; dieser sagt zu, daß man in 1 1/2 Stunden zum Tanz auf dem Schießhause sein werde. Er sendet einen Blumenstrauß ins Pastorhaus, erhält aber auf dem Schießhaus, wohin er vorausgeeeilt, die Botschaft: er möchte nur allein tanzen. Der Onkel aber lacht ihn unbändig aus. Beim Pastor Exner in Ottendorf spielen sie nach fröhlicher Wanderung am anderen Tage im Garten: „Ich bin der Herr Böttcher und treibe“ usw. Nach dem lustigen Abendbrot wird die bei der Jugend aller Zeiten beliebte Werferei mit Servietten, Blumen und Maikätzchen getrieben. Er wird, weil er’s wohl zu arg treibt, mit Rütchen geschlagen. Zur Strafe muß er am Klavier singen. Er singt:
Es ritt ein Jägersmann usw.
und alle fangen an zu weinen (!). Dann fährt er schwärmerisch fort:
Was ich gestern Dir entrissen usw.
und alle freuen sich und necken ihn kräftig. Es war so wunderwunderschön, daß ihm zu Hause das Essen nicht schmecken wollte und ihn die Tante trösten mußte, er könne ja zum nächsten Schützenballe wiederkommen – übers Jahr. Vom Tage des Abmarsches aber schreibt er, Sonnabend den 1. „Juny“: „Ich mochte zögern, wie ich wollte; ich mußte fort. Wir schleppten uns gleichsam aus der Stadt.“
In Dresden galt es auch wieder, täglich auf der Plankammer fleißig zu arbeiten. Die freien Stunden benutzte er [135] vielfach noch weiterhin zum Romanlesen. Da er der Schule und somit auch der Schulung im Lesen früh entwachsen war, ist es verständlich, daß er seine geistige Erholung mehr in solcherlei Werken als in Dichtungen höheren Stiles suchte. Es erscheinen folgende Titel: Die Treue, eine historisch–romantische Rittergeschichte; Rinaldo Rinaldini; Von der Veldes Maltheserritter; Die Belagerung Wiens; Die Wiedereroberung von Ofen; Der Sturz der Bundesritter der eisernen Krone; Die Polin, Roman von Wangenheim; Romane Coopers; Die Venetianer, Der Ungar, beide von Herloßsohn; Christine und ihr Hof; Otto von Deppens Belagerung von Sarogossa. Bedeutender schon ist Bulwers Eugen Aram, der in der Blödeschen Familie, in der auch er viel, gar viel verkehrte, abends vorgelesen wird. Auch Ifflandsche Stücke werden mit verteilten Rollen vorgetragen. Ihm selbst wurde vom Arbeitsgenossen Kühn in Meißen aus des Eckenstehers Nante Erlebnissen vorgelesen – natürlich große Heiterkeit!
Unklar lag vor ihm die Zukunft. Was sollte werden, wenn das Volontärjahr bei der Kammer vorbei war? An Militärisches wagte er kaum mehr zu denken, so sehr regte ihn noch in Gedanken die Wirkung der kriegerischen Lektüre in Meißen auf. Als er einem älteren Kollegen sagte, daß er sich fast scheue, wieder in einem kriegerischen Roman zu lesen, lachte dieser und sagte, das zeuge von angeborenem Militärgenie, er solle nur dabei fest bleiben. Da verfiel er in seinen Phantasien wieder aufs Schanzenbauen, aufs Lagerabstecken und hörte im Geiste den Donner der feindlichen Kanonen. Noch am selbigen Abend borgte er sich bei einem seiner Freunde Bücher über das Aufschlagen militärischer Lager, mit vielen Zeichnungen und Plänen ausgestattet, die ihn mächtig interessierten. Mit einer wahren Wut, wie er selbst schreibt, suchte er in den nächstfolgenden Zeiten alle alten Schwarten auf, in denen Befestigungskunde oder ähnliches enthalten war, vertiefte sich in die Zeichnungen dazu, kurz, strebte danach, später doch noch einmal als Ingenieur zum Militär zu kommen.
Auch jetzt gab es noch allerhand Vermessungsfahrten, die als Unterbrechung der Zeichenarbeit im Bureau freudig unternommen [136] wurden, wenn es auch z. B. im Wesenitztale einmal wüst war wie im „wilden Amerika“ und mittags im Dorfgasthof der Löffel im Wasserbrei stecken blieb und in einer Mühle als Nachtquartier vor heftigem Gepolter am Morgen wenig geschlafen werden konnte. Um so interessanter, wenn am Tage vielmal durch die Wesenitz, durch tiefe Gräben oder Löcher gewatet und gestiegen werden mußte. Ein andermal ging es ins „Gebirge“, über Tharandt, Grillenburg, Naundorf nach Freiberg zu Aufnahmen um Großschirma, mit Vorspann nach Frauenstein, aufs Kammergut bei Rechenberg. Frauenstein als Geburtsort des lieben Vaters mit seiner interessanten Ruine fesselte sehr; über Dippoldiswalde wanderte er zurück. Ein andermal wurde der Auftrag erteilt, den Moritzburger Tiergarten zu vermessen. Mit allem nötigen Gezeug bewaffnet, zog man zu Fuß hinaus; das Quartier wurde im Gasthof Au bon marché aufgeschlagen, in dem es, wie seinerzeit in Meißen, auch polnische Leute gab. Nach getaner Arbeit wurde die Umgebung durchschweift, Fasanenschlößchen, Wildfütterung und Auerhaus besichtigt. Sehr unzufrieden sind die jungen Leute, als ihnen das Kahnfahren aus dem Schloßteich abgeschlagen ward. Nach wenigen Tagen ist ihr Auftrag ausgeführt; mit Halleluja ziehen sie in den Gasthof ein, um am folgenden Tage wieder zu Fuß nach Dresden zurückzuwandern. Als nun der Kammerrat von Schlieben die Arbeit gemustert und für gut befunden hat, da setzt der Tagebuchschreiber ein fröhliches „Juchhe“ in seine Blätter.
Ein ganz besonderer Tag war noch der 13. Juni 1833. Der Oberinspektor Lohrmann hatte eine Messung vom Frauenkirchturm vorzunehmen und sich dazu den jungen Rachel als Gehilfen genommen. Es sprach sich, wie es schien, in den Bekanntenkreisen der Familie herum, und so stiegen denn der Kämmerer Schnabel und mehrere andere Freunde hinauf. Nachmittags stiegen sogar die würdigen Eltern mit Onkel Zumpe aus Neustadt auch hinauf. Dieser fürchtete trotz der Sommerwärme eine Erkältung in der ungewohnten Höhe, denn er „workste“, wie es hier gut Dresdnerisch heißt, ein Tuch um den Hals. Der Vermessungspraktikant hatte sich den Regenschirm mit hinaufgenommen, um ihn – gegen die Sonne zu gebrauchen. [137] Der junge Mann selbst wurde in Atem gehalten, denn sechsmal stieg er hinauf, sechsmal hinab. Dabei kletterte er in der oberen Kuppel herum und fand eine Dohle. Zu Mittag ging er vom Turm herunter nach Hause; der Oberinspektor Lohrmann aber ließ sich das Essen „auf den Turm“ bringen. In diesen Tagen wurde es lebhafter und lebhafter; eine Vermessungsreise ins „Gebirge“ war in Aussicht, und der Vater hatte für gute Ausrüstung zu sorgen. In seinem treulich geführten Ausgabenbuch steht vermerkt 64 Tlr. 8 Gr. für Meßinstrumente. Das kostbarste Stück davon besorgte sich der Sohn mit Herrn Oberinspektor Lohrmann zusammen im mathematischen Salon; es war eins von den Blochmannschen[34] Meßinstrumenten für 30 Tlr. Zu den Werkzeugen selbst kommen noch verschiedene Fahnen. Alles war sehr nötig, denn am 19. Juni sollte eine wirklich große Reise – für damals – angetreten werden. Es ging ins Gebirge. Diesem denkwürdigen Vorgange ist ein eignes kleines Heft gewidmet mit der feierlichen Aufschrift:
(eine wahre Geschichte)
Beilage zum Tagebuche des Vermessungsvolontärs G. Rachel.
Nachdem noch vielerlei besorgt worden war, begann die Fahrt von Dresden nach Sachsenfeld im Erzgebirge Mittwoch den 19. Juni mittags 12 Uhr; es gab nur ein Nachtquartier in Freiberg; von da ging es früh 4 Uhr über Forchheim, Wolkenstein, Annaberg-Buchholz nach Schlettau, nach Sachsenfeld, wo sie nach Mitternacht ankamen. In Freiberg, in Forchheim, in Wolkenstein, in Annaberg und Schlettau gab es Wagen- und Pferdewechsel; auch die Vorspannbauern wechselten; von Wolkenstein über Wiesenbad fuhr sie ein über 70 Jahre alter Bauer, der trotz seiner Jahre vielfach neben den Pferden herlief; ein andermal hatten sie einen jungen Bauern, der sehr munter und frisch darauf losfuhr und mit dem es sich ausgezeichnet unterhalten ließ. Am übelsten ging es zwischen Forchheim und Wolkenstein zu: der Wagen war morsch, die Pferde steif. Obwohl [138] sie beim Pferd- und Wagenwechsel oft lange warten mußten, weil nicht sogleich alles bereit war, manchmal bei den Bestellungen auch Irrtümer untergelaufen waren und sie außerdem stets die Sachen, darunter einen tüchtigen Bettsack, umpacken mußten, wurde doch sonst auch oft gehalten, damit sich Pferde, Bauern und Reisende durch Trinken usw. stärken konnten. Meist war es an Stellen, wo man zugleich „eine schöne Aussicht“ genoß. Den armen, oft von Bremsen jämmerlich gestochenen Pferden erleichtern es die Passagiere durch häufiges Danebenlaufen. Neue Brücken, neue Straßen wurden mit Interesse beobachtet, die Reinlichkeit und Nettigkeit Annabergs wirklich genossen, mit einem Jungen, der ihnen auf dem Markt zu Schlettau „das Wagengeleite“ abforderte, ernsthaft gestritten.
Mitten in der Nacht hielt der in Schlettau zuletzt genommene Wagen vor dem Gasthof zu Sachsenfeld, dessen Schenkwirt in tiefem Schlafe lag; endlich nach heftigem Pochen und Rufen wurde ihnen geöffnet.
Vom nächsten Tage, dem 21. Juni, an begann nun die interessante Vermessungszeit, die über 10 Wochen, bis zum 3. September 1833, andauerte.
Erst suchten sich die beiden Volontäre, der junge Baron Wagner und er, Quartier. Er fand es bei einem biederen Schuhmachermeister; dann machten sie ihre Besuche beim Dorfrichter, der mit ihnen die Grenzen beging, beim Oberförster, der ihnen, wenn es galt, auf dem nahen Geringsberg einen Chalon zu stellen, seinen Jägerburschen zur Verfügung stellte. Um einen tüchtigen Kettenzieher zu bekommen, wendeten sie sich an den alten „Vogelsteller“ Flechsig, der ihnen denn auch seinen ältesten Sohn dazu überließ. Nun ging es los; Baron Wagner, der schon einmal hier oben im Gebirge gearbeitet hatte, schulte den jüngeren Kollegen an, zeichnete ihm das geometrische Netz und überließ ihn dann seiner Arbeit. Gleich die ersten selbständigen Versuche gelangen recht gut. Leicht ist ihnen die Arbeit des Messens in diesen Sommerwochen wahrscheinlich nicht geworden, denn es regnete oft tagelang, oder die Sonne narrte sie, lockte sie hinaus, um sich bald wieder zu verkriechen. Da hieß es dann, zu Hause das Gezeichnete sichten, aufs Menselblatt bringen, [139] das Tagebuch recht ausführlich schreiben und Briefe an die Eltern in Dresden bauen. War draußen oder drinnen ordentlich gearbeitet worden, dann saß er mit seinen Wirtsleuten oder dem Baron oder auch den gemütlichen Nachbarsleuten, der Familie Vogel, vor einem der Häuser; man unterhielt sich lebhaft, politisierte und diskurierte über den Lauf der Welt. Als er einmal abends erzählte, wie sich 1830 in Dresden die Septemberrevolution abgespielt habe, fand er gespannte Zuhörer. Manches, was er über die Aprilunruhen des Jahres 1831 in sein Tagebuch eingetragen hat, von mir schon im vorhergehenden Kapitel mitbenutzt, hat er den hochaufhorchenden Gebirglern gewiß auch berichtet. Auch von seinen „Fahrten auf der Kreuzschule“ hat er dem biederen Handweber oft erzählt. Ein andermal holte der Baron seine „Stockflöte“ und blies darauf, er selbst aber sang dazu. Dann mußte wieder einmal Griechen- und Türkenspiel herhalten, dessen Figuren ihm der Tischler nach Angabe „geschnitten hatte“. Die Wißbegierde trieb den jungen Mann wohl auch an den Webstuhl eines Barchentwebers; er trieb praktisch Technologie und lernte das Weben so weit, daß er eines Abends stolz in sein Tagebuch schrieb: Ich webte bei Vogels zwei Zoll Barchent. Außergewöhnliche Freuden bereitete ihm auch das Baden im Mühlteich oder vor dem Wehre, wo sogar das Schwimmen gelang. Gänge nach dem benachbarten Schwarzenberg, auf denen nötige Besorgungen mit dem Besuch des Honoratiorengasthofes verbunden wurden, boten erwünschte Abwechselungen. Da erhoben sich denn doch „residenzliche“ Gefühle in ihm; es wurde ihm im Umgange mit „gebildeten“ Leuten angenehm zu Mute.
In Derbes und Törichtes mußte er sich bei der Landbevölkerung finden. Eines Abends wurde der Neubau einer abgebrannten Mühle gehoben; ein Zimmergeselle tat den Spruch und schloß ihn mit den Worten: „Nun, lebt wohl – Geht zu Hause und sauft Euch alle voll!“ Manche Abendstunde erzählten sich die vor den Haustüren sitzenden Gebirgler oder auch ihr Besuch Gespenstergeschichten; da merkte er zu seinem Staunen, wie hier im Gegensatz zur Stadt alles noch in tiefem Aberglauben steckte, ja sogar manche Männer!
[140] Dagegen erlebte er Freude am Schulmeister loci; dem mußte er seine Instrumente und seine Zeichenarbeiten vorlegen und erklären. Dann und wann kam er auch und forderte mathematische Belehrung, die ihm gern erteilt wurde. War dieser Mann wieder nach seinem benachbarten Hause zurückgekehrt, so nahm er wohl seine Geige, spielte darauf und „brüllte“ kräftig sein Abendlied zum offenen Fenster hinaus in die Nacht.
Eine ganz besondere Unterbrechung bereitete der Besuch des Herrn Oberinspektor Lohrmann aus Dresden, der sich über den Stand und die Güte der Arbeit der jungen Leute Klarheit verschaffen und noch manches selbst besuchen wollte. Am 14. August traf er in Sachsenfeld ein, maß verschiedenes nach und erklärte, daß der junge Rachel seine Sache gut gemacht habe; alles traf genau zu. „Ich hatte,“ so schreibt er in sein Tagebuch, „eine unmäßige Freude darüber, auch der Oberinspektor wunderte sich sehr, da man mir es überhaupt von Seiten der Kameralvermessung nicht zugetraut hatte.“ Wie freute sich der Vermessungsvolontär, als ihm der Herr Oberinspektor einen Platz in seinem Wagen anbot, falls er die Reise in Höhenmessungsangelegenheiten mit ihm machen wollte! Natürlich wurde dies freudig angenommen.
Nun begann denn eine wahre Wasserfahrt, die erst am 20. August endigte. Fast jeden Tag goß es; es war in der Gegend von Wildenthal, Eibenstock, Sosa, Plauental; auch kamen sie nach Oberwiesental und bis auf den Fichtelberg. Zweimal kamen sie abends völlig durchnäßt ins Quartier; in Eibenstock mußte er noch Stunden in den ganz nassen Sachen sitzen. Das eine Mal mußten sie ihre Tagehemden im Bett trocknen. Freitag den 18. August ließen sie sich deshalb in Bärenstein gründlich einheizen. Am folgenden Tage wurde unter erschwerenden Umständen Vermessung vorgenommen. Es heißt da: „Frühzeitig wurde der Bärenstein bestiegen. Wir hatten zwei Leute für uns, die die Instrumente trugen. Der Theodulit wurde aufgestellt, der Barometer und der Thermometer aufgehangen, und der Siedepunkt des Wassers untersucht. Das Wetter war so leidlich, aber ein gräßlich schneidend kalter Wind, und gerade als der Oberinspektor mit den Hauptbeobachtungen fertig war, kam ein [141] fürchterliches Schloßenwetter, und der Wind wurde zum Sturme. Wir packten eiligst ein, konnten aber dabei kaum aus den Augen sehen. Beim Heruntergehen wurde es so arg, daß wir uns kaum erhalten konnten. Ich hatte dabei das Vergnügen gehabt, den Bärenstein zweimal zu besteigen, da der Thermometer beim Heraufgehen vergessen worden war und der Oberinspektor ihn keinem anderen anvertraute; den Barometer und 3 Thermometer mußte ich ebenfalls heruntertragen.“ Im Rathaus von Oberwiesental erhielten sie hierauf gutes Quartier und saßen abends mit dem Herrn Pfarrvikar und dem Herrn Förster vergnügt zusammen. Für den folgenden Tag, Sonntag den 18. August, wurde eine Besteigung des Fichtelberges geplant; der Förster wollte „führen“. „Früh um 5 Uhr brachen wir auf und bestiegen den Fichtelberg. Ich machte Versuche, den Siedepunkt des Wassers zu finden, und beobachtete den Barometer und den Thermometer. Der Oberinspektor arbeitete mit dem Theodulit. Das Wetter war sehr schön, früh aber sehr nebelicht, allein gegen 10 Uhr wurde es ganz hell, und wir genossen eine herrliche Aussicht. Ich mußte die Entfernung der zwei Kuppen des Fichtelberges voneinander ausschreiten. Es ergaben sich nach doppeltem Ausschreiten 1 100 Schritt. – Die zwei Leute, die wir mit hatten, machten unterdeß ein großes Feuer, woran man sich ganz gemüthlich wärmen konnte. Der Oberinspektor ließ ein Frühstück und Wein heraufholen. Um 3 Uhr wurden wir mit der Arbeit fertig und stiegen sogleich herunter, aßen im Rathaus zu Mittag und fuhren durchs Böhmische über den Keulenberg (so!) nach Weipert zurück. Von da wollten wir über Jöhstadt nach Satzungen, um daselbst den Hirtstein zu besteigen, aber der Wirt in Weipert, wo wir einkehrten, sagte uns, daß dieser Weg bodenlos und mit dem Wagen darauf gar nicht fortzukommen wäre; daher kehrten wir nach Annaberg zurück.“
Von hier aus wurde am 20. August noch der Pöhlberg bestiegen. Hierbei hatte Rachel nur den Barometer zu beobachten. Dem Oberinspektor versagte beim zweiten Male die Nivelle, so daß er in der Arbeit nicht fortfahren konnte.
Eine hübsche Unterbrechung der Berufsarbeit bot dem jungen Mann auch einmal ein Besuch der Annaberger Verwandten, [142] namens Zumpe. Schon bei der Einfahrt in das Gebirge hatte er den Onkel Ferdinand, der in Annaberg ein „Gewölbe“ und zwar ein Schnittwarengeschäft besaß, gesehen. Als die Reise von Wolkenstein über das romantisch gelegene Wiesenbad führte, gingen die jungen Leute, um es den Pferden zu erleichtern, wieder einmal zu Fuß, bestiegen auch dabei die „Bastei“ mit ihrer schönen Aussicht. Auf der Straße nach Annaberg zu sah er aus dem Wagen von weitem eine Gestalt kommen, die ihn gar sehr an den Onkel Ferdinand erinnerte. Er war es auch wirklich. Sogleich sprang der Neffe erfreut aus dem Wagen und eilte auf ihn zu. Er wollte ins Wiesenbad gehen, um das Wasser zu gebrauchen. Freundliche Einladung, nach Annaberg zu kommen, erfolgte bei dem herzlichen Abschiede. Fünf Wochen später am 26. Juli machte sich der Herr Vermessungsvolontär früh um 5 Uhr auf, um den geplanten Besuch auszuführen. An guter Aufnahme fehlte es nun wahrlich nicht. Obwohl die ganze Familie in der Zwischenzeit die Masern gehabt hatte, war der Onkel lustig und vergnügt. „Wir tranken zum Frühstück eine Flasche Würzburger Wein und aßen Annaberger Johanneskuchen; es war gerade Annaberger Jahrmarkt. Zu Mittag aß ich mit dem Onkel allein, und zwar Forellen, denn die Tante mußte statt des Onkels im Gewölbe sein“. Auf dem Rückweg ging er mit seinem Hausnachbar Vogel aus Sachsenfeld wieder über Schlettau und Raschau dahin zurück. Sie waren sehr lustig, so daß ihnen die Stunden wie im Fluge vergingen. Dazu begegneten sie in „Rasche“ noch ganzen „Mädelkolonnen“, die zu necken einen Heidenspaß abgab.
In den letzten Augusttagen wurde, sobald es die immer noch regnerische Witterung erlaubte, eifrig gearbeitet. Als am 2. September bei günstiger Witterung in frühster Morgenarbeit das Letzte fertig gebracht worden war und nun noch einmal ein gewaltiger Regen einsetzte, da kehrte der junge Mann, ein fröhliches Lied singend, ins Dorf zurück, siegelte sein Menselblatt ein und trug es im prächtigsten Wetter nach Schwarzenberg auf die Post. Überall wurde Abschied genommen, die Sachen gepackt, und unter freundlicher Begleitung ihm lieb gewordener Menschen verließ er früh 5 Uhr Sachsenfeld und dessen Umgebung. [143] Über Bayernfeld, Grünhain und Zwönitz ging es nach Stollberg, wo das Kammergut Hoheneck liegt. Nachdem sich Freund Vogel verabschiedet hatte, wanderte Rachel allein nach Chemnitz. Dort speiste er Mittag 2 Uhr in dem Gasthof zur Sonne, der vor der Stadt gelegen war. Über Unter- und Oberwiese, sowie über Gückelsdorf ging es ins Nachtquartier zu Oederan. Am anderen Morgen 5 Uhr weckte er „tobend und schimpfend“ die Wirtsleute und eilte über Freiberg bis nach Grillenburg. Da es gewaltig zu regnen anfing, nahm er mit einem Maler zusammen einen Wagen, in dem beide über Tharandt nachmittags 3 Uhr in Dresden ankamen. An den Klepperställen[35], wo der Fuhrmann einstellte, stieg er aus und eilte, glücklich, die Familie wiederzusehen, nach der nahe gelegenen kleinen Schießgasse. Er fand hier den Abschluß häuslicher Veränderungen. Die Eltern hatten das dritte Stockwerk verlassen, aus dem der Verkehr im Hausgarten immerhin mit Schwierigkeiten verknüpft war. Das Erdgeschoß, das ehemalige Gewölbe der Hauptauswechselungskasse, war in ebenso geschickter, wie gemütlicher Weise in einen Gartensaal und zwei anliegende Stuben umgewandelt und durch eine neugebaute Innentreppe mit der nach dem Garten gelegenen Hälfte des ersten Geschosses verbunden worden. Oben wohnten Eltern und Schwester, unten die Söhne im größeren, und die würdige Großmutter im kleineren Zimmer. Feierlich bemerkt er in seinem Tagebuch, daß er am 29. September 1833 in sein neues Zimmer gezogen sei.
Die Reise und der längere Aufenthalt im Gebirge hatten ihm ohne Zweifel manchen Nutzen gebracht: selbständigere, verantwortungsreichere Arbeit als bisher; Bekanntschaft mit der Industrie des Gebirges, denn manches Hammerwerk und hie und da Gruben hatte er besucht; Verkehr mit den gemütlichen Gebirglern, über die er nie eine Klage anzubringen hat, nur einmal bedauert er, daß ihm nachts ein Chalon gestohlen worden sei; und nicht zum wenigsten echte Ingenieurarbeit bei Wind und Wetter, wobei der Körper gekräftigt, der Geist geschärft wird.
Das Leben während des Herbstes und Winters in Dresden brachte allerhand Vermessungen, nebenher ernsthafte mathematische [144] Studien, bei denen der schon früher hochgeschätzte Prof. Schubert guten Rat und nützliche Bücher geben mußte. Schon erteilte der Lernende[WS 4] selbst Stunden in den Anfangsgründen der Mathematik. Denkwürdig wurden, ohne daß er es vielleicht ahnte, die Monate Mai und Juni 1834 für ihn. Es fand nämlich „Eisenbahnvermessung“ durch die Plankammer statt, und zwar handelte es sich um eine Linie nach Wurzen, Leipzig, die aber in Friedrichstadt ihren Anfang nehmen sollte; denn zunächst wurde über „Priesnitz und Kostebaude“ hin vermessen.
Das Komitee zum Bau einer Eisenbahn zwischen Leipzig und Dresden zog im Jahre 1834 mehrere Linienführungen in Erwägung: von Leipzig über Wurzen, Mügeln, Lommatzsch, Meißen, oder über Grimma, Leisnig, Döbeln, Freiberger Mulde und Weißeritztal; beide nach Dresden-Altstadt; ferner linkselbisch bis Strehla und rechtselbisch nach Dresden-Neustadt. Schließlich wurde die zuletzt genannte Linie, nur über Riesa, statt über Strehla, gewählt. Im Jahre 1834 wurde die oben zuerst genannte Linie über Meißen nach der „speziellen Charte“ besonders erwogen, die Oberlandfeldmesser Kammerrat von Schlieben von einem[WS 5] Beamten anfertigen ließ. Dieser Vorgesetzte des jungen Rachel plante die Bahn von Dresden hart am linken Elbufer, wollte den Meißner Plossenberg mit einem Tunnel durchbohren, dann auf einer großen Brücke über das Triebischtal gehen, um schließlich über Zehren, Hirschstein bis nach Strehla zu gelangen. Schlieben standen bei dieser Arbeit der angesehene Oberinspektor Lohrmann, der Vermessungskondukteur Preßler und der jüngere Stab der Feldmesser zur Seite. Im Januar 1835 waren die Arbeiten fertig; Hauptmann Wasserbaudirektor Kunz bearbeitete das Projekt, nach dem die Bahn von Leipzig über Wurzen an die Elbe vordrang, sie überschritt und dann in Dresden-Neustadt endigte. Dieses Projekt siegte bekanntlich, weil es trotz der Elbbrücke bei Riesa, des Oberauer Tunnels doch als vorteilhafter erschien, da man auf diesen Spuren die Verbindung nach Berlin und nach der Lausitz besser zu gewinnen hoffte.
Als damals im Juni die Vermessungsarbeiten bis „Kostebaude“ beendet waren, begab sich der junge Rachel zu gleichem Zweck nach Wurzen und arbeitete sich von da nach Leipzig, wo [145] er sehr vergnügte Tage zubrachte. Wieder nach Kühren zurückgekehrt, machte er sich an die Ausarbeitung der Detailaufnahmen. Da wurde er durch ein Schreiben zurückberufen. Die rechte Begeisterung für den Beruf, in dem er später so Tüchtiges leisten sollte, schien ihn noch nicht gepackt zu haben, denn er fügt die Notiz hinzu: „Dies war mir um so lieber, da mir eine sehr langwierige Arbeit bevorgestanden hätte.“ Wie groß, wie unbeschreiblich war aber seine Freude, als ihm nach seiner Rückkehr mitgeteilt wurde, daß ihm einstweilen ein jährliches Gehalt von 120 Talern ausgesetzt worden sei!
Einige Monate darauf kam auf seiner Plankammerexpedition die Rede darauf, daß die ganze Kameralverfassung aufgelöst werden sollte. Der Vater beruhigte den darüber aufgeregten jungen Mann und meinte, wenn auch keine Aussicht auf die Katastervermessung wäre, wolle er ihn auf dem Rathaus bei der Steuer unterzubringen suchen. Das erschien ihm als ein Trost, der ihn beruhigte. Da eröffnete sich ihm im Januar 1835 doch die Hoffnung, zur Landesvermessung genommen zu werden. Er begab sich zu deren Vorstand, dem Oberstleutnant Leonhardi, aufs Landhaus und meldete sich als Geometer. Zunächst wurde er, der gerade Neunzehnjährige, freundlich und zuvorkommend aufgenommen. Bald sollte sich das aber ändern. Hören wir, wie seltsam sich in jenen guten, alten Zeiten Anmeldung, Prüfung und Annahme für ein Amt abgespielt haben. „Das zweite Mal erklärte mich Oberstleutnant Leonhardi geradezu für blind. Ich war außer mir und hatte große Lust, sogleich wieder fortzugehen, wenn mirs nicht um meine Eltern war. Ich antwortete erst nach einigen Minuten, dann stellte ich es ihm aber mit lauten und derben Worten vor und berief mich auf meine gelieferten Arbeiten; indeß er blieb dabei, durch die Brille sehe man falsch. Endlich wurde mir’s unausstehlich, ich empfahl mich. Doch bestellte er mich nachmittags (am 21. Januar 1835) wieder hin. Voller Wut über solche Grobheit ging ich zu Haus – setzte mich einige Zeit hin, repetierte, wußte aber zuletzt nicht, was ich gelesen hatte. – Endlich rannte ich hinunter in die ehemalige Strafkaserne, ließ mich anmelden, trat ein. Krause saß drin; sogleich kam Leonhardi geschossen, setzte mit den Worten: ‚Hier, [146] schnelle – ich sehe nach der Uhr’ eine Aufgabe hin. Doch ich brauchte lange, ehe ich meine Besinnung zusammen hatte. Dann machte ich es rasch fertig und trug es hinaus. Er sah mich an und sprach: ‚Das ist falsch!‘ War ich erst ohne Fassung über die Worte: ‚Sie sind ein blinder Mensch, ich kann Sie nicht gebrauchen‘, so wurde ich es nun vollends durch die kalt und malitiös ausgesprochenen Worte: ,Das ist falsch!‘ – Ich setzte mich wieder hin, wollte arbeiten, es war nicht möglich. Immer fielen mir wieder die vor allen Leuten gesprochenen Worte ein: ‚Sie sind blind!‘ Mein Innerstes war furchtbar aufgeregt. Plötzlich mahnte Leonhardi wieder. Ich raffe mich etwas zusammen und mache es noch einmal, doch – wie ich es mir nun vorher dachte – falsch. Denn ich wußte nicht, was ich im nächsten Augenblick gerechnet hatte. Endlich setze ich mich nochmals hin, fange wieder an, streiche aus – am Ende stütze ich mich mit beiden Händen auf den Tisch, lasse die Arbeit liegen und sammele so nur einigermaßen meine Gedanken; ich fange wieder an, finde Zusammenhang und mache es fertig. Noch ehe ich es übergab, sagte ich ihm mit ruhigen Worten und mit Fassung den ganzen Zusammenhang und meinte, daß ich es zu Haus für Spaß erachtete, so eine Aufgabe zu lösen, doch hier nach solchem Auftritte sei es unmöglich, etwas Richtiges zu Stande zu bringen, wenigstens gehöre da einige Zeit dazu, um das zu vergessen. Er hörte mich ruhig an, sah mir scharf ins Gesicht und erwiderte gegen mein Erwarten: ,Das sehe ich ein, und Ihnen ist es nicht allein so gegangen, darum will ich Ihnen jetzt keine Aufgabe weiter geben; kommen Sie in acht Tagen wieder.‘ Dies freute mich um so mehr, als ich eine ganz andere Antwort erwartet hatte. Ich empfahl mich und dachte im Fortgehen an meinen Mitarbeiter, der vor Schreck über das ebenfalls gegen seine Arbeit ausgesprochene: ,Das ist falsch!‘ in Ohnmacht fiel und Nasenbluten bekam. Dieser wurde ebenfalls mit der Weisung, in acht Tagen wiederzukommen, entlassen. Vorher war er aber natürlich wieder durch Eau de Cologne zur Besinnung gebracht worden“.
„Am 29. Januar hatte ich dann einen Mordsexamen bei Leonhardi zu bestehen, doch es ging mit Gottes Hilfe alles sehr [147] gut, und ich freute mich wie ein Schneekönig, als ich wieder vor der Türe der Artillerieschule stand.“ Vier Tage später nahm er „solemniter“ Abschied von der Kameralvermessung, und vierzehn Tage darauf trat er in einen Lehrkursus für Steuergeodäten im Landhaus. Als er antritt, sieht sich der Oberstleutnant wieder die Brille an und fragt, ob er ihn bestellt habe; ja, er wiederholt förmlich den alten Streit wegen des Auges. Der junge Mann beherrschte sich und sagte sich, die Gewißheit müsse doch nun bald kommen.
Wie wenig geschultes Personal man damals zu solchen verwaltungsrechtlich wichtigen Zwecken hatte, geht daraus hervor, daß an den Vorlesungen, die von 8 bis 4 Uhr dauern, 15 bis 20 Jäger und Forstvermesser teilnehmen, von denen manche, die viel älter als er waren, oft ganz wunderliche Fragen stellten oder Antworten gaben. Von solchen Antworten sagt der einstige Vermessungsvolontär stolz: es verlohnt sich der Mühe, sie zu notieren, z. B.: wenn auf die Meile 4 Menselblätter kommen, wieviel auf die Quadratmeile, sagt einer: 4, der andere: 8. Den meisten Spaß macht ihm, als ein Forstvermesser, namens von Götz, der in Sporen erscheint, zum Oberstleutnant tritt und die Frage stellt, was eine Parzelle sei. Nach der Vorlesung am 20. Februar 1835 gingen fast alle Teilnehmer nach der Elbe, um das Calberla’sche Dampfboot anzusehen, das, wie so viele Menschen in Dresden, namentlich junge Techniker interessieren mußte.
Einige Monate hatte er nun im Landhause zu hören und zu arbeiten. Für Anfang April kam die Anstellung als Feldmesser in der Nähe von Radeberg; Wallrode sollte sein Standquartier sein. Mit dem bei Stadt Berlin haltenden Botenfuhrmann reisten alle Angestellten ab, und er selbst bezog sogleich ein sehr gutes Quartier im Dorf Wallrode. Bald hatte er herausgefunden, daß es sich um ein recht schwieriges Gelände handelte: viel Wald, „ungeheuere“ Sümpfe und Gründe. Hier wurde denn nun den Frühling und Sommer lang gearbeitet. So oft es nur möglich war, ging es abends nach Radeberg, wo man sich mit den verschiedensten Leuten bei Bier und Billard vergnügte. Besonders schöne Tage waren es, wenn der Vater und [148] die Brüder oder Dresdner Freunde herauskamen und den Sonntag mit ihm verbrachten, oder wenn ein Ball, eine Familieneinladung ihm erwünschte Veranlassung gaben, Sonnabend nach Dresden hineinzufahren oder gar zu laufen. Mit welcher Seligkeit saß er dann im vertrauten Familienkreise, scherzte und tanzte mit den Freundinnen der Jugend, besonders aus den Familien des Kammerrat Nitzsche und der verwitweten Frau Geheimfinanzrat Blöde, deren drei durch äußere Schönheit auffallende Töchter gar viele junge Leute anzogen. All diese Erlebnisse der schönen Sonntage vertraute der junge Mann entzückt, ja gelegentlich verzückt dem geliebten Tagebuch an, das er in seiner Einsamkeit auf dem Lande geradezu seine einzige Freude nennt. Durch die Arbeit verhindert zu sein, an ihm weiterzuschreiben, verursacht ihm wirklich Betrübnis.
Aus diesen Jugenderlebnissen eines jungen Technikers vor nun 80 Jahren seien romantisch-schwärmerische Erlebnisse, aber auch unangenehme amtliche Zusammenstöße berichtet. Zunächst eine Landpartie vor 80 Jahren – ein Sonnenblick genau wie in unseren Tagen.
Am Mittwoch vor Himmelfahrt, den 27. Mai, waren die jungen Leute wieder einmal nach Dresden gewandert, und der junge Rachel ging, nachdem er mit den Eltern zu Abend gegessen, mit seinen Freunden „noch um die Stadt spazieren“, d. h. die Promenaden um die Altstadt. Donnerstag früh 7 Uhr kam ein großer Wagen, und Rachels, Blödens, Nitzsches samt etlichen jungen Leuten stiegen ein. Die Fahrt ging nach Pillnitz, das, weil eben doch etwas weit gelegen, unter den Ausflügen selten erwähnt wird. Man lachte und sang lustige Weisen. In Pillnitz sah man sich alles an, z. B. auch die Kapelle. Zu Fuß ging es über die Ruine oder Eremitage nach dem Porsberg, allwo zu Mittag gegessen wurde. Im Regen ging es nach Marschendorf und Krieschendorf. Während der gezwungenen Einkehr wurde der Stadtrat Rachel zum König, eine der Blödeschen Töchter zur Königin des Festes gewählt. Schöne Stunden verlebten die jungen Leute in der Keppmühle und – Arm in Arm – auf der Wanderung über Wachwitz nach Loschwitz. In Loschwitz gab es Streit mit dem Fährmann, dem der Vater Rachel ein [149] paar tüchtige Grobheiten aufhalsen mußte; eins der jungen Mädchen weinte gar sehr, als der vollgeladene Kahn über das Wasser dahinschwankte. In Blasewitz gab es Abendtafel und hinterher lustiges Spiel. Bei herrlichstem Wetter gehen sie noch zu Fuß nach Haus. Schnell schreibt der junge Mann in sein Tagebuch und ruft zuletzt: „Gute Nacht derweile! Ihr Leute, weckt mich murgen bei rachter Zeit, murgen da giht’s nach Raberg“ – ein Beweis, wie er die Lausitzer Töne schon gewöhnt geworden ist.
Romantischer wird sein Bericht, wenn er wieder einmal, von all seinen kleinen Berufsnöten sich erholend, mit den von ihm geliebten Menschen zusammen sein darf. Nach fröhlichem Mittagessen wanderten die befreundeten Familien aufs „Bad“; eben hörte er noch, heiter und glücklich, die Töne eines Straußschen Walzers, da stürzte der jüngere Bruder in den Saal und meldete, daß der Wagen der Wallroder Hausleute, mit dem er hereingefahren war, vor der Türe stehe. „Ich nahm schnell Abschied, stürzte zum Tore hinaus und sprang in den Wagen.“ Ein andermal, als er schon etwas weiter, in Arnsdorf, stationiert war, fuhr er Sonnabends zum Ball herein, tanzte bis 4 Uhr früh, ging nach Haus, zog sich um und eilte dem Vater, der am Sonntagmorgen zum Vogelherd hinter dem Waldschlößchen gegangen war, nach; aber es wurde ein schlechter, regnerischer Tag und daher nichts gefangen.
Der 11. Oktober 1835 war ein besonders schöner Tag. Im Hause wurde der 85. Geburtstag der würdigen Großmutter gefeiert; es sollte ihr letzter sein. Nach dem heiteren Mittagsmahle schlich sich der Gustav zur befreundeten Familie Blöde hinüber und klagte der einen, ihm besonders teueren Tochter, daß er draußen soviel entbehren müsse, besonders die Musik, da er nicht einmal spielen könne. Sogleich bot sie ihm ihre Gitarre an, er sollte sie mitnehmen. „Ich ließ mich nicht lange bitten, fragte sie nur noch einmal ernstlich, ob sie nicht spiele; als sie verneinte, nahm ich es an. Beim Abschiednehmen brachte sie mir die Guitarre; ich hielt sie hoch in meiner Hand und rief: „Ich halte sie heilig!“ Dann stürzte ich zum Zimmer hinaus. Da blickten sie mir noch nach; ich drückte die Guitarre an den [150] Mund, schwenkte die Mütze und verschwand.“ Darauf packte ihn eine mächtige Gemütsbewegung. Während er mit Eltern, Freunden und Brüdern am Abendtische saß, mußte er aufspringen, in den Garten gehen, um seine Tränen zu verbergen. „Die Nacht weinte ich mehr, als daß ich schlief. Früh 3 Uhr wurde aufgebrochen. Der Vater, der mich geweckt hatte, schloß mir noch das Haus auf, ich umarmte ihn noch einmal, drückte ihm stark die Hand und eilte um die Ecke. Es war eine schöne Mondennacht. Auf der Brücke erwartete mich Wilhelmi, und wir gingen nun schnell zusammen fort. Ich hatte die teuere Guitarre umgehängt, die ich öfters mit Tränen in den Augen an das Herz drückte. In Bühlau tranken wir bei Mondenschein Kaffee, um 7 Uhr traf ich wieder in Arnsdorf ein.“
Brachten solche Tage neben neuen Freuden sicher auch neue Schmerzen, so boten die amtlichen Vorgänge noch ganz besondere Aufregungen. Der Inspektor, den der Oberstleutnant Leonhardi über die jungen Vermesser gesetzt hatte, war ein unangenehmer Herr, hämisch, hart und wohl nicht ganz offen. Er war mit dem Fortgang der Arbeiten nicht zufrieden, vielleicht zum Teil mit Recht, obwohl die Angestellten selbst von Anfang an kein Zutrauen zu seiner Leitung gehabt hatten. „Wir behielten zuletzt auch recht, denn der Inspektor wurde abberufen, und nicht im Sinne der Beförderung.“ Der entschlossene Sinn der „Brigade“, wie Gustav Rachel mehrere Male alle Angestellten zusammen nennt, offenbarte sich in diesen Kämpfen sehr deutlich, und wir sagen mit Lessings Nathan: „Ich mag ihn wohl, den guten, trotz’gen Blick! den drallen Gang!“ Zu seiner inneren Erleichterung hat er die Art, wie er gegen den mit faunischem Lächeln ihn anschuldigenden Inspektor aufgetreten ist, seinem Tagebuch anvertraut; nicht so völlig, denn ihn quält die Sorge, daß dieses ihm so teuere auch einmal in „Schurkenhände“ kommen könnte. Einst eröffnete der „Gott sey bei uns“, so nennt er ihn wohl auch, den jungen Leuten, die in Reih und Glied vor ihm stehen: Obgleich sie die besten drei Arbeiter wären, hätten sie bei weitem nicht genug gearbeitet: sie seien saumselig, ungehorsam und Gott weiß was gewesen; das Direktorium habe beschlossen, sie auf 20 Tlr. monatlich herabzusetzen. Ferner warf er ihnen ihr [151] Tagebuchschreiben, Studiererei usw. vor. Einer der Genossen trat aus der Reihe, um sich wegen des Tagebuches zu verteidigen; er tat ebenso. Am liebsten hätte er seinen Abschied gefordert; aber er hatte keine anderen Aussichten und mußte fürchten, der Schritt könne von den Eltern falsch beurteilt werden. „Mit Zähneknirschen trat ich wieder zurück.“ Als der Inspektor ihm ein andermal mit Behagen sagte, er sei beim Oberstleutnant angeschwärzt, weil er die Zeit unnütz verbrächte und manche Tage schliefe, da erwiderte ihm der junge Mann, bis ins Innerste empört, daß er diesen Anzeiger für einen Schurken erkläre. Dieses, wenn auch gewagte, aber kraftvolle Auftreten trug seine Früchte; der Gefürchtete wurde in der Zeit, bis er dann selbst versetzt und zurückgesetzt wurde, höflicher; er hatte eingesehen, daß er mit dem jungen Rachel auf diesem Wege nicht durchkomme.
Im Herbst wurde er nun nach Arnsdorf versetzt. Wieder plagen ihn allerhand Nöte der Witterung und der widerhaarigen Bauern. Er faßt an einem stillen Sonntagnachmittag alles, was ihn quält, in folgenden Worten zusammen: „Komme ich früh heraus und regnet es nicht, so fange ich an zu arbeiten. Keine Viertelstunde vergeht, so fängt das Papier an zu schwellen; bald darauf stellt sich der Wind ein, der am Ende gar zu Sturm wird und mir vor meinen Augen das Instrument umwirft; endlich findet sich auch der Regen ein, der von Viertelstunde zu Viertelstunde ärger wird. Nun lasse ich alles einpacken und nehme die Kette vor. Die Orte, wo ich zu messen habe, sind theils sumpfige Wiesen oder dergl. Wald. Die Grenze macht ein im Zickzack laufender Graben; habe ich nun eine Stunde messen lassen, so ist unterdessen das Wasser durch die Stiefel gedrungen, und man ist um die Füße ganz naß, der Wind kältet nun auf eine furchtbare Weise aus, und der Regen hat unterdessen die Kleider durchzogen, damit der schneidend kalte Wind desto schneller seine unerträgliche Wirkung hervorbringen kann. Bin ich nun auf diese Weise ganz durchnäßt und ausgefroren, und ich sehe, daß der Regen nicht gleich aufhören wird, so sage ich den schon längst murrenden Leuten, daß wir nach Hause gehn. Zu Hause angekommen, setze ich mich einsam in meine Stube [152] (wenn man eine hat!) und arbeite. Habe ich nun den Tag über gearbeitet, oder habe ich mich gar einmal verleiten lassen und bin noch einmal hinausgegangen und es ist doch wieder schlimm geworden, dann hinein ins Zimmer; ich lege mich aufs Kanapee und träume von einst glücklichen Zeiten. Sollten meine Brüder solches erleben, sie liefen am dritten Tag davon! Ich bin unter diesen Bauern wie unter Verrätern; täglich Ärgernis über die niederträchtigen Frevel an unseren Absteckungen.“
Im Spätherbst 1835 winkt ihm in einem freundlich gelegenen Orte bessere Zeit. Er ist in Mühlsdorf an der Wesenitz, Lohmen gegenüber gelegen, stationiert: „Es ist ein netter Ort; meine Wohnnng liegt sehr romantisch; sie ist zwar sehr klein, aber nichtsdestoweniger zum Schwärmen geeignet. Aus meinem Fenster sehe ich unmittelbar in den tiefen Grund der schäumenden Weßnitzbach. Die langen Abende – es ist November – vertreibe ich mir durch Guitarrenspiel, Gesang und mathematische Studien. Meine Arbeiten im Freien bilden unter sich einen grellen Contrast: die Hälfte der Arbeit ist sehr leicht und der andere Theil sehr schwierig. Dieser letzte Theil ist nehmlich die Aufnahme der Weßnitz, welche sich beträchtlich weit erstreckt. Ich muß mir, um das Thal wenigstens Stückweise übersehen zu können, hervorragende Klippen zu meinem Standpunkt aussuchen, was bei der Kälte und häufigem Glatteis eine lebensgefährliche Arbeit. Doch Vorsicht und Klugheit überwinden alles!“
Mit diesen Worten bricht das über vier Jahre geführte Tagebuch ab. Der letzte stattliche Band hätte ihm noch mehr als die Hälfte unbeschriebenes Papier geboten; er hat es nicht benutzt. Kostete es ihm doch zuviel Zeit? Hatte er in seinem stillen Ringen um ein geliebtes Mädchen nun sein Ziel erreicht? Sind seine Kämpfe um Wertschätzung seiner Arbeit nun ganz glücklich abgeschlossen gewesen? Denn zwischen Liebe zur Jugendgenossin und Haß gegen den widerwärtigen Vorgesetzten hatte sich seine Gefühlswelt lange Zeit im wesentlichen bewegt. Genug, die Feder ruht. Erlebnisse und Empfindungen des jungen Dresdner Technikers liegen nun in ausführlichen Niederschriften nicht mehr vor; aber charakteristisch für seinen späteren Lebensweg sind [153] die letzten Worte, die er eingetragen hat: Vorsicht und Klugheit überwinden alles. Der Techniker, der künftige Ingenieur hat dies auch wahr gemacht.
So sei zum Schluß kurz auf den Lebensgang des Gustav Rachel hingewiesen.
In den Jahren, da er eine einfache theoretische, eine tüchtige praktische Ausbildung erlangt hatte, kommt in Sachsen die große Wendung im Verkehrswesen: der Eisenbahnbau. Er meldet sich zu den vorbereitenden Arbeiten an der Leipzig-Dresdner Bahn. 1836–37 nimmt er teil an den Vermessungen und dem Nivellement. 1837–39 hat er als Ingenieur-Assistent die Aufsicht über Erd- und Kunstarbeiten und wohnt zumeist in Oberau, in dessen Nähe die großen Einschnitt- und Tunnelarbeiten betrieben wurden. Er hatte dabei die Genugtuung, einen Tunnelbau, der ursprünglich einem englischen Ingenieur übertragen worden war, auf sein Gesuch hin nach eigenen Entwürfen und ohne Verlust auch nur eines einzigen Arbeiters zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber durchzuführen. Als der Oberauer Tunnel in der Hauptsache vollendet war, wurde eine kleine Feier bei Fackelbeleuchtung gehalten. Aus kleinen Gläsern wurde Wein getrunken und diese dann gegen die Tunnelwand geworfen. Da sein Glas nicht zerbrach, hob er es auf und ließ eine entsprechende Inschrift hineinschleifen. 1840 benutzte er dasselbe bei ähnlichen Anlässen an der Wien-Gloggnitzer Bahn, der Anlaufsbahn zum Semmeringpaß. Auch dabei blieb das Glas unversehrt, und wieder ließ er Inschriften anbringen. [36] Mit Recht wird in der Denkschrift zur Feier des 8. April 1884: „die Leipzig-Dresdner Eisenbahn in den ersten fünfundzwanzig Jahren ihres Bestehens“[37] sein Name mit unter denen genannt, die bei diesem Bahnbau ihre Schule im Eisenbahnwesen durchgemacht haben. Als am 8. April 1839 die ersten Züge zwischen den beiden sächsischen Städten verkehrten, [154] waren die Beamten an einzelnen Stationen zur Begrüßung aufgestellt. In Oberau, nach der geleisteten Arbeit sehr passend, stand Ingenieur-Assistent Gustav Rachel.
In den Jahren 1840–42 war er an den Vorarbeiten einer Bahn von Prag nach Dresden beschäftigt. 1842 eröffnete sich ihm eine Gelegenheit, im mehr und mehr erwachenden Sächsischen Eisenbahnbau verwendet zu werden. Das Komitee für die Sächsisch-Schlesische Bahn, die nach Görlitz geplant war, stellte ihn an. Diese bescheidenere Stellung konnte er aber sehr bald mit der wichtigeren eines Oberingenieurs an der Löbau-Zittauer Bahn vertauschen. Ein größeres Bauwerk auf dieser Strecke, der hohe Viadukt bei Herrnhut, erinnert heute noch den, der in der Geschichte des Sächsischen Eisenbahnbaues bewandert ist, an Gustav Rachel.
Hier in Herrnhut gewann er, 27 Jahre alt, aus der alten Familie der Brüdergemeinde Erxleben seine Lebensgefährtin.
Der Bau dauerte von 1845–1848. Nicht gleich bot sich wieder Verwendung, da nur wenige Bahnen in Sachsen ausgeführt wurden. Er stellte sich dem K. Finanzministerium zur Verfügung und wurde zur Ausarbeitung von geplanten Verkehrsanlagen verwendet. So entwarf er in diesen Jahren u. a. auch die Anlage einer Pferde-Eisenbahn zwischen Tharandt und Freiberg, zu einer Zeit, als noch nicht einmal die Albertbahn, die Bahn von Dresden nach Tharandt, bestand.
1853 fand sich wieder eine lohnendere und interessantere Beschäftigung. Eine Privatgesellschaft plante eine Bahn von Zittau nach Reichenberg in Böhmen. Der Oberingenieur der Löbau-Zittauer Bahn wurde mit dem Bauprojekt und dessen Ausführung betraut. In den Jahren 1853–59 wurde die Bahn gebaut; von den zahlreichen Kunstbauten der in gebirgiges Gebiet führenden Bahn ist der sogenannte Neiße-Viadukt gleich hinter Zittau beachtlich genug.
Bald nachdem diese Aufgabe in Diensten einer Privatgesellschaft gelöst war, nahm ihn die Sächsische Regierung selbst in ihre Dienste. Bei der Einrichtung einer östlichen und einer westlichen Eisenbahndirektion wurde er zum Direktionsrat der östlichen Direktion in Dresden ernannt; bei der Zusammenlegung [155] beider zu einer Generaldirektion wurde er deren Mitglied, und im Jahre 1875 berief ihn das Vertrauen des Finanzministers von Friesen als Geheimen Finanzrat ins Ministerium. Beinahe 70 Jahre alt, trat er in den Ruhestand und starb am 15. Dezember 1886.
Einfach waren seine Anfänge in jungen Jahren, wie er sie in seinem Tagebuche geschildert hat; eifrig hat er in seinen Mannesjahren in Theorie und Praxis hinzugelernt; tüchtig zeigen ihn seine Leistungen im Eisenbahnbau der Frühzeit; daher das Vertrauen, das ihm im reiferen Alter entgegengebracht wurde und dessen er sich als Rat im Ministerium und als Mitglied der Prüfungskommission für Ingenieure würdig gezeigt hat.
[156]
Es wäre seltsam gewesen, wenn nicht auch den dritten Sohn des Hauses, Hermann Moritz Rachel, geb. am 1. November 1819, die Neigung, in Tagebüchern das Erlebte, das Gefühlte zum Ausdruck zu bringen, gepackt hätte. Der jüngste Bruder war im Jahre 1830 auf die Kreuzschule gekommen und hatte sie Ostern 1839 verlassen, um nach Leipzig zum Studium der Medizin zu gehen. Fünf Hefte Tagebuch hat er hinterlassen, lose Blätter nach Jahrgängen geordnet, auf deren Umschlägen der besondere Titel „Erlebtes“ zu lesen ist. Auch er hat zunächst die Tagesereignisse auf Zettel flüchtig hingeworfen und die Angaben dann später weiter ausgearbeitet. Ja, aus der letzten Fassung, die vorliegt, geht hervor, daß er in seiner Begeisterung für Ergüsse der Seele die älteren Entwürfe einige Jahre später wieder umgearbeitet und in neue Form gegossen hat. Nicht immer ist er damit zustande gekommen, so daß oft viele Seiten frei geblieben sind, auf die er die letzte Fassung noch hat schreiben wollen. Bei der Fülle der Arbeit, die dies neben dem Studium, das wohl manchmal etwas zu kurz gekommen ist, verursachte, ist es nicht erstaunlich, daß der Lücken gar viele geblieben sind. Seine Niederschriften erinnern manchmal an „Denkwürdigkeiten“ oder, wenn man das Fremdwort gebrauchen will, an Memoiren, denn oft sind Briefe, die er geschrieben oder erhalten hat, mit hineingearbeitet. Der Vergleich zwischen solchen Stücken und den [157] zum Teil noch vorhandenen Briefen beweist, daß er das treu und geschickt zugleich getan hat.
Ist es nun angebracht, auch aus diesen Aufzeichnungen Stellen anzuführen, Mitteilungen zu machen? Spielt sich das Familienleben, das Schulleben, das gesellige Leben in der Stadt, der Verkehr außerhalb der Stadt nicht in derselben Weise ab, wie das die Brüder festgehalten haben? Gewiß; und doch klingt manches so ganz anders und bringt auch ganz anderes, wie das, was die vier bis sechs Jahre älteren Brüder berichten. Dies erklärt sich erstens aus den besonderen Anlagen des jungen Menschen, zweitens aus den fortschreitenden Zeitverhältnissen. 1837–1841, denn aus diesen Jahren stammen seine Hefte, sind eben doch anders, als 1830–1835.
Hermann Rachel ist nach Briefen, die an ihn gerichtet sind, nach Erzählungen der Überlebenden – er starb schon 1842 als Student am Nervenfieber – ein liebenswürdiger, heiterer, schwärmerisch veranlagter, dichterisch begabter Jüngling gewesen. Wohin er kam, wer mit ihm verkehrte, Männer, Jünglinge oder Mädchen – man hatte den blonden jungen Mann, der gern gesellig lebte, der sich offen und frei gab, gar bald sehr gern. So schreibt ihm ein Mädchen, das der schon oft genannten Familie Blöde angehörte und das, wie es eine Zeitlang schien, seine Schwägerin werden sollte, nicht von Stadt zu Stadt, sondern aus ihrer Wohnung in die des jungen Mannes:
„Aber sagen Sie mir, guter Hermann, warum, wenn Sie so beredt von dem Glücke anderer sprechen, warum so wehmütig von Sich selbst? Ach! sollte ich denn glauben, daß Sie, mit Ihrem heitern, reinen Sinn und regen Geiste, nicht glücklich wären? nein, unendlich! Nun, und wenn auch vielleicht jetzt, in den noch schwärmerischen Tagen der frühen Jugend ein geheimes Weh in Ihrem Herzen ist, werden Sie nicht dann, in der schönen Zeit, wo, wie Sie schwärmen, wir Alle das Unsrige gefunden haben, werden auch Sie nicht dann in der treuen Erfüllung Ihres Berufes, in dem edeln Streben nach den unerschöpflichen Schätzen der Wissenschaft und Kunst, und endlich auch im Arme der Liebe Ihr Glück finden?! Oh gewiß, wenn Sie so bleiben, wie Sie jetzt sind, mit [158] lebhaftem Gefühl für alles Gute und Schöne, und mit heiterem frischen Geiste, dann werden Sie am ersten glücklich sein! In diesem süßen Glauben will ich heute schließen.“
Aus diesen Zeilen geht außer der freundlichen Beurteilung
des liebenswürdigen Menschen auch hervor, daß er trotz seiner
jungen Jahre und seiner heiteren Beanlagung zu trüben Gedanken,
zu allerhand Grübeleien oder, wie er selbst gern schreibt, zu
Tüfteleien neigte. Sein ganzes Wesen hatte ihm viele Freunde
erworben; wie er leicht entzündbaren Herzens für diese und für
liebliche junge Mädchen in den Familien schwärmte, mit denen
seine eigene verkehrte, so wurde er von diesen allen mit inniger
Freundschaft, mit süßer Schwärmerei aufgenommen. Nach solchen
Stunden und Tagen wollte ihm die alte gleiche Arbeit der Schule
oder später des Studiums nicht so recht schmecken. Dazu kam,
daß er als jüngster in dem Kreise, den er sich geschaffen hatte,
mehrmals erleben mußte, daß doch schließlich reifere Männer den
Mädchen nah und immer näher traten, für die er in Liedern,
auf Bällen, ländlichen Festen geschwärmt hatte. Dann kam er
sich verlassen, verlassen und unglücklich vor. Verlobungs- oder
Hochzeitstage seiner Flammen von einst wurden für ihn somit
Tage der Qual und der inneren Zerrissenheit, tiefster Unzufriedenheit.
Statt durch kraftvolle Arbeit dies abzuschütteln, versank
er dann in Unmut und Zweifel an sich selbst und geriet in unfruchtbares
Grübeln über sich selbst. Er beherzigte nicht das
Wort Goethes: Wie kann man sich selbst kennen lernen? Durch
Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche, deine
Pflicht zu tun, und du weißt gleich, was an dir ist.
Ein anderer schwerer Kampf war ihm beschieden. Seine Mutter, selbst etwas künstlerisch angelegt, denn sie zeichnete sehr hübsch, dichtete gern und hatte in ihrer Jugend viel gesungen, die Harfe gespielt, beobachtete mit Kummer den leichten, unsteten Sinn des Sohnes, sein Unvermögen, mit Geld umzugehen, und mochte oft mahnen, warnen, tadeln. Nach solchen Auseinandersetzungen über „Lebensart und Lebensklugheit“ zog er sich wohl verstimmt auf seine Stube zurück und stürzte sich mehr in Dichtungen, als in Arbeit. In solcher Stimmung las er dann zu seiner Befreiung mit Begeisterung. „Höchst reizendes Buch, [159] dieses freie, natürliche Leben des Dichters und seiner Gesellen; jeder folgt seinem Gelüste, und dem inneren Gefühl, wohin beides führt. Leichte und ansprechende Schreibart, mit liebenswürdigen Schwärmereien in Prosa und Vers ausgeschmückt.“ Man merkt bei ihm den Wunsch: „Erlaubt sei, was gefällt.“ So ist es auch erklärlich, daß er im Haushund Muffti oft seinen liebsten Vertrauten fand. Als er zu Leipzig den Tod dieses treuen Kumpans seiner jüngeren Jahre erfährt, zeichnet er auf den Rand des Tagebuchblattes einen Hügel und ein Kreuz darauf und schreibt: „Mein treuer Begleiter während einer ziemlichen Reihe von Jahren, der alte Muffti ist gestorben! Glücklicherweise hat er fast gar nicht gelitten; innerhalb 4–5 Tage hat seine Schwäche mehr und mehr zugenommen, bis er in der Nacht vom 9.–10. Juli gestorben ist. Er war eine stumme, aber treue, mitfühlende Seele, wenn er Trauer in meinem Gesicht fand! Es kamen Stunden, wo ich sein ehrliches Auge an mein Gesicht drückte und in ihm noch den einzigen, treuesten Freund zu haben mich freute! Die Erinnerung an ihn wird keiner seiner möglichen Nachfolger zu verwischen vermögen.“ Der junge Mediziner schließt diesen gefühlsseligen Erguß mit den Worten „Seinen Kopf werde ich mir präparieren und aufheben!“
Es ist wohl erklärlich, daß eine solche Natur vom Schulleben damaliger Zeit nicht sehr gepackt worden ist. Dies geht sowohl aus den ganz seltenen Mitteilungen hervor, die er von Schulerlebnissen macht, als auch aus der Art, wie er solche heranzieht. Über seine Lehrer, im Gegensatz zu seinem Bruder Julius, nicht ein Wort! Über die Stoffe, die in den Lehrstunden verhandelt werden, nicht eine Silbe! Als er als Primaner seine ersten Briefe an die Freunde in Leipzig schreibt, ruft er: „Nichts von der ledernen Schulsache! Denkt an den armen Schulfuchs!“ – Wie er sich von der Schule nichts zu holen verstand, so bringt er seine Sachen in die Schule hinein! In der französischen Stunde schreibt er heimlich an seinem Tagebuch. In einer Stunde, in der Cicero de lege Manilia gelesen wird, versucht er sich in Versen auf sein geliebtes Mädchen. Ebenso dichtet er in der Mathematik- und in der Geschichtsstunde. In diesen Gedichten sind seinem Alter entsprechend Sehnsucht in die Ferne, innige [160] Herzensliebe Hauptgegenstände. Eines beginnt wohl: Möchte gern noch heute wandern in ein weites, schönes Land! Ein anderes: In weite Höhen schwingt sich mein Herz, in finstere Tiefen versank der Schmerz! Oft sonderte er sich auf Spaziergängen der Familie ab, nahm schnell das Taschenbuch zur Hand und hielt seine innersten Empfindungen fest. So einmal, als er mit den Eltern zu Findlaters gegangen war und dann im „schönen Grund“ beim Fischhause saß; da schreibt er:
Des Tages Schwüle ist vorbei,
Die Sonne sank hinunter.
Die Phantasie wird fesselfrei,
Die Bilder werden bunter!
Ich träume hier im stillen Thal
Von Euch, Ihr meine Lieben.
Wie wär die Welt so trüb, so kahl,
Wenn Ihr mir nicht geblieben! usw.
Natürlich hat er auch zu Familiengedenktagen eine Fülle von Gelegenheitsgedichten verfaßt. So hat er auch 1839 beim sogenannten Valedictionsactus ein von ihm verfaßtes deutsches Gedicht „die Heimat“ vorgetragen. Nicht minder, wenn es Abschied zu nehmen galt von seinen Freunden. Mit gefühlsseligen Worten schildert er solch letztes Beisammensein mit lieben Freunden. Als einer von ihnen, Julius Kohlmetz, ein halbes Jahr vor ihm Dresden verläßt, da wird Hermann zum letzten Abend eingeladen, mit ihm die systematisch geordneten Andenken an herrliche Zeiten noch einmal zu mustern. Die Familie nimmt ihn traulich auf, Speise und Trank wird reichlich gespendet, so daß trotz des Trennungsschmerzes Übermut aller Art ausbricht. Nach herzinnigem Beisammensein noch langes Komitat auf Straße, Brücke, „Brühl“. „Ist die ganze Familie freundlich und zuvorkommend, so ist Julius (Kohlmetz) eine herzliche und liebende Seele. Überwältigt von aufwallenden Gefühlen sanken wir uns in die Arme und gelobten stumm, einander treu zu bleiben. Möge mir seine Liebe eben so lange erhalten bleiben wie die Oswalds[38], und nicht eher werde ich ruhen, bis selbige unter
[Bild][-] [161] einander befreundet sind. Lange verweilten wir auf dem Brühlschen Garten, bis uns der Postenwechsel des Militärs an die vierte Morgenstunde erinnerte.“
Noch wilder und leidenschaftlicher zeigt sich der Trennungsschmerz, als zwei Jahre später Hermann Rachel, selbst schon Student, denselben Freund nach fernem Land verabschiedet. Er liest ihm ein Gedicht „Lebe wohl!“ vor, hilft ihm bei allen möglichen Vorbereitungen zur Reise und bei Abschiedsbesuchen. Mit Tränen entläßt ihn nicht nur die eigne Familie, nein, auch Hermanns würdiger Vater hat Tränen im Auge. Als alle Familienbegrüßungen zu Ende, gehen die Freunde noch einmal in Engelmanns Weinstube auf der Wallstraße und zechen edeln Rheinwein unter Sang und Klang, zum großen Staunen der „philistrigen“ Umgebung. Später treten an Stelle des tobenden Gesanges trauliches Gespräch, Ergießungen des Herzens. Zuletzt schreibt jeder auf einem Zettel ein Liebeswort für sein „Ideal“. Der eine:
Ich hab dich geliebet und lieb dich noch heut
Und werde dich lieben in Ewigkeit.
Es ist das einzige Mal, daß in den Tagebüchern an Uhland erinnert wird, aber ein Zeichen, wie tief schon damals diese unvergeßlichen Verse ins Volk gedrungen waren!
Der andere schreibt:
In dunkler Dämmerstunde
Beim Sternenschein
Fleh ich von deinem Munde:
Gedenke mein!
Der Tagebuchschreiber dichtet an die Geliebte seiner Jugend, Ida Blöde, die sich nicht lange vorher mit dem Dichter Robert Pautz verlobt hatte:
Ich liebte dich, und ach, ich hing vergebens
An deiner Augen Feuergluth.
Ist auch vernichtet jetzt mein Ziel des Lebens,
Für dich zu sterben bleibt mir ewig Muth.
Und der, dem dies schwärmerische Fest galt, den bittrer Schmerz über eine „Ungetreue“ übermannte, er schrieb mit Tränen in den Augen:
[162]Dies Glas, aus dem Dein Wohl ich hab getrunken,
Es sei zerbrochen jetzt auf immer.
Dir war’s geweiht, und einer andern Lippe
Spend’ einen Tropfen es wohl nimmer.
Mein Herz, aus dem Sie Liebe hat getrunken,
Hat Sie zerbrochen auch auf immer;
Gebrochen bleibt’s und einer andern Seele
Spend’ einen Tropfen es wohl nimmer!
„Er löste sein Dichterwort und zertrümmerte das Glas an der Wand. Die arme Seele knickte wahrhaft zusammen zugleich mit dem Glas und war weich wie ein Kind. Wir fühlten bald, daß nun eine Stimmung eingetreten, welche zu dem Kneipleben nicht mehr tauglich. Wehmut hatte die Lust verscheucht: wir leerten noch einmal die Gläser. Julius zahlte und nahm noch eine Flasche Rotwein mit, und so wandelten wir hinaus zum großen Garten. Hier vor der Statue der Zeit, welche sinnbildlich in der Jugend dargestellt ist, die noch einmal schmerzlich zurückschaut, tranken wir aus einem ledernen Becher den Abschiedswein, gelobten uns durch Hand und Kuß Liebe und Treue in Not und Tod, vernichteten die Flasche und zogen heim. Früh 4 Uhr Frühstück beim lieben Freund; er tauscht mit mir die Uhr; die Stunde schlug; schmerzlicher, schwerer Abschied der Familie – Begleitung – schwere Trennung! Gott schütze Dich, treue Seele, und gebe Dir Trost, Kraft! – Heimkehr!“
Wenn ihm in seinen Leipziger Semestern solche Abschiede bevorstanden, dann eilte er zu dem Maler A. Lerpée, der damals als Porträt-, Porzellan- und Silhouettenmaler Ruf besaß, und ließ sich abbilden. Das hier beigefügte Bild und eine Silhouette von ihm auf einem Pfeifenkopf, damals ein beliebtes Geschenk, gehen gewiß darauf zurück.
Von Stammbuchblättern ist kaum mehr die Rede, ja es scheint bei ihm, wie auch bei andern bereits eine Abneigung dagegen zu bestehen. Er findet die Sitte für Schüler und Studenten als spaßhaft und schreibt: „Wer sich innig befreundet, bleibt gewiß länger verbunden durch Briefe und Mittheilungen; unter Fremden oder mit Ausländern hat es eher genügende Gründe, doch eine Silhouette ist immer besser; daran knüpfen sich bessere und wahrere Erinnerungen als an einen Vers aus [163] Klopstock, der so einseitig hingeschrieben wird“. Dagegen hält er Stammbuchblätter für angebrachter im Verkehr junger Leute verschiedenen Geschlechtes: „Hier gelten Erinnerungszeichen, und ein solches hat um so mehr Werth, da Briefe weniger vorkommen.“
Die Zeit der Stammbuchblätter beim Studenten war vorbei, die Silhouette mit herzlicher Widmung, kräftigem Erinnerungswort, eigener Unterschrift hatte gesiegt. – Nun aber, nachdem von ihm, dem liebenden und geliebten Freunde, gesprochen, zurück zu seinem Schulleben, in dem die Wurzeln solcher Herzensbünde ruhten.
Bei seinen schwärmerischen Freundschaften ist es verständlich, daß er ein einziges Mal eine Schulaufgabe für einen deutschen Prüfungsaufsatz nennt. Sonst ist weder von Aufsätzen, noch von Vorträgen, noch von Prüfungen in seinen Tagebuchblättern viel die Rede. Einmal versäumt er einen Examentag, doch entschuldigte er sich „noch glücklich“. Von seiner Reifeprüfung, den Wochen vorher, den Tagen selbst, dem Frohgefühl nachher ist nicht die Rede. Jenes einzige Thema, das er nennt, lautete: Die Schule der Tempel der Freundschaft! – Die Fassung ist so recht ein Ausklang aus der Biedermeierzeit, in der Säule und Tempelfront in Garten- und Friedhofsanlagen so gern verwendet wurden. Diese Aufgabe entsprach seiner Neigung, und so „legte ich nieder, wie sehr beglückt ich durch Freundschaft mit einer treuen Seele mich fühlte“.
Erwähnenswert ist, daß er noch über eine „erste Turnstunde“ ausdrücklich Bemerkungen macht. Unter dem 2. September 1837 bucht er: „Die erste Turnstunde der Kreuzschüler. Die legio prima wird gestellt, gemustert und der Größe nach geordnet“. Leider wird die Fortsetzung dieser für 1837 immerhin denkwürdigen Einführung einer Turnstunde für die damalige Prima nicht gegeben.
Die geringe Teilnahme an dem, was die Schule bietet, treibt ihn dagegen frühzeitig zu Vorarbeiten für sein eigentliches Studium. Die Einrichtung biologischer Kurse an den Gymnasien unserer Zeit befriedigt einigermaßen die Wünsche, die ein Gymnasiast, [164] der einst Naturwissenschaftler oder Arzt werden will, schon hegen kann. Damals bestand in Dresden noch die medizinisch-chirurgische Akademie, die den Zweck hatte, Feldscherer für das Heer auszubilden. Seit 1816 hatte sie ihren Sitz im Kurländer Palais auf dem Zeughausplatze, also wenige Schritte von Hermanns väterlichem Hause auf der Schießgasse.
Am 1. Oktober 1837 machten der junge Primaner und sein Klassengenosse Leonhardi Besuch beim Prosektor der medizinisch-chirurgischen Akademie Dr. Günther, um sich als Mitglieder seiner Vorlesung zu melden, die er halbjährig privatim über Osteologie hielt. Er scheint diese Vorlesungen regelmäßig besucht zu haben; einmal heißt es: „Früh betrieb ich eifriges Studium an meinem (!) Schädel.“ Im Februar 1838 besuchten sie den Dr. Günther, um für das Kollegium der Osteologie zu danken. „Der Doktor war höchst erfreut und nahm beider Dank und Bitten zuvorkommend auf. Sein richtiges Urteil vervollkommnete meine Ansicht über das Dresdner Akademiewesen. Initialkollegien sind mit Ausnahme von Reichenbach nicht viel wert, um so besser Choulants Pathologie und Klinik, die nach einem zweijährigen Aufenthalt in Leipzig sehr nützlich ist und sein kann.“ Bitte um fernere Unterstützung beschloß den Besuch der jungen Kreuzschüler. – Merkwürdig war, daß er, der sich aus der Schule nicht viel machte und nie auf einen seiner Lehrer zu reden kommt, dem Rektor Gröbel und seiner Familie schon als Schüler, mehr noch als Student näher trat.
Rektor Gröbel hatte seine Dienstwohnung in der alten Kreuzschule, und zwar im rechten Flügel. Es war erklärlich, daß ihm diese zum Teil recht dunkeln Gelasse in der besseren Jahreszeit nicht sonderlich gefielen. Er kaufte sich daher auf der damals ganz schmalen Albrechtsgasse, die von der äußeren Rampischen Gasse nach dem Pirnaischen Schlage führte, ein altes, aber sehr gemütliches, von Weinlaub umsponnenes Gartenvorstadthaus und legte sich einen sehr langgedehnten, nicht allzu breiten Garten an, der beinahe bis zur jetzigen Seidnitzer Straße reichte. Sowohl nahe dem Eckhause der inneren Rampischen Straße, das er später dazu kaufte, als am anderen Ende des Gartens führte ein Pförtchen hinaus auf die Gasse. Das alte [165] Haus hatte außer dem zwei Stock hohen Mittelbau noch einen einstöckigen Seitenanbau zur rechten und einen in den Garten von ihm selbst angebauten kleinen Saal, der nur ebenerdig war und besonders im Sommer einen bequemen Verkehr nach dem Garten gestattete. In diesen verschiedenen Baulichkeiten, die nach des Rektors Rücktritt vom Amte 1848 Sommer und Winter bewohnt wurden, gab es allerhand Treppen, Treppchen und Stiegen. Küche, Vorratskammern aller Art, Gastzimmer, Abstellräume, Kämmerchen waren bequem vorhanden. Der schönen großen Sommergartenstube entsprachen im Mittelbau mehrere zwar niedrige, aber geschützt gelegene Winterstuben, in denen es sich behaglich warm saß. Das Heiligtum des Hauses war das Studierzimmer des „Herrn Rektor“. Als er im Jahre 1854 starb, beschloß die Witwe, darin alles so stehen und liegen zu lassen, wie es am Tage seines Todes gewesen. Die Bücherreihen, das Schreibzeug, der Wachsstock, die Pfeifen, der Stock und die Hausmütze standen oder lagen bis zum Jahre 1869, als das Haus zur Verbreiterung und zur Erschließung der Albrechtsgasse verkauft wurde, noch wie vorher; für den Besucher war in der guten Jahreszeit aber der Garten das Herrlichste. In dem Teil nach der äußeren Rampischen (jetzt Pillnitzer) Straße zogen sich die Gemüsebeete und die ausgedehnten Anpflanzungen von Stachel- und Johannisbeeren hin. Die zu Besuch anstürmenden Kinder verwandter und befreundeter Familien fanden hier reiche Befriedigung für ihre Eßlust. Die Wege waren eingesäumt von Obstbäumen, die herrliche Früchte trugen. In der Nähe des sonnigen Hauses standen hohe ernste Bäume, unter denen lauschige Plätze angeordnet waren. Der südliche Teil des Gartens zeigte schmale, geradlinige Spaziergänge, an deren Seiten hinter Buchsbaumrabatten, wie im Baumgarten, die Blumen jeder Jahreszeit dicht nebeneinander standen. Ein von Bäumen umstandenes Rundteil schied diesen Südflügel in zwei Hälften. Auf den Rasenflächen standen allerhand Obstbäume, die Kirschen oder Eier- und blaue Pflaumen, Äpfel und Birnen trugen. An der hohen, die Albrechtsgasse entlang laufenden Mauer zog sich, von blühendem Buschwerk eingesäumt, ein schattiger Gang, ein Poetengang, bis an das Hinterpförtchen hin. Auf einem der Grasplätze [166] hatte sich ein Corneliuskirschbaum weitverzweigt. Unter ihm war eine natürlich weiß gestrichene Rundbank angelegt, zum behaglichen Sitzen einladend. Am Ende des Gartens aber war eine hochgittrige Laube, mit Pfeifenkraut bewachsen. In dem gastlichen Hause verkehrten viele Personen aus den Gelehrtenkreisen der Stadt und des Landes. War doch der Superintendent Großmann aus Grimma, wenn er zum Landtag nach Dresden kam, stets der gern gesehene verehrte Wohngast im Hause. Niemand verließ diesen Alt-Dresdner Wohnsitz, ohne Früchte oder Gartenblumen als liebenswürdiges Andenken mit nach Hause zu nehmen. Hier war es, wo Hermann Rachel so gern gesehen war. Da er sehr gesellig lebte und viele Verbindungen pflegte, kam es wohl vor, daß er statt zu rechter Abendzeit erst in der zehnten Stunde am stillen Haus die Klingel zog. Bald wurde es lebendig. Rektors Töchterlein, die ihn als liebenswürdigen und heiteren Tänzer verehrte, öffnete und rief dem Vater in das Studierzimmer hinein: „Hermann Rachel ist da!“ Der würdige Mann liebte den einstigen Schüler, den Sohn seines angesehenen Freundes, des Stadtkämmerers, sehr, zog sich den Schlafrock aus und den braunen Tuchrock an und begab sich hinunter in das Wohnzimmer, um sich an dem Gespräch des jungen Mannes und seiner jungen Töchter zu erfreuen. Eine dieser Töchter des alten Rektors, Rosalie genannt, die in späteren Jahren eine treue Freundin der Familie Julius Rachels, namentlich seiner Gattin Caroline und ihrer Kinder werden sollte – Dank sei ihr dafür! – hat ihm zwei gar schöne Andenken, so recht im Biedermeierstil gehalten, selbst bestickt: eine Vielliebchen-Brieftasche, auf einer Seite mit einem zierlichen Blumensträußlein, auf der anderen mit einem Blumenkränzchen; darin liegen noch heute vertrocknete Blumenblätter und ein Vielliebchen-Vers:
O glaub es sicherlich,
Mein Herz schlägt nur für dich!
Das andere Liebeswerk ist eine Zigarrentasche; auf einer Seite ein prächtiger Blumenstrauß, auf der anderen drei zechende Studenten, die die Bierkrügel hoch, die langen Pfeifen stramm halten! Beide Erinnerungsstücke habe ich in den Biedermeierglasschrank des Dresdner Kunstgewerbemuseums gestiftet.
[167] Wie ihn einst die Schulstunden nicht gefesselt haben, so wird er sich auch der eigentlichen Arbeit für die Schule, der pflichtmäßigen und der privaten, sehr wenig gewidmet haben. Seiner ganzen Anlage nach war er ein begeisterter Leser. Hierbei hat er wohl – es liegt dies zum Teil auch in der Zeit, kurz vor und nach 1840 – tiefer geschürft, als seine Brüder, selbst als der ältere, der erst als Rechtskandidat von der Bewegung der Zeit so recht ergriffen wurde. Hermanns Jugend fällt sowohl in die Zeit der Romantiker, als auch in die des jungen Deutschland. Lebhafter und lebhafter wurde in jener Zeit das Interesse für die Literatur des Tages. Schon als Sekundaner begann er, mächtig zu lesen. Er vertat sein Taschengeld – es war zunächst wöchentlich ein Sechser! – in der Leihbibliothek und steckte sich ab und zu deswegen noch in kleine Schulden. Viele Bücher nennt er als von ihm genossen, viele hat er gewiß gar nicht genannt oder der Bericht über sie war den Lücken zugedacht, die in seinen Aufzeichnungen sind. Einiges sei erwähnt.
Als echten deutschen Jüngling hat ihn Schillers Don Carlos, den er erst im Alter von 18 Jahren las, entzückt. Ich selbst habe ihn schon mit 12 3/4 Jahren in jener berühmt gewordenen Aufführung November 1863 gesehen, als König Johann das Zusammenspiel Bogumil Dawisons als König Philipp, Emil Devrients als Marquis Posa trotz ihrer Verfeindung befohlen hatte. Hermann Rachel fühlte sich – es war 1837 – mächtig erschüttert. „Eine neue Fundgrube für die jugendliche Phantasie! Wie viele Anklänge eigner Gefühle; wie oft glaube ich mich idealisiert wiederzufinden! Nun erwachte der heiße Wunsch, dies Stück auf der Bühne zu sehen, der auch bald befriedigt ward“ – so trägt er ein. Wie vieles muß er von Goethe gelesen haben, wenn er so beiläufig erwähnt, wie ihn Wilhelm Meister und die Wahlverwandtschaften stark beschäftigt haben und wie dies oder jenes Vorkommnis ihn an Stellen in diesen Werken erinnert. Bescheiden sagt er vom „Meister“: ich glaube, ihn zu verstehen. Später macht er sich auch an die „Novelle“ und gar an den Westöstlichen Divan. Wenn er einmal schreibt: ich versuchte, in Jean Pauls Hundsposttagen zu lesen, so wäre denkbar, daß er [168] vor dessen Weitschweifigkeit zurückgeschreckt sei. Gewaltig erschüttert ihn Kleists Prinz Friedrich von Homburg. Liebe, Tapferkeit, Zerknirschung, Läuterung und innere Erhebung klangen, es wird dies später noch erwiesen werden, in seinem Innern an. Mit einer gewissen Vorliebe dringt er in Tiecks Novellen ein; ‚der junge Tischlermeister‘ gefällt ihm besonders. Gern vergleicht er Personen, die ihm in diesem Werke entgegentreten, mit Menschen oder Vorgängen in seiner Umgebung. Wie eines Sonntags der würdige Onkel Haase sich im Kreise der jungen Leute, die im Rachelschen Hause zu Besuch sind, recht wohl fühlt und mit innigem Behagen dem Gesang eines der anwesenden Mädchen gelauscht hat, schreibt der junge Mann von ihm: „Er schilderte mir jene innige Freude, jenes stille Wohlgefühl, welches er jetzt in unserem Familienkreise fühle, da er früher in der ‚perückenartigen‘ Zeit dieses alles entbehrt, auch gar nicht vermißt habe. Dies erinnert mich an den alten Magister in ‚Tiecks jungem Tischlermeister‘.“ Er hat das Charakteristische dieser wunderlichen Figur, von Tieck sehr ergötzlich geschildert, gut erfaßt und passend verglichen. Er erinnerte sich dabei gewiß der köstlichen Szene, da der alte Magister auf seiner in die Stube geworfenen Perücke herumtrampelt und anderen Tages am Tische des Tischlermeisters Leonhard in seinem eigenen grauen Haar erscheint.
Auch in Immermanns Epigonen liest er oft und tief bis in die Nacht hinein. E. Th. A. Hoffmanns „Meister Martin und seine Gesellen“, W. Alexis’ „Shakespeare und seine Freunde“, Herloßsohns „Johannes Huß“, Leopold Schefers „Geschiedene“ seien noch genannt. Auch ihn erfaßten Gertrud Paalzows „Godwin Castle“ und Coopers Romane. Schon erscheinen Töpfers „Genfer Novellen“ und die bis in die sechziger Jahre so beliebten Familiengeschichten der schwedischen Dichterin Friederike Bremer. Neben Kalendern und Musenalmanachen versäumt er die jungen Dichter seiner Zeit nicht. Durch seine Bekanntschaft mit Robert Prutz, dem Verlobten seiner Jugendliebe, trat er Arnold Ruge näher. Die jungen Dresdner brachten bei diesem für seinen Musenalmanach ihre Gedichte an. Ruge druckte einige von Gustav Blöde ab; sie wurden in Kritiken, die in den Freundeskreisen umliefen, nicht besonders gerühmt. Tränen der [169] Rührung entlockten ihm Sands Leben und Briefe. Sand erscheint ihm darin „so rein und hehr, daß man ihn nur bedauern kann und lieben muß. Seine Briefe an die Mutter sind so schwärmerisch herrlich, die ihrigen so unendlich liebreich besorgt, nachsichtig bis zum letzten Todesmoment, sein ganzes Wesen ihr so klar, daß sie nicht einen Tadel über die Lippen bringt. – Heiße Tränen geweint –, zumal bei den letzten Briefen, da er schon gefangen in Mannheim! Solche Mutterliebe, die so unentstellt und frei von nichtigen, kleinlichen Rücksichten sich zeigt, kann den letzten Lebensmoment noch zum schönsten machen. Er bedurfte keiner Geliebten, ja fast keines Freundes – sie konnte ihm alles ersetzen, so verstand sie, in sein Wesen einzugehen!“
Seine Begeisterung fürs Lesen trieb ihn begreiflicherweise dazu, Freunden und Freundinnen Briefe oder einzelne Gedichte warm zu empfehlen. In Leipzig bildeten er und seine Freunde einen Poetischen Verein, in dem Eigengut oder fremdes Gut vorgelesen und kritisiert wurde. Nicht immer mußten es Gedichte sein; so beweist das Vorlesen eines Artikels über Emanzipation der Frauen andere Interessen. Aus der Schilderung solcher Abende geht hervor, daß sie sich Aufgaben stellten (z. B. eine Ballade), aber bald einsehen mußten, daß sich die Phantasie nicht befehlen läßt. In diesem Verein war einige Semester Mitglied Emil Rumpelt aus Dresden, der gerade damals, nachdem er schon kleinere Sachen hatte erscheinen lassen, z. B. Eduard Sternthal, eine Charakterskizze, seine Freunde damit überraschte, daß er sich exmatrikulieren ließ und unter dem Namen Emil Walther seine Bühnenlaufbahn zu Weimar begann, die er 1888 zu Dresden in ehrenvoller Weise beschloß. Wie so vielen jungen Leuten war auch Rachel das Lesen mit verteilten Rollen im Kreise frischer, junger begeisterter Mädchen hoher Genuß. In dem Hause des sehr angesehenen Leipziger Domherrn Friderici wurde er zum Lesen mit verteilten Rollen eingeladen. Die Gesellschaft beschloß, das Lustspiel Bauernfelds „Bürgerlich und Romantisch“ zu lesen. Merkwürdigerweise konnte in Leipzig zunächst nur ein Exemplar aufgetrieben werden. Hermann versprach, sein Bestes zu tun, von Dresden Exemplare zu beschaffen. Durch einen Freund gelang es ihm auch, 4 Stück Zedlitzischer [170] Almanache aus der Arnoldischen Buchhandlung zu beziehen, in denen das Schauspiel abgedruckt zu finden war. Der Leseabend gibt ihm dann Gelegenheit, die Leistungen der Teilnehmer, unter denen auch ein Leipziger Professor erscheint, eingehend zu beurteilen. Ein festliches Mahl beschloß den literarischen Abend, an dem schöne junge Mädchen ihn ganz besonders entzückten. Anerkennenswert ist es, daß er mit seinen Freunden eine Sprechstrafkasse zur Förderung reiner Aussprache unterhielt. Oft ist davon die Rede. Gesteigertes Seelenleben bereitet ihm der Besuch des Theaters. Er ist sowohl in Dresden, wie in Leipzig fleißig hineingegangen. Mehr noch als das Drama zog ihn die Oper an. Diese Genüsse packten ihn so ganz, daß er förmliche Kritiken in seine Niederschriften mit aufnahm. Die Musik, die Sängerinnen und Sänger werden eingehend besprochen. Obwohl er selbst musikalisch nicht ausübend war, erfüllte ihn Begeisterung für Musik. So erschüttert ihn die Beethovensche dritte Leonorenouvertüre ganz gewaltig. Er hörte deutsche, wie italienische Musik sehr gern und verglich die Wirkungen beider. Ebenso reizte ihn auch der Vergleich zwischen Aufführungen derselben Oper in Dresden und in Leipzig. Mit Bewunderung nennt er Tichatschek und Wilhelmine Schröder-Devrient, von deren Euryanthe er ganz entzückt ist, deren Glut und Leben in den Hugenotten ihn begeistern. In Leipzig zog ihn die Schönheit und die Anmut der Demoiselle Schlegel und die Tüchtigkeit Stürmers all. Er wird nicht müde, in seinem Tagebuch die Reize des Spiels der Schlegel in Gesicht und Körper zu rühmen. In seiner Leidenschaft für Theater tut er des Guten wohl auch zuviel. Er geht, auch wenn die Mittel durch geschickte „Kreditoperationen“ beschafft werden müssen. „Heute König Lear; ich mußte eben gehen.“
Natürlich geht es in Dresden bei guter Laune auch auf das „Bad“, um leichtere Ware zu sehen. Da erfreut er sich wohl am „Talisman“ von Nestroy. Hierbei bekommt Räder, der damals (1841) die Dresdner zu erfreuen begann, ein Lob. „Räder als Titus Feuerfuchs sehr gut; ausgezeichnete Improvisationen; seine Gestalt ist kurz, gedrungen und hat embonpoint“.
Ein günstiger Zufall fügte es, daß er in der Zeit der Einweihung des neuen Theaters in Dresden weilte. Am 15. April 1841 [171] eilte er mit lieben Freunden in den Semperbau, um Maria Stuart mit „der Bauer und Emil Devrient“ zu sehen.[39] „Wir sitzen alle zusammen und staunen ob der edeln Pracht, die in dem ganzen Bau vorwaltet. Feine Munificenz, von Armut und Überladung gleich fern! Der Hauptvorhang von Cornelius „Poesie und Liebe“ in verschiedenen Gestaltungen. Die weiblichen Figuren, mit Ausnahme der Schäferin, zu massenhaft (wohl massig gemeint?), ammenmäßig möcht ich fast sagen; das Colorit für Lampenbeleuchtung, und wenn selbige auch wahrhaft feenartig, zu matt, blaßröthlich gleichwie die hellen Gewänder. Der Vorhang der Zwischenakte gefällt mir besser, der Sammet mit Goldborte ist prächtig gemalt“. Der junge Mann ist hier schlecht unterrichtet, auch voreilig im Urteil. Der uns alten Dresdnern unvergessen bleibende Hauptvorhang im 1869 abgebrannten Hoftheater war nicht von Peter Cornelius, sondern von Julius Hübner gemalt und stellte, was er nicht verstand, gerade etwas dar, wozu der von ihm so gern gelesene Ludwig Tieck die Anregung gegeben hatte, nämlich in seiner Hauptgruppe die wichtigsten der am Schlußbild des Prologs teilnehmenden Personen im Aufzuge der „Romanze“ dieses Dichters. Es sei, da mancher „alte“ Dresdner dieses Buch lesen wird, gestattet, in Erinnerung an die Zeiten vor 70, 80 Jahren die Schlußverse dieser Dichtung einzufügen, ehe die Eindrücke des jungen Mannes, die ihm das neue Theater bereitete, weiterhin wiedergegeben werden.
Der Romanze, die hoch zu Roß sitzt, ruft der Dichterjüngling zu:
Halt an! Du wunderbares Bild? Wer bist Du,
Auf diesem weißen, königlichen Zelter?
Mit Federbüschen in dem Winde flatternd,
Die weiße Brust mit blauem Schleier schmückend,
Im Munde Lächeln, in den Augen Ernst,
Auf vollen Wangen Tränen für die Liebe?
Mir ist, ich kenne Dich, doch bist Du fremd,
Ich habe nie so Wunderherrliches,
So Liebliches gesehn, so fremde Tracht!
[172] Mehr als der poetisch, duftig anmutende Vorhang beschäftigte die Leute, und so auch den Tagebuchschreiber, die geschmackvolle Anordnung der Nebenräume. Er fährt fort in seinen Niederschriften: „Corridore, Treppen, Büffet, besonders das Foyer mit seinen Balkonen, Divans, wahrhaft reizend; belebt durch Schönheiten jedes Standes, die auf- und abwogen, gleicht es einer Pariser Bazarstraße, nur daß statt der ausgestellten Waren hier Deckengemälde zu bewundern sind. Die Ausschmückung im Innern, die Verzierungen der Logen in den einzelnen Rängen ist fast etwas zu speciell rococco, so daß man fürchten muß, es möchte bald eine Zeit kommen, wo selbiges veraltet erscheinen dürfte“. Man sieht, Sempers Wunderbau, nach den Napoleonischen Zeiten mit ihrer Einfachheit und biedermeierlichen Geradlinigkeit, das erste architektonische Kunstwerk in Dresden, wirkt auf den Studenten mächtig ein. Wenige Tage darauf geht er in Webers geliebte „Euryanthe“, in der „die Devrient“ „Glöcklein im Tale“ zu aller Entzücken singt. Erneutes, eindringliches Anstaunen des neuen Hauses und seiner Gasbeleuchtung, Blochmanns[40] Meisterwerk, wie er bewundernd schreibt. Es macht seinem musikalischen Geschmack Ehre, daß er in der dritten Vorstellung, die er 6 Tage später besucht, Bellinis Puritaner lange nicht so ergreifend findet wie Webers Euryanthe. „Etwas französische Effektszenen darinnen aufgehäuft“.
In jene Tage fiel auch ein Fackelzug, dem anwesenden Cornelius zu Ehren. In einer für die Dresdner Künstler nicht sehr schmeichelhaften Weise kritisiert er diese Feier also: „Musik vor dem Hotel de Russie. Kein Leben, kein Geist. Still hingegangen und wieder weg, wie Gamaschenkerle; die Musik schweigt unterwegs ganz, die Fackeln teilweise in Röhrtrögen ausgelöscht. Halt fehlte dieser Geschichte!“ Einem Fackelzuge, der in demselben Jahre 1841 Felix Mendelssohn bei seiner Übersiedlung nach Berlin in Leipzig, und zwar in Lurgensteins Garten gebracht wurde, wohnte der junge Mann mit Begeisterung selbst bei.
[173] Seine künstlerischen Neigungen trieben ihn auch dazu, Bilder zu betrachten und sich über sie Rechenschaft zu geben. Schon als Kreuzschüler war er bei Arnold am Altmarkt so eingeführt gewesen, daß er sich neu ausliegende Kupferstiche in den Geschäftsräumen betrachten durfte. In Leipzig besuchte er den Kunstverein und schilderte mit einer gewissen Begeisterung, was er gesehen; so einmal das Rathaus von Löwen! Die Freunde untereinander beschreiben sich in ihren Briefen, was sie an schönen Bildern betrachtet; er macht sich von diesen Notizen wieder Abschriften in sein Tagebuch.
Nach all dem Vorstehenden läge der Schluß nahe, daß ihn sein medizinisches Studium nicht allzu sehr gepackt habe. Es macht dann und wann diesen Eindruck, aber allmählich wachsen die Einträge darüber, vertiefen sich die Bemerkungen. Als er im Frühjahr 1840 das menschliche Auge studiert, dann geht es ihm wie seinem Freunde Hermann Reinhard.[41] Er schreibt: „Je mehr sich mir frühere Rätsel entwirren und zur Aufklärung kommen, um so anziehender und interessanter wird das anhaltende Büffeln. Ich erinnere mich an Hermann Reinhards Brief, worin er mir seine Begeisterung schildert, als die Naturwunder nach und nach vor seinen Blicken heller werden und klarer erscheinen.“
Zwei Interessen traten dagegen ganz zurück: das kirchliche und das politische Leben. Nur an den Karfreitagen vermerkt er, daß er, wie üblich, mit der Familie zur Kirche gegangen sei; von irgendeinem Geistlichen, dessen Predigten er etwa gern gehört hätte, ist nie die Rede. Nur von einem längeren Besuche in der katholischen Hofkirche spricht er einmal. Als Gymnasiast geht er hinein, „ennuyiert“ sich über die müßigen Pflastertreter, welche gierig nach den Frauen herumlugen. Er hört Musik und Predigt, an einen Pfeiler gelehnt. Die Predigt ist gut, aber die komische Sprache, der seltsame Vortrag macht das Anhören unleidlich. Schließlich hört er nichts mehr, gibt vielmehr seinen Gedanken Audienz. In Leipzig ist er dann und wann einem Kommilitonen zu Gefallen in dessen Seminarpredigt gegangen.
[174] Von Politik kein Wort. Es ist wahr, in die Jahre, da er Tagebuch schrieb, fiel in Dresden nichts dem vergleichbar vor, was die älteren Brüder schon mit Verstand erlebt hatten. Die Verfassungserteilung war vorüber, man hatte sich nach dem großen Umschwung von 1830 und 1831 in die neuen Verhältnisse eingelebt; unter dem in seinen ersten Regierungsjahren sehr beliebten König Friedrich August II. war in politischer und konfessioneller Beziehung Vertrauen statt des früheren Mißtrauens eingetreten. Der scheinbar große Umschwung, der 1840 in Preußen gekommen war, berührte den jungen Mann gar nicht. Von einem anderen Staate des deutschen Bundes, als von Sachsen, von dem Begriff „Deutschland“ ist überhaupt in allen seinen Niederschriften nicht die Rede. Selbst das gespannte Verhältnis zu Frankreich 1840, während dessen Nicolaus Beckers Lied „Sie sollen ihn nicht haben“ große Beliebtheit errang, wird nicht erwähnt. Nur einmal spricht er davon, daß er Lieder dieses Dichters in einem Almanach gelesen hat.
Zwei Vorgänge wirtschaftlicher Natur, einer von größerer lokaler Bedeutung, der andere von Wichtigkeit für Dresden und Leipzig, von vielleicht noch nicht so richtig geahnter Tragweite für die großen Weltverhältnisse, werden von ihm gebucht. Es sind dies die Eröffnung der ersten großen Aktienbierbrauerei in Dresden, in Sachsen, ja vielleicht in Deutschland, des Waldschlößchens, und die Eröffnung der Bahnfahrten zwischen Leipzig und Dresden, sowie zwischen Leipzig und Magdeburg. Die Gründung der Sozietätsbrauerei Waldschlößchen hat für den jungen Mann und seine Familie insofern eine Bedeutung, als der Vater mit dem bekannten Obersteuerprokurator Eisenstuck, mit dem Ältesten der Handelsinnung L. H. Dietrich, mit dem Bankier C. F. Rosencrantz, mit G. B. Schwenke, einem Kaufmann, der zur Hebung Dresdens damals die verschiedensten Projekte entworfen und zu fördern versucht hat, z. B. eine Bank in Dresden, und anderen hervorragenden Bürgern der Stadt den Plan zur Bildung dieser Aktien-Gesellschaft im August 1836 dem Publikum vorgetragen hat.
Interessant sind vielleicht in unsrer Zeit die Gründe, die diese Männer für ihr Unternehmen angegeben haben. Der Prospekt [175] sagt: Unter allen Bedürfnissen, die dem Deutschen unentbehrlich sind, steht nächst dem Brote ein Trunk guten Bieres unzweifelhaft obenan. Seit Jahrhunderten ist es das eigentümliche deutsche Getränk, ganz für das Klima und die übrige Eigentümlichkeit des Deutschen geeignet. Aber nicht nur in physischer Hinsicht, sondern auch in moralischer Hinsicht ist es als Gegenwirkung gegen den zunehmenden Gebrauch gebrannter Wässer wichtig. Legt man diesen Vorteil in die Wage, so ist unstreitig ein gutes wohlfeiles Bier als das erste Lebensbedürfnis des Volkes zu erkennen. In Sachsen ist man in diesem Zweige der Produktion noch sehr zurück. Enorme Summen gehen alljährlich für fremde Biere ins Ausland; nach Bayern allein jährlich 1/2 Million Taler. Dabei ist dies Bier durch Transport so teuer, daß nur der Wohlhabende es genießen kann. Aber große Mittel sind nötig, es hier zu bereiten, wo es ebenso hergestellt werden kann wie dort. Wenn viele zusammentreten, ist es leicht möglich. Deshalb: 800 Aktien zu je 500 Tlr. zeichnen!
Zugleich wurde beschlossen, daß Stadtrat Rachel mit dem künftigen Brauereiinspektor, dem Ökonomieverwalter Edlich, nach Bayern reisen solle, um nicht nur die „dasigen“ größeren Brauereien in Augenschein zu nehmen, sondern auch einen tüchtigen und ausgezeichneten Brauer zu gewinnen. Rachel selbst schlug vor, daß Nürnberg, Regensburg und München besucht werden sollten. In gedrängter Kürze hat er am 20. Dezember 1836 der Generalversammlung über die in Gemeinschaft mit Edlich, dem Baumeister Kluge und dem Inspektor Blochmann unternommene Reise Vortrag gehalten. In den Akten der Sozietätsbrauerei Waldschlößchen, die ich freundlicherweise einsehen durfte, ist nichts Schriftliches darüber zu finden gewesen, wohl aber teilt er seiner Frau in einem Briefe aus München mit, welchen bedeutenden Eindruck die große Brauerei von Pschorr auf ihn gemacht habe. Dieser Name, in Mittel- und Norddeutschland damals kaum bekannt, jetzt ein Name von Weltruf, tauchte dabei für die Dresdner zum ersten Male auf. Aus dem Briefe geht, wie zu erwarten, hervor, daß er sehr viel gesehen und für seine Zwecke sehr viel gelernt habe. Nach seiner Rückkehr führte er die Verhandlungen über den Ankauf der [176] für den Betrieb der Brauerei geeigneten Grundstücke. Der Hofküchenschreiber August Scheppach verkaufte 1837 das ehemals Gräflich Marcolinische Vorwerk an der Bautzner Straße an den die Sozietätsbrauerei vertretenden Stadtrat Rachel.
Klugerweise wurden die Aktien statt auf 500 Tlr. auf 100 Tlr. gesetzt. Der Erfolg war günstig. Die Brauerei, in deren Administration Rachel, der Großkaufmann G. H. Ch. Jordan[42] und der Amtsinspektor Portius gewählt wurden, konnte schon am 26. März 1838 ihren Ausschank beginnen. Dieser Tag rief in Dresden und in anderen Städten große Aufregung hervor. Das Publikum drängte sich an dem Eröffnungstage und in der Folgezeit, neugierig und dafür eingenommen, in großen Scharen dazu. Trotz rauher Witterung wurden, wie Taggesell im Tagebuche eines Dresdner Bürgers notiert, am 26. März 5675 Krügel ausgeschenkt. Beim Ausräumen fand man allerhand Hutkrempen, Krawattenschleifen, Hutfutter und Mützenblenden. „Das war ein vergnügter Tag für die Dresdner Biertrinker“, schließt der Bericht des alten Bürgersmannes. Die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Gründung, die an sich Dresden ja vielen Vorteil gebracht hat, erkennt noch 1865 Gustav Klemm in seinen Culturgeschichtlichen Briefen „Vor fünfzig Jahren“ an.[43] Der Schnaps sei bei dem Volk dadurch einigermaßen aus der Mode gebracht worden. Doch auch ihm fällt, wie jedem ruhigen Beurteiler, dabei das Sprichwort ein: es heiße auch hier, daß ein Teufel mit dem anderen vertrieben worden sei!
In den ersten Wochen verkehrte auch der junge Gymnasiast, denn das war 1838 der junge Rachel noch, viel mit studentischen Freunden auf dem neuen „Brauhaus“. Seine Schilderungen der dort sich breit machenden Gesellschaft sind aber nichts weniger als günstig. Er ist erstaunt, wie sich auch die „Weiber“ herzudrängen und am neuen Ort vom neuen Tranke kosten. Die mitanwesenden Männer helfen sich mit Witzen etwa von der [177] Sorte: „Ja, heute haben unsere Frauen nicht gekocht, und morgen wollen sie wärmen“. Vor diesem Philistergerede ziehen sich die Musensöhne bald zurück.
Im Leben der Familie gewann das Nebenamt des Vaters insofern eine Bedeutung, als er regelmäßig zu Sitzungen nach dem Waldschlößchen ging oder fuhr. Oft nahm er dabei die Seinen mit, auch sonst lud er wohl Sonntags Verwandte und Freunde nach der Wirtschaft zum Mittagessen ein, und alle erfreuten sich des Zusammenseins und der berühmten herrlichen Aussicht von der „Waldschlößchenterrasse“. In guten Jahren stiegen seine Einnahmen, doch das blieb noch längere Zeit recht schwankend. Auch fehlte es, wenn Bericht und Generalversammlung kam, nicht an Ärger. Groß war der Schreck, als am 7. März 1857 die Brauerei zum großen Teile abbrannte.
Sehr wichtig erschien dem jungen Mann 1839 die Eröffnung der Leipzig-Dresdner Eisenbahn, an der ja sein Bruder mit gebaut hatte. Man macht sich in unseren Zeiten keinen Begriff von der Begeisterung, die damals bei den Einsichtigen, und von den Bedenken, die bei den Ängstlichen herrschte, als das große Werk nach und nach dem Publikum zur Benutzung übergeben wurde. Der Tunnel von Oberau ist 513 m lang. In einer kleinen Schrift zu Ehren der Linieneröffnung, genannt „Erster Flug (so!) von Leipzig nach Dresden und wieder zurück auf Fittichen des Dampfes“ heißt es von ihm:[44]
Und nun – der Tunnel – Preis und Ehre
Den Meistern, die durch Grabesnacht,
Mit Gnomenvolk im Hauptverkehre,[45]
Dies Riesenwerk zu Stand gebracht!
Erhellt vom schönsten Lampenscheine,
Die man auf Tausende anschlug,
Erlaubt es unserm Weihvereine
Durch sich hindurch den Schwalbenflug.
Im April 1839 ward die erste Vollfahrt von Leipzig nach Dresden unternommen. Der Rat und die Stadtverordneten gaben den von Leipzig Zugereisten ein Festmahl in den Räumen der Harmonie. In dem Festgedicht, das die Gastgeber den Gästen widmeten, [178] kommt, wie einst bei der berühmten Hirsebreifahrt der Zürcher nach Straßburg auf dem glückhaften Schiff, die Freude zum Ausdruck, daß man sich doch so nahe, so nahe gekommen! Da heißt es:
Wir sind erstaunt – ein Raum hielt uns geschieden
Vor wenig Stunden nur,
Durch welchen einst zwei Tage lang in Frieden
Die gelbe Kutsche fuhr.
Die Fahrt von Leipzig nach Dresden hat 4 1/2, die von Dresden nach Leipzig „nur“ 4 Stunden gedauert. Ein Vierteljahr nach der Eröffnungsfahrt entschlossen sich die Leipziger Studenten zu einer Extrafahrt nach Dresden. Da ich von diesem Unternehmen anderweit ausführlichere Angaben nicht gefunden, füge ich den Bericht des Studenten Hermann Rachel darüber ein: „Donnerstag den 5. July. Wir eilen nach dem Markt, treffen Ecks (Spitzname der Brüder Hermann und Oswald Reinhard) und mit ihnen nach dem Bahnhof. Jubel und Halloh der Studios selbst. Gedränge und Masse der Zuschauer, deren Erstaunen und Beifall. Die Wagen sind gefüllt, und aller Studio verpackt; wir haben uns einen hübschen Stehplatz ausgesucht und übersehen den ganzen gräulichen und fast schwärzlichen Zug, dessen Inhalt jauchzend, jubelnd, singend Abschied nahm, die der Bahn nahe Stehenden begrüßte und das Schwenken der Hüte, Wehen der Tücher erwiderte. Überall wurden wir von Menschen erwartet, fröhlich bewillkommnet, oft auch sprachlos angestaunt. Fürchterlicher Tumult auf den einzelnen Kneipen, wo angehalten wurde, besonders in Oberau. Mit dem Schauplatz, mit den Umgebungen ändert sich auch die Stimmung und die Ausgelassenheit der Freunde. Begrüßung der Berge, Elbe und der schönen Stadt! Freudiges Erstaunen, das sich allmählich in ein stummes, ruhiges Entzücken des Einzelnen verwandelt. Herrliches Wetter; Einzug in den Bahnhof, wo eine kuriose Masse Dresdner uns mit Jubel begrüßt und empfängt. Erwiderung mit großem Halloh. Ordnen des Haufens; Arm in Arm, rauchend und mit Gaudeamus igitur rückten wir gassenbreit herein. Blödens schauen heraus. Überall tritt die Wache ins Gewehr und läßt uns frank und frei passieren. Wir ziehen auf den Neumarkt, schließen dort einen großen Kreis und beginnen wiederum die Studenten-Marseillaise [179] (d. h. Gaudeamus), welche auf der Brücke abgebrochen wurde. Entlassung nach allen vier Weltgegenden. Fröhliche Begrüßung von Freunden, heiteres Mittagsmahl zu Hause. Dann eilen wir zum Waldschlößchen und finden schon die ganze Rotte niedergelassen und fröhlich zechend. Mannigfacher Noth und Bedrängniß abzuhelfen; ich eile, schaffe und ruhe. Allgemeiner Gesang so viel als möglich hergestellt; der Mangel des allgemeinen Zusammenhaltens und eines gewählten Seniors tritt schmerzlich hervor. Die Couleuren absondieren sich und treten fast feindlich den Finken gegenüber, indem sie gegen die Bürger sich schmählich über die Finken auslassen und einen Stand schmähen, dem sie selbst angehören. Wothos (?) Festigkeit bricht ihre Anmaßung bei Gelegenheit der Vivats, die allerdings zuletzt ausarteten. Eisenstuck begrüßt uns und wird mit allgemeinem Beifall empfangen. Ich meines Theils erwiderte die Begrüßung der Künstler durch passende Antwort. Aufbruch. Zug nach Stadt Leipzig.“ Hier bricht der Bericht ab.
Wenige Wochen später, am 23. Juli, unternahm der Sächsische Hof eine Fahrt von Dresden nach Leipzig und wieder zurück an einem Tage. Zum Schutze des Publikums und der Grundbesitzer war ein großes Truppen- und Polizeiaufgebot aufgewendet worden. Ein ironischer Berichterstatter[46] erzählt davon: Der alten Prinzessin Auguste sei doch einmal bang geworden, als der Wagen so ein bischen „geschweppert“ habe.
Der junge Mann hat übrigens, als Gast durch seine Eltern eingeführt, der Einweihungsfahrt für die Strecke Magdeburg-Leipzig beigewohnt. Nicht die Fahrt ist es, die ihn hierbei fesselt, sondern die Stadt, und er hat mit innerster Teilnahme den alten, ehrwürdigen Dom betrachtet, mit lebhafter Erinnerung die geschichtliche Bedeutung der Stadt genossen, namentlich aber mit offenem Sinn die Einrichtungen gesehen, die dort für den Handel und den Verkehr getroffen waren. Von allem am und im Dom begeistert ihn natürlich „das Grabmal eines Bischofs in vollem Ornat“. Es ist dies der wundervolle Sarkophag des [180] Erzbischofs Ernst, eines Wettiners, im Jahre 1495 von Peter Vischer gegossen. Wie das Innere des Gebäudes, so entzückt ihn auch die Aussicht auf Stadt und Umgebung vom Turme. Bei der Besichtigung der Verkehrseinrichtungen, die ihm in Gesellschaft Dresdner Stadträte (sein Vater und Stadtrat Axt), sowie des Obersteuerprokurators Eisenstuck auf einer Gondel geboten wird, bewundert er die gesamten Anlagen, die ihm denen seiner Vaterstadt natürlich stark überlegen vorkamen. „Ein wahrer Mastenwald von Schiffen und Plätze zum Schiffsbau beleben die Ansicht. Hier stiegen wir in eine Gondel, um aufwärts bei den Strandgebäuden und Dampfschiffen vorüberzufahren. Unser Kahn war größer, höher gebordet als die derartigen in Dresden. Selbst das Fahren war schon ein anderes: der Schiffsmann in seemännischer Tracht mit wollner Zipfelmütze oder breitgekrämptem Hut stand im Hintertheil, stakte wenig, sondern war mehr mit dem Steuerruder beschäftigt, das lose schwankte. Der letzte, aber schönste Genuß: die Stadt mit ihrem Leben und Treiben, den Thürmen und Festungsmauern, links Rückblick nach Brücke, Insel und Schifferwesen, der Strom selbst durch Dampfer, größere und kleinere Fahrzeuge belebt, bis er sich hinaus in die weite Ferne dehnte, wo nur Wasser und Himmel war, alles Übrige verschwand – mitten hin zog sich eine Kette von Feuern auf den Schiffen, die mir zuletzt als rothe Punkte erschienen und gleichsam in der Abendröthe verschwammen. Heiße Sehnsucht nach der See!“
So hatte dieser kurze Aufenthalt in Magdeburg nicht nur vielerlei Anregung in Kunst, Geschichte und Verkehr geboten, nein, es zog ihn „in die Ferne gar mächtig hinaus!“
Ehe wir aber den jungen Mann als „Wanderer“ durch sein liebes Sachsenland oder im benachbarten Böhmen begleiten, seien noch einige Erlebnisse geschildert, die auf die damaligen Verhältnisse in Dresden oder auf ihn und seinen Charakter helle Lichter werfen.
Der friedlich-gemütliche Zustand unseres lieben Dresden spiegelt sich in der unter dem 22. März 1838 kurz hingeworfenen Bemerkung: „im Schlafrock und mit brennender Cigarre abends auf der Brücke umhergeschlendert, um den Eisaufbruch der Elbe [181] zu sehen“. Am 14. Oktober 1837 notiert er: „zum ersten Male die Mode befolgt und ein Halseisen umgelegt“, womit er wohl hohen Halskragen oder besonders hohe Halsbinde meint. In demselben Jahre wird er mit den Seinigen in eine befreundete Familie eingeladen. „Alle saßen erwartungsvoll am Tisch, die Butter kreischte in der Pfanne, alles knackte, prasselte und zischte, und alsbald kam eine Schüssel voll Lerchen hinein.“
Sein vieles Lesen, das mit sehr kleiner Schrift geführte Tagebuch, die zahlreichen Briefe, die er verfaßte, sein Nachschreiben in der Schule und die schlechte Beleuchtung jener Tage zwangen ihn frühzeitig zum Brillenkauf. „Entschuldige“, schreibt er einmal, „entschuldige mein Geschreibsel, das künstliche und doch schlechte Kerzenlicht will meinen Augen nicht behagen.“
Die Verkehrsverhältnisse jener Zeit beleuchtet ein längeres Geschreib über ein ihm von den Leipziger Freunden in Aussicht gestelltes Paket. Er fragt mehrere Male, und zunächst vergeblich, auf der Post nach und klagt über ihre Saumseligkeit. Wenn er als Student während der Ferien in Dresden war, konnte er den Unterschied zwischen der Universitätsstadt und der Residenzstadt nicht immer festhalten. Nach fröhlich durchtanztem Harmonieball, nach lustiger Nachfeier in „einer Tabagie“ geht es mit den Freunden früh 4 Uhr in der Dreikönigsnacht nach Hause. Der studentische Übermut bricht sich Bahn in allerhand Tänzen und in Theaterspiel auf Markt und Gassen. Nicht ohne Grund bekam er in dieser Zeit von „den alten Herren und Damen“ in der Familie und in den befreundeten Familien den Spitznamen „der Windflügel“. Aber dieser Windflügel war schnell bei der Hand, wenn eine außerordentlich schnelle Tat zu gutem Zwecke nötig war. Am Abend des 7. April bummelt er mit einem Freund über die Brücke und erblickt in einem Pfeilerrundteil Haufen von Menschen stehen: eine Katze sitzt auf den Pfeilerstufen und miaut kläglich um Hilfe. Advokat Hoffmann, Mitglied des Tierquälervereins, wie Rachel scherzhaft bemerkt, – es ist also ein alter Witz – will Hilfe schaffen. „Wir sagten ihm, daß wir uns entschlossen hätten, hinzufahren und den Rettungsversuch auszuführen. Bei reichbesetztem Zuschauercollegio abgefahren, mit größter Anstemmung in den Bogen stromaufwärts [182] eingefahren; wir gewinnen ‚Land‘ und alsbald die Katze. Viel Witz darüber!“ Ein andermal ward er der Retter eines Menschenlebens. Unter dem 4. Oktober 1838 schreibt er mit dem Vermerk „abcopiert aus der Brieftasche“ etwas in sein Tagebuch, was er nach dem fürchterlichen Geschehnis mit „fliegendem Stift“ festgehalten hat: „Merkwürdige Stimmung! Habe ich schon Gutes gethan? Vielleicht mehr oder weniger durch Nebengründe bewogen. Heute ist der reichste Tag meines Lebens. Meinen schwachen Kräften war es bestimmt, einem Menschen das Leben zu retten. Ich bin die Ursache, daß sie nicht sündig vor Gottes Richterstuhl getreten, nicht schuldig: eigenmächtig in Gottes Wirken eingegriffen zu haben. Sie hat nun Zeit zur Reue! Fürchterlicher hat mich noch kein Ton berührt, als das bewußtlose Winseln und Heulen von ihr, welches über den Strom herüberhallte; es durchdrang mich ein Schauern und Zittern, und doch mußte ich kräftig handeln! Ich sprang in den Kahn, ruderte mit anderer Hilfe hinüber, zog sie heraus, unbekümmert, ob die Wassermasse, welche durch das Hinausbeugen und Umlegen des Kahns sich hob, uns selbst wegschaffen könnte. Belohnender Augenblick, als meine Hand, die gerade auf der Brust lag, um sie zu halten, das Herz pulsieren fühlte! Etwas Bewußtseyn des Gethanen erfüllte mich, als ich vor den Wachtkommandanten hintrat und um eine Stube zur Aufnahme bat. – Sie dankte auf eine unvergeßliche Art, als ich hinwegging und sie sicher wußte! Heute ward der gute Wille zur guten That. Ihr Bild (er meint das der Jugendgeliebten Ida Blöde) verließ mich nie, es stärkte mich! Muffti war mein treuester Genosse.“ Erklärlich, daß er in den wenigen Lebensjahren, die ihm noch beschieden waren, an jedem 4. Oktober dieser seiner entschlossenen Tat gern gedachte! Wer es war, die er gerettet, warum sie in Verzweiflung so gehandelt, hat er seinem Tagebuche nicht anvertraut.
Eine höchst sonderbare Sache ist es, daß er 1841 im Monat Mai zugleich mit etlichen Freunden bei einer Somnambule verkehrt; es war dies die Frau des Mechanikers Joh. Christ. Kachler, die auf der Schäferstraße 31 wohnte. Fast täglich geht er hinaus, obwohl sein Vater ihn verhöhnt und ihm offen sagt, er halte das für Torheit. Nach einem der Besuche bricht zwischen [183] ihm und seinen auch dort gewesenen Bekannten ein lebhaftes Streiten und „Debattieren“ aus. Einmal trifft er dort übrigens sehr angesehene Männer der Stadt an: Hofrat Künzel, Bankier Scholz, Dr. Wippler. In einem Zirkel, der sich in Cagiorgis Wirtschaft zusammenfindet, wird lange und eifrig über diese Frau gestritten. Daß er die Sache zunächst sehr ernst genommen hat, geht aus dem häufigen Besuch bei der Frau hervor. Was sie ihm und seinen Kameraden gesagt, wie sie sich überhaupt aufgeführt und wieso er dann doch abgebrochen hat, erfahren wir nicht von ihm; er bemerkt nur kurz, daß ihn das von ihr Offenbarte „betroffen“ habe. Da er später nie wieder darauf zurückkommt und sie nicht weiter besucht hat, scheint er bald klug geworden zu sein. Die Neigung zu solchen „Fragen an das Schicksal“ hatte ihn auch schon in Leipzig gepackt. Am 11. Februar 1841 besuchte er dort mit drei Freunden die „Wahrsagerin“ Frau Voigt. Sie fanden sie im „Roten Kolleg“ in einer fürchterlichen Spelunke; doch ließ sie sich nicht bewegen, ihr Geschäft zu vollführen. Sie leugnete, aus Furcht, weil sie, vier Mann aufgepflanzt, in die kleine Stube hineingestürmt waren.
Und nun zum „Wanderer“ in ihm! Die Heide, damals von den Dresdnern noch nicht so häufig aufgesucht, hat er auf ihren Schneisen oft durchschweift. Er war ihr näher gekommen dadurch, daß der Vater die Gepflogenheit hatte, den Vogelherd hinter dem Waldschlößchen zu besuchen. Wie er so mit seinen für die Heide begeisterten Freunden durch Waldschneisen aller Art schweift, erinnert ihn dies an das eben von ihm gelesene Buch „der Dichter und seine Gesellen“; er verwebt Dichtung und Wahrheit und sieht in jedem der Mitwanderer und in sich selbst eine der Novellenfiguren. Zuletzt kommen sie auf dem „letzten Heller“ heraus. Die Terrasse auf der dazu gehörigen Bergkuppe, welche wirklich eine herrliche Umsicht gewährt, begeistert alle. „Röthlich glänzte das Laub an den Bäumen von den letzten Strahlen der Sonne getroffen, als wir heimkehrten“.
Zu dieser Liebhaberei für die Heide trug wohl auch der immer inniger werdende Verkehr zwischen den Familien Stadtrat Rachel und Hofsekretär Grohmann bei. Sowohl der Vater wie der Sohn Paul Grohmann, Advokat in Dresden, später [184] Gerichtsrat in Eibenstock und Mittweida, waren eifrige Heidewanderer.[47] In der Familie Grohmann erwuchs dem einstigen Kreuzschüler Julius, jetzt Rechtskandidat, Hermanns Bruder, die auch von diesem in manchem Gedicht sehr verehrte Braut, Caroline Grohmann, ein schönes, vielumworbenes Mädchen, das durch ihr fröhliches, heiteres, aber auch leicht erregbares Wesen die Zusammenkünfte der Familien belebte.
Gern verkehrte auch er nach dem Plauenschen Grunde zu, besonders, als im Frühsommer 1841 Frau verw. Stadtgerichtsrat Reinhard, mit deren Söhnen Hermann und Oswald, wie schon erwähnt, der junge Mann sehr befreundet war und mit deren Tochter Emma er in seiner jugendlichen Begeisterung nach Ida Blödes Verlobung ein mehr als schwesterliches Verhältnis anstrebte, einige Zeit dort zur Erholung wohnte.
Folgen wir der jungen Gesellschaft in das damals so beliebte, wegen seiner vom Fabrikrauch noch nicht zerstörten Naturschönheiten berühmte Tal.
Er verbringt die Nacht auf dem in der Nähe der Kirche und der Pfarre gelegenen Gutshofe; am anderen Morgen – es ist ein schöner Maitag – gehen die jungen Leute hinauf aufs „Kanapee“, lagern sich am Abhang der Felsen[48] und frühstücken vergnüglich, dann geht es hinab und quer durchs Tal, und wieder hinauf an steiler Wand nach einem sich herabziehenden Grasplatz in der Nähe von Coschütz. Nachdem sie lange im Freien gelagert, steigen sie wieder hinab und klettern im Bett der Weißeritz über „natürliche Steinbauten und spitzige Klippen“. Zurückgekehrt genießen er und der Freund Oswald ein „Luftbad“ – merkwürdig genug diese Bezeichnung in einem Tagebuche von 1841!
Am Nachmittag aber wandern sie ein zweites Mal hinauf aufs „Kanapee“. „Noch einmal schlürfe ich diese Lust in vollen Zügen; gilt es doch lange Zeit davon zu leben auf der schönen [185] flachen Leipziger Ebene! Herrlicher Wechsel der Beleuchtung und der Schattierungen! Das üppige Grün, das noch die lebensfrische Farbe besitzt, die dunklen Felsenwände, reichlich mit Nelken geschmückt, ziehen das Auge immer von neuem an“. Als sie – eine zahlreiche Gesellschaft von Verwandten und Freunden ist auf das „Sommerlogis“ zu Besuch gekommen – im Forsthaus essen, sehen die jungen Männer von der Felsenhöhe, welche unmittelbar an der Gartenmauer sich erhebt, ein Wesen herabstürzen. Geschrei, hinlaufen, den Jungen, der das Unglück erleidet, aufheben und an die Wassertreppe beim Forellenbecken (damals am Forsthaus noch im Gebrauch!) hinauftragen – war das Werk weniger Augenblicke! Schnell wird der Knabe, der Sohn eines Dresdner Beamten, untersucht, Verletzungen im Gesicht und am Körper, sowie der gutartige Bruch eines Vorderarmes festgestellt. Nach vorläufiger Schienung wird er sofort in einem Wagen nach Dresden gebracht. Hermann Rachel besucht den „armen Jungen“ am anderen Tag in der Wohnung – auf seinem Gange zur Somnambule!
Weiter hinweg führte ihn im September 1838 eine „Gebirgsreise“ mit seinen Reinhardischen Freunden. Stürmisch eilten sie zum Dohnaischen Schlage hinaus durch Strehlen, Torna und Nickern. Angesichts der auf dem anderen Ufer der Elbe liegenden „Weinberge“ tranken sie eine ihnen gestiftete Flasche Wein viel zu schnell, so daß sie froh waren, als sie Maxen erreicht hatten, um sich wieder zu kräftigen. Bei Mondenschein staunten sie noch die Kalkbrüche an, ergötzten sich des Nachts an den Künsten des Nachtwächters loci als Sänger und Instrumentalist. Am anderen Tage gelangten sie durch Grund und über Höhen nach Glashütte und schmausten im Gasthof zum „goldnen Glas“. Dabei verbrachen sie ein ulkiges Gedicht an die Bürger Glashüttes und legten das Blatt in den Tischkasten. Hierauf wanderten sie lustig und tüchtig rauchend weiter durchs Städtchen. Da versuchte es das „nützliche Organ der Glashütter Polizeipräfektur durch Donnerworte uns zur Ruhe und Demut zu zwingen und kündigte uns laut und vernehmlich an: ‚Hier sei das Rauchen schrecklich verboten‘. Lachend wanderten wir weiter und dankten dem frommen Mitglied der Glashütter Bürgerschaft [186] für den reichlichen Stoff zur Unterhaltung“. Nach heißer Wanderung kamen sie über Bärenstein nach Altenberg. Hier galt es, den Bergbau kennen zu lernen. Es sei gestattet, kurz wiederzugeben, was damals, abgesehen von der bekannten Pinge, noch Interessantes zu sehen war. „Wir betreten den unteren Göpel, wo uns eine alte Bergmannsseele die nötige Erläuterung gab. Er fördert Zwittergestein, das mit Quarz und Chlorit in Granit eingeschlossen ist, in gewöhnlich hohen Tonnen aus einer Tiefe von 8 / 9 Fuß mittelst Drahtseilen hinauf. Sie sind im vorigen Jahre angeschafft, drehen sich um Räder von 6 Ellen Durchmesser, die wiederum durch ein 16 elliges Brems-, dieses durch ein Wasserrad (20 Ellen) oberschlächtiger Art in Bewegung gesetzt wird. Letzteres war ein doppeltes, indem das aus den umliegenden Bergteichen kommende Wasser, durch Schützen bald auf jenes geleitet, die Kübel hinaufwindet. Wir stiegen nun bis zum Maschinenbetrieb hinunter, dem ein Bergmann mit der obersten Leitung vorstand; das Übrige versparten wir bis zum Morgen.“ Dann sahen sie sich noch die bekannte Pinge an; darauf bestiegen sie den Geising, sahen Dresdens Türme, das Waldschlößchen und die herrliche Rebhügelkette. Nach kurzem Verweilen auf Humboldts Ruhesitz, wobei ein paar Verse an „Sie“ ins Taschenbuch geschrieben wurden, ging es, mit allerhand Gestein und Pflanzen beladen, ins verehrliche Städtchen zurück. Vom Apotheker hörten sie noch, daß er die meisten Drogen von Schönebeck bei Magdeburg beziehe. „Hierauf Thé ohne dansant.“ Am anderen Morgen begaben sie sich, in Bergmannsgewänder gesteckt, vom Obersteiger Trautmann geführt, von dem unteren Göpel nach dem unteren Gestock. Es bestand aus sechs einzelnen Gestöcken und enthielt Bruch- und Schieborte. Dann krochen sie durch sich verzweigende Stollen an ‚Ort‘. „Hier gewinnen nach Sprengen und Feuersetzen einzelne Häuer vermöge des Meisels das Gestein, was dann auf Karren und Hunden hervorgefördert wird. An den sogenannten ,Schieborten‘ welche meist unter der Pinge gelegen sind, wird es durch eine lange Stange gewonnen, welche der Häuer in die Kluft hinaufstößt und im Kreis herumdreht – bald rollt Gestein in großen Massen nach und oft in solchen mächtigen Stücken, daß [187] der Häuer durch Zerhauen derselben Luft machen muß. Wir wanderten von diesen ‚Gängen‘ nach ausgefeuerten und ausgebeuteten Stellen, welche großartige Gewölbe und domartige Höhlen bilden, ‚Weitungen‘ genannt; sie haben eine Höhe von 20–40, einen Durchmesser von 3 Lachtern; als Stützen dienen mächtige Gebirgspfeiler von zinnarmem Gestein. Teils waren die Gänge und Stollen bloß elliptisch ausgefeuert, andere durch Kappen und Stöcke gestützt und mit Bruchsteinen ausgefüttert; der Druck auf die querliegenden Kappen und vermittelst deren auf die aufrechtstehenden Thürstöcke ist so groß und macht so häufige Ausbesserungen nöthig, daß jährlich zwischen 13–1400 Stämme dazu verwendet werden müssen, welche die der Gewerkschaft angehörenden Waldungen liefern. Ein ergreifender Anblick, theils Wehmuth, theils Wünsche erregend, diesen Regionen anzugehören, war ein ziemlich rüstiger Bergmannsgreis, der als Häuer an seinem einsamen Orte saß und beim matten Schein der trüben Lampe und gekrümmter Gestalt gewaltige Blöcke zu zertrümmern sich bestrebte. Freundlich unterrichtete er uns über sein Geschäft und einsames Tagewerk.“
Als er dies in sein Buch niedergeschrieben, fügte er die Verse hinzu:
„Wo nie der süße Morgen dämmert,
Tief in des Berges finsterm Schacht,
Da sitzet er und pocht und hämmert
In schwarzberußter Knappentracht.
Zu ihm hinab – kein Klang der Glocken,
Kein Lerchenwirbel, Blumenduft!
Doch andre Blumen sieht er locken
Rothblühend Zinn in dunkler Gruft!“
Es folgen nun genaue Angaben über die Gewinnung des in Porphyr oder Chlorit eingesprengten Zinnes durch die Steiger in Seigertrögen. „Nach der Menge des Gehaltigen wird das Zwittergestein: Sechser, Groschen und Zweigroschen genannt; die letzte Klasse liefert 4–5 Zentner, die Groschen 3 Zentner Zinn vom Schock Fuhre; die Sechser-Klasse ist zu arm zur Benutzung. – Wir wanderten durch ungeheure Weitungen, welche von früher gesprengt und zwar in zu großer Ausdehnung, so daß sie jetzt bei dem angewandten Holzersparungssystem nicht weiter bebaut [188] werden können. Doch dem Beschauer gewähren sie einen köstlichen Anblick; die Täuschung, daß man sich in einem Dome befinde, der, obschon durch tausende von Lichtern erhellt, doch in den einzelnen entfernten Partien immer mit Dunkel bedeckt ist, macht einen bleibenden Eindruck, und lange noch sieht man das ausgewölbte Gebäude vor seinen Augen stehen, in dem vorderhand nur feuchte Wände die glänzende und strahlende Beleuchtung als Wiederschein der spärlichen Grubenlichter erzeugen. Die angefahrenen Zwitter werden untermengt mit Quarz, damit sich die verschiedenen Gangarten ‚gettieren‘ und im Feuer später nicht mit reduciert werden. So wird ein mittelmäßig ausgiebiger ,Schliech‘ erhalten. Das Gestein wird theils zerschlagen, theils mürbe gebrannt und dann zerkleinert, um sie unter den Pochstempeln zu zerpulvern. Die Wasser führt das Pochwerk fort, welches sich in den Gräben nach Verschiedenheit der ,Gröbe‘ absetzt; das zuletzt abfließende Wasser darf keine Schliechtheile mehr führen; dieses abgelagerte Mehl wird dann theils auf Stoßheerden, theils auf Kehrheerden verwaschen. Reiner kann es durch solche Prozesse des Waschens nicht erhalten werden, da sonst zu großer Verlust entstehen würde. Um die fremden metallischen Einmengungen zu beseitigen, folgt jetzt das Rösten, wodurch einestheils Arsenik und Schwefel verbrannt und verflüchtigt (in Giftfängen die arsenige Säure aufgehalten), anderntheils das Eisen in Oxyd verwandelt und dadurch spezifisch leichter wird als Zinnerz und beim nochmaligen Waschen fortgeführt werden kann. Das nunmehr gewonnene Zinnerz wird über Krummöfen oder Halbhochöfen geschmolzen. In dem Vortiegel läuft die Schlacke gesondert durch die Schlackengasse ab. Auf kupfernen geschliffenen Platten (Schicht genannt) wird die geschmolzene Masse ausgekellt und erstarrt, dann in 10–11 Pfund schweren dünnen Tafeln zusammengerollt und mit hölzernen Hämmern zusammengeschlagen. Nach 12 Stunden ist das Durchsetzen einer Schmelzpost beendet, wobei 50 % Zinnerz gewonnen werden, jedoch mit Zuschlag der Nacharbeit mit den Schlacken und Schliechabgängen. Da das hier fallende Zinn weniger rein, wird es vor dem Gießen noch geläutert: das sind ‚Peuschen‘ – abschüssige Lehmheerde, deren Sohle nach der Mitte zu geneigt [189] sind und die am tiefsten Punkte einen Stichheerd haben. Auf den glühenden Kohlen, welche hier ausgebreitet sind, wird das Zinn ausgeschüttet, das feinere läuft bald durch die Kohlen und sammelt sich im Stichheerd. Dies wird bis zur völligen Reinheit wiederholt und dann die gereinigte Masse erst in Tafeln gegossen. – Dies der Bericht über den ganzen Prozeß. Nachdem wir länger herumgebummelt, fuhren wir wieder herauf, hart an dem Wassergestänge und Saugwerk vorbei. Feiner Regen sprühte uns ins Gesicht, und Getös und Rauschen, mit welchem es herauf und herabarbeitete, verhinderte jedwedes Sprechen. Das Kunstgezeug selbst ist ziemlich groß und weitmächtig.“ Auf diese lange und sorgfältige Ausarbeitung folgen im Tagebuche weiße Blätter, die einst noch beschrieben werden sollten, doch es ist unterblieben. Aus einer kurzen Notiz geht nur hervor, daß die junge Gesellschaft von Altenberg nach Frauenstein gewandert ist. Zweierlei mochte ihn dorthin gezogen haben: es war der Geburtsort seines Vaters, der, wie schon erwähnt, als Sohn des Stadtapothekers am 15. Februar 1783 daselbst geboren war und noch verschiedene Verwandte dort oben besaß, und dann konnte er die Trümmer des alten Schlosses Frauenstein bewundern, von dem im väterlichen Hause ein in Kork zierlich geschnitztes Bild an der Wand hing.
Ein halbes Jahr später machte der Mulus Hermann Rachel mit seinen Reinhard-Freunden eine längere Fahrt ins Böhmenland. Am 24. April 1839 wurden alle auf ihrer Wanderung über Pirna, Königstein nach Schandau durch und durch naß, so daß sie des Abends malerisch gruppiert um das Feuer im Gasthof zur Sächsischen Schweiz saßen und sich trocknen mußten. Am andern Tage ging es nach Schmilka über halbgefrorenen Schnee, so daß er sich einer Skifahrt entsinnt, von der er in Thorsteins „Vier Norwegern“ gelesen, hinauf auf den Winterberg. Der kalte Wind trieb sie vom Aussichtsgerüst in das Häuschen. Herrliche Blicke bot ihnen dann die Höhenwanderung – der beinahe zwanzigjährige Dresdner kam zum ersten Male dahin! – nach dem Prebischtor.
„Nach Sachsen zu war die Aussicht hell und freundlich, ein Sonnenblick belebte die Gegend bis Königstein; dahinter aber [190] war’s dunkel und grau. Den Kontrast dazu gewährten Böhmens Gebirge. Wild und romantisch bedeckten dunkle Wälder die Bergkuppen, welche sich ebenso finster in Thäler verliefen. Blaue Rauchsäulen stiegen an vielen Orten auf und gaben dem Ganzen einen eigenthümlichen Anstrich der Wildheit. Fast glaubte man, in dem Thüringer Wald auf einer großen Anhöhe zu stehen und die reichen weithinziehenden Wälder zu überblicken“. Durch engen Grund an Brettmühlen vorbei ging es nach ‚Herniskretschen‘ und weiter durchs Elbtal bis nach Tetschen. Mit einer gewissen Scheu gingen sie an den Mauthäusern am Strome vorbei, die durch Elbkähne geschützt waren, auf denen sie Kanonen stehen sahen. Ihnen geschah aber nichts. In Tetschen sahen sie sich noch eine Tonfabrik an. Am dritten Tage führte sie die Elbwanderung über Ronstock, dann am Ziegenberg vorbei, und endlich erblickten sie den Marienberg mit seiner Kapelle und erfreuten sich schon im Geiste der freundlichen Aufnahme, die ihnen in einer Aussiger Familie, gut bekannt mit Reinhards, bevorstand.
Mit großer Liebenswürdigkeit wurden die Dresdner Gäste mehrere Tage beherbergt. Sie durchwanderten die Stadt und bewunderten in der Stadtkirche das Madonnenbild. „Welche Ruhe, welche himmlische Klarheit in ihren Zügen; mit Demuth ist das Auge heruntergeschlagen; Schmerz lagert sich auf ihrem Angesicht, aber ein Schmerz, der mit Ruhe und mildem Frieden gepaart ist“. Dies Bild begeisterte ihn so, daß er in sein Taschenbuch ein Gedicht darauf entwarf, das sein Gefühl widerspiegelt und nicht ohne sprachliche Gewandtheit ist. Dann wurde der Schreckenstein besucht und sein romantischer Schimmer mit Entzücken genossen. Oder sie bestiegen den Marienberg, dessen Heiligenfigur eins der Mädchen – die Familie war wohl katholisch – bekränzt hatte, lagerten sich im Grase und blickten hinab ins Tal; dann kletterten sie „wie Gemsjäger“ an den Abhängen hinab und hinauf, umspielt und umwedelt von dem Familienhunde, Davoust genannt! Aber diese und andere Naturfreuden treten im Tagebuch zurück gegenüber einem Herzenserlebnis eines der mitwandernden Freunde. Dieser hatte ein inniges Empfinden für eine der Haustöchter gehabt; in jüngeren Jahren waren sie einander näher getreten. Jetzt verlangten wohl [191] die Eltern vernünftige Trennung von dem jugendlichen Geliebten. Ein Aussiger bewarb sich um das schöne Mädchen, und so widerwärtig er natürlich den Dresdner Freunden erschien, er sollte ihr Gatte werden. Das Mädchen versicherte durch den Schreiber des Tagebuches den, den sie verlassen sollte, noch einmal ihrer treuen Gesinnung und ließ ihm ein Stammbuchblatt überreichen, auf dem er sich aussprechen durfte. Wie heftig diese jungen Geister und Herzen ergriffen waren, das zeigen die Worte, die der Vermittler kurz vor dem letzten Abschied eintrug. „Ich bog mich um die Ecke und näherte mich dem Fenster, welches auf den Hofraum hinausgeht; da stand Sie auf den Fenstervorsprung gestützt, die Augen halb geschlossen und die Hände zum Gebet gefaltet. Heiße Thränen rieselten mir über die Wangen, ich betete mit, ob für Sie, ob für ihn, für mich und für alle, daß Gott ihnen dieses Leid erleichtern, allen Lieben aber ersparen möge – das weiß ich nicht; genug, ich that es. Ich trat hinaus, näherte mich ihr, bat, ruhig und mit Gottvertrauen jetzt zu tragen und das Zukünftige zu erwarten. Ihre erste Frage war nach ihm, was er mache, was er gesagt habe, wie er es ertrage. Ich beruhigte sie. ‚Liebster Rachel, ich habe Ihnen mein ganzes Herz eröffnet mit großem Vertrauen, Sie sind dessen würdig; ich fühle es, wie tief Sie bewegt werden; mein Leid ängstigt mich nicht, auch nicht mein nächstes Leben, nur er, sein Trübsinn und sein Schmerz steigert meine Angst zur Qual; ich habe viel geduldet, am meisten, wie ich meine Neigung zu unterdrücken strebte; das Widerwärtige meiner Verhältnisse, die nur selten abwechselnd glücklichen Stunden – alles ist’s nicht, was mich jetzt foltert, nur der Gedanke an sein Unglück. Bitte, erfüllen Sie mir meine Bitte, ihn zu erheitern, ihn nie zu verlassen. Sagen Sie ihm, er bleibe ewig in meinem Innern, was er mir gewesen, er solle und müsse aber ruhig sein – um meinetwillen. Gehen Sie jetzt, bitte!‘ Ich wankte mehr hinein, als daß ich ging“. Die Mädchen begleiteten nun die Jünglinge auf ihrem Wege nach Teplitz hinaus vor die Stadt; an einer Heiligensäule nahmen sie Abschied – lange blickten sie noch einander nach.
Von Aussig führte sie der Weg nach Teplitz. Ihm blieb davon nur eine schöne Viertelstunde in dauernder Erinnerung, [192] als er mit den drei Brüdern Reinhard eng umschlungen auf dem Vorsprung des Schloßberges stand und sehnsüchtig mit ihnen nach der Aussiger Gegend ausschaute, sie aber, die Brüder Hermann, Oswald und Otto, sich in heiliger Stunde gestanden, daß sie alle drei einst das teuere Mädchen im Herzen getragen, daß aber zwei zu Gunsten des einen Bruders auf sie, die nun auch diesem verloren war, verzichtet hätten.
Wie er diese sentimentalische Reise, zu dem ihm der Vater 4 Taler gestiftet hatte, beendigt hat, ist nicht vermerkt; daß aber das Herzensverhältnis des Freundes mit dem ihm so teueren Aussiger Mädchen nicht nur „sentimentalisch“ zerfloß, sondern bei ihr sich auf ernstlichem Grunde entwickelt hatte, beweist die Schreckenskunde in späteren Aufzeichnungen Hermanns, daß sie noch im selben Jahre von schwerer Gehirnentzündung ergriffen wurde, von der sie nur langsam genas. In ihren Phantasien hatte sie – charakteristisch für die Zeit – oft Schillersche Gedichte sich selbst laut vorgesprochen: Das Ideal und das Leben (jetzt wohl selten gelesen und gelernt!), Des Mädchens Klage und ,Fridolin‘.
Der Herbst des ersten Studienjahres brachte dem jungen Mediziner einen heitereren Ausflug nach Spaar bei Meißen auf den Weinberg der Blödeschen Familienfreundin Demoiselle Vetter.
Zur Weinlesezeit versammelte sie gern junge Verwandte bei sich. Die leider auch abgebrochene Schilderung zeigt harmlos heiteres Wesen auf dem für die Stadt Meißen so wichtigen Granitgebirge. Am 19. Oktober sollte die lustige Reise mit der Leipzig-Dresdner Eisenbahn bis Oberau angetreten und dann zu Fuß vollendet werden. Auf dem Wege zum Bahnhof aber trafen sie den edlen Meißner Botenwagen und „sintemal und alldieweil der Marsch von Oberau nach der ,Spar‘ auch nicht zu den besten Wegen zu rechnen, ließen wir uns in diesem Ruhesitz nieder. Die Genossen drin werden amüsant, wenigstens den Humor, der in mir sitzt, anregend. Ein Vieh- und Getreidehändler, mit großem Vielwissen begabt, aber von wenig Muth beseelt, denn der Dampfwagen war seinem Sinne zu gefährlich – ein in sich hinein gekrümmter Beamter, ein graues, grießgrämiges Männchen mit verseßnen Hosen, von gleichem Muthe [193] beseelt, wie sein Nachbar – eine schwarzbraune junge Dresdnerin, welche von Meißen nach Lommatzsch zu Fuße reisen mußte, um eine geringe Erbschaft zu erheben, mit einigen Schachteln und einem gefüllten Kober versehen, dem sie dann und wann ein kleines Träubchen entnahm – ein bedachter Schulmeister aus der Meißner Pflege, höchst höflich und ein umständlicher Zuhörer; dazu kam später noch ein fideles altes Haus mit grauen Haaren, der an Munterkeit alle anderen übertraf. Die junge Schöne reichte uns hilfreiche Hand mit einer Haarnadel, als uns ein Instrument zum Reinigen der Pfeifen fehlte. Wir kamen an; bald stiegen wir den Bergpfad hinan, schlichen uns durch die Pforte, warfen die Sachen ab und traten unverhofft ein.“ Er trifft die Familie Blöde und eine „reiche“ Gesellschaft. Besonders wird sie belebt durch die Familie des „Generals“[49] der auf einem Nachbarweinberg mit Frau und interessanten Töchtern haust. „Er, ein ältlicher Mann, mit militärischem Anstand, dessen Kleidung und Wesen aber auch auf den Jäger schließen läßt; freundlicher, biederer Charakter, der tiefere Studien, als gewöhnlich, getrieben hat. Madame, bequem, herzlich und liebevoll im Umgang, so daß man sich bald in ihrer Nähe wohlfühlt. Kunigunde, vulgo Gundel, eine untersetzte volle Gestalt, Gemisch des väterlichen und mütterlichen Charakters, geistig aber still, häuslich und einfach; Luitgard, schlanke, lebendige Gestalt, deren Wesen ebenso unruhig wie ihre Augen.
Das Fräulein ist ein schönes Kind,
Sie hat so muntre Augen.
Die Augen so verliebet sind,
Zu sonst sie gar nichts taugen.
Luise, blühendes, liebliches Wesen von 16–17 Jahren, schneeigen Teint auf Gesicht und rosigem Nacken, gleich scharf an Geist als in Liebe; sie liebt vor allem das Feine, das nur Noble.“
Heitere Stunden verbringt er mit den Freunden, mit den Mädchen. Gemütliches Schlendern durch die Berggassen des Spargebirges; nach dem Abendbrot ein „romantischer“ Spaziergang auf die Bosel. „Herrlicher Abend – alles lag vom bleichen Licht des Mondes überzogen in einer geisterhaften Ruhe; kalt und still fluthete im Thale der Strom und spiegelte im herrlichen [194] Glanz des Mondes Strahlen zurück. Die fernen Gegenden lagen in dicken Nebel gehüllt und verliefen sich in graue, formlose Massen. Das Kleine und Unbedeutende verschwand, nur die mächtigen Berge, der Strom, ruhig blinkende Lichter im Dorfe traten im blassen Schein hervor. Alle lagerten sich auf die umhergeworfenen Steinblöcke und überließen sich kurze Zeit dem mächtigen Eindruck. Wahrlich eine romantische Gruppe! Luitgarde saß wie Loreley auf der hervorragenden Klippe und blickte schwindellos in die steile Tiefe, die Übrigen bildeten einen Halbkreis um sie herum.
Mich grüßte Alles wieder,
In stiller Mondesnacht!
Lange dauerte die Ruhe nicht, Gesang befreite allen die Brust von trüben Gedanken, und ein altes Lied „Steh ich in dunkler Mitternacht“ nahm alle ernsten Gefühle auf, und die hin- und herfliegenden Klänge führten sie fort auf schnellen Flügeln. Stumm und still saß ich neben ihr; ein kalter Stein zog nur eine dünne Scheidewand; es war das Bild meines Lebens; zogen auch gleiche Gefühle uns zu einander hin, nur geistig durften sie uns verbinden, kalt trat Welt und Schicksal zwischen uns und zog seine Schranke.
Kennst du noch die irren Lieder
Aus der alten schönen Zeit?
Sie erwachen alle wieder
Jetzt auf Bergeseinsamkeit!
Wilde tobende Lust trat an die Stelle des vorigen Sinnens und Brütens. Es wurde getanzt. Sie kam auf mich los und walzte in weiter Runde mit mir herum; in verzweifelter Lust umfaßte ich den theueren Leib und hörte nicht auf, uns herumzudrehen, bis Sie ermüdet in meinem Arme hing. Es wurde abgebrochen. – Gute Nacht!“
Am anderen Morgen eine herrliche herbstliche Frühwanderung nach Meißen; der Korb einer hausierenden Frau wird dort umflattert und mitten auf der Straße ein lustiger „Kuchenknipp“ gehalten. Auf dem Rückweg hilft der flotte Student auf der Bergstraße einem alten Winzer seinen schweren Karren nach Oberspar hinaufschleifen. Zum Dank erhält er eine schöne Traube, von der er aber nur wenige Beeren nascht.
[195] Am Nachmittag, nachdem er in der wärmenden Sonne, an einen Weinpfahl gelehnt, in der Griseldis gelesen, geht es nach der Birkenruhe. Wieder lagerte man sich fröhlich, plauderte und neckte sich untereinander. Nach dem Abendessen wurde, um es noch romantischer als am Tage vorher zu gestalten, ein Aufzug der deutschen Götter unter Anführung Rübezahls nach der römischen Bosel unternommen. „Geisterhafte Gestalten mit Strohbündeln versammeln sich im Hofe, ziehen den finsteren Weg dahin; allgemeiner Fackeltanz mit den lieblich verhüllten Hexeleins, wobey Geistersang ertönt. Zuletzt Rückzug ohne Ordnung und „Uniform“, jedes trägt sein Bündel unter dem Arm, nur Busso [ein schöner junger Leutnant, Neffe des Generals, von allen verwöhnt] heuchelt in seinem Pelze und mit seiner Jagdtasche noch Gottheit.“
Der folgende Tag bringt einen Gang durch den Weinberg; sie sammeln Früchte, schneiden Trauben und wandern mit gefülltem Korbe nach der „Grotte“. „Trotz der feuchten Kälte bleiben wir, eng aneinander geschmiegt, plaudernd sitzen. Erzählungen aus der Jugend; Erinnerung gaukelt durch die Jahre der hellen, heitern Kindheit, wobei ich leider schon damals, gerade wie jetzt, den inneren Frieden vermissen muß. Liebesfragen, die ich offen beantworte, wodurch ich alle Ruhe verliere.
Mein Herz ward schwer!
Ich weiß um wen!“
Da kommt die Nachricht, Idas Verlobter, Robert Prutz, werde eintreffen. Demoiselle Vetter, die gemütliche Gastgeberin, wird spitzig und hält eine tüchtige ‚Winzerpredigt.‘ In das einfache Haus, wo die jungen Leute wohnten, könne sie den Doktor nicht geben; deren Genügsamkeit und Liebe, die den Mangel alles Luxus gern entschuldigte, kenne sie; aber der Doktor, der Doktor! Ins Gynäkeion – das eigentliche Weinbergshaus, in dem nur die Frauen wohnten – dürfe er auf keinen Fall, also werde sie ihn in dem Gasthof einquartieren!
Hier ist es vielleicht an der Zeit, über des Tagebuchschreibers Freundschaft mit Robert Prutz zu sprechen. Das Verhältnis zu ihm war nicht leicht, denn Prutz, einige Jahre älter als er, war, nachdem er Philologie studiert hatte, nahe daran, sich als Privatdozent zu habilitieren.
[196] Im Sommer 1839, also wenige Monate vor der Meißner Fahrt, war Ida Blöde, Hermanns Jugendschwärmerei, nach Halle zu Besuch bei Arnold Ruges gereist. Prutz lernte das schöne, lebhafte Mädchen kennen und huldigte ihr, widmete ihr manches Gedicht. Freudig schrieb sie dem Jugendfreund, daß ihr hier beschieden sei, was ihr in der Heimat versagt sei. Man schätze sie, man gehe in freier, heiterer Weise mit ihr um; alles Kleinliche verschwinde. Treuherzig schreibt der junge Mann in sein Tagebuch: „Sie fühlt sich frei von allem, was in Dresden drückend auf ihr lag und sie beengte. Sie hat Raum, findet Anklang bei ihrer Umgebung und entwickelt ungefährdet ihre reine und edle Individualität. Prutz versteht Sie am meisten und weiß ihren Werth vollkommen zu schätzen, was auch Sie fühlt und lobend, ja liebend anerkennt. Was sie innig gewünscht, wornach sie sich von jeher gesehnt: ein geistiges, poetisches, freies und herzliches Leben, ist ihr dort gewährt. Ich erinnerte mich heute an jene glücklichen Stunden, wenn wir allein miteinander verweilten und traulich schwatzend, eines dem andern seine Träume und Schwärmereien erzählte und sich dessen entledigte, was das Herz drückte. Da mir es einmal bestimmt ist, einen eigenen Weg und eben wegen seiner Eigentümlichkeit diesen allein zu gehen, möge Gott ihr dort ein liebendes Herz, das ihrer würdig und sie zu würdigen weiß, zuführen. Der Brief läßt schon vieles ahnen und hoffen; vielleicht gelingt es Ihm! Zu Haus sind wahrlich wenige bestimmt, so glücklich zu seyn, Sie zu verstehen, Ihre Herzlichkeit zu fühlen und Sie zu lieben und eben deshalb ihrer werth zu seyn. Träume sind Schäume. Doch ehe ich Sie unglücklich oder einst allein und von einem Herzen ungeliebt wissen möchte, wollte ich ihr lieber meine unbedeutende Persönlichkeit als Lebensgefährten und Freund gönnen. Ist ihr Name doch ein Klang, mit dem ich alles umfasse, was mir jemals Edles, Schönes, Liebenswürdiges erschienen ist. Bis zwei Uhr morgens Briefe geschrieben, worunter der an sie als Begrüßung zum 7. Juli (ihr Geburtstag) der theuerste und wärmste. Hatte mir doch ihr ebenso geist- wie gemütvoller, mit Wärme und Herzlichkeit geschriebener Brief einen so herrlichen Genuß bereitet.“
Er gedachte gewiß der Lieder, die er zu ihren Geburtstagsfesten oder zu anderen Gelegenheiten wohl mehr für sich als für [197] sie gedichtet. Eines zeigt, wie er schon als Primaner in sich gekämpft. Am 7. Juli 1838 abends 3/4 12 Uhr, als er vom Geburtstagsfeste nach Hause gekehrt war, schrieb der 18 jährige noch „in tiefer Nacht“:
Noch fühl ich lau der Sprache Athemwehen,
Noch seh ich dich im weißen Lichtglanz stehen,
Wie du der Schwester durch des Kusses Banden
Geschwisterlieb’ und -treue zugestanden!
Du fühltest nicht, was ich bei diesem Kuß gelitten,
Wie stark Vernunft und Herz im Innern stritten
Und jedes sich in Gründen überbot?
„Du Thörichter, was wagst du zu verlangen?
Was hilft es dir, den Träumen nachzuhangen,
Die wieder dir die kühle Tagesluft verweht?
Glaubst du, was dir die Phantasie in Träumen zugesteht,
Das müßte dir das kalte Leben bieten?
So leicht erringst du nicht den innern Frieden.“
Doch milde und verführerische Worte
Erklingen sanft mir aus des Herzens Pforte,
Versöhnen mich mit deinem Wiegen-Tag....
Hier bricht das Lied ab. Im Sommer 1839, genau ein Jahr später, sollte ihn die Nachricht treffen, daß sie für ihm immer verloren sei. Es ergriff ihn denn doch gewaltig. Er schreibt in Leipzig: „Es öffnete sich am heißen Tag die Thür; ‚einen Dreier, Herr Rachel‘ spricht Herr Cichorius, der Briefträger. – Aus Halle – von Ihr! Freudig gehe ich zum Fenster zurück, öffne den Brief und will die Schilderung Ihres freudigen Herzens mit heiterer Laune im Angesicht des heiteren Himmels genießen. Der Brief war kurz, aber des Lesens war kein Ende. Starr durchlief ich immer wieder die wenigen Zeilen; starr und stumm hielt ich ihn in den Händen – bis ich endlich erwachte und laut hervorbrach. Mußte ich mir’s doch endlich gestehen, daß es wahr sey, daß Ich ich sey und Sie den Brief geschrieben; warum? Um mir feierlichst zu melden, daß Sie verlobt sey seit dem 9. Juli 1839 mittags. Ich fühlte nun meinen Verlust und die grausige Öde, welche mich nun umgäbe und in mir selbst wäre. Bald löste sich der starre Schmerz, ich dankte Gott, daß Er Ihren Wunsch erfüllt, Ihre Sehnsucht befriedigt, daß Sie nun ein Herz besitze, welches Sie liebe und verstehe und welches Sie auch für das ganze Leben offen als das Ihrige verehren könne. [198] 2 Uhr 35 Minuten erfuhr ich’s – Gott sey ewig Dank! von Ihr selbst, und nicht von dritter, vierter Hand oder durch Karte, Zeitung! Nur eins schmerzte mich noch: Sie schrieb mir: ‚Ihre Zeit erlaube es nun nicht, fernerhin meine Briefe zu beantworten, wie bis jetzt. Sie könne daher mir selbst nicht zumuthen, auch noch an Sie zu schreiben.‘ Ich fühlte zwar, daß Sie es wahrlich nicht so gemeint hätte, als man aus und nach den Worten folgern könnte, aber dennoch hinterließen diese Worte einen bittern Stachel des Schmerzes.“
Bald eilte er zu den lieben Freunden Reinhard, holte mit ihnen auf dem Rückweg zur eignen Wohnung Wein und Zutat. Damit und mit Tagebuch und Briefen ging es zurück zu den Freunden. Bei gefüllten Gläsern lasen sie in diesen Urkunden der Freude, die nun dahin war! „Ihr, Ihm und Ihrem Heile wurden Becher geweiht. Stumm bat ich vom Himmel um Segen für Sie, um Ruhe für mich. Das letzte Glas und dessen letzter Tropfen galt eines jeden Lieb! galt Ihr! Der Heimweg wurde mir schwer; nun war ich des Gefühles, des Gedankens, der Erinnerung an uns für Sie beraubt, welches jedem Tag ein Interesse, einen heimlichen Reiz verliehen.“
Und ebenso schwer mußte es ihm sein, als dann Robert Prutz in Dresden erschien und in der Familie verkehrte, in der der junge Mann so manche schöne, hoffnungsvolle Zeit verbracht hatte. Als er merkte, daß der Gelehrte und Dichter von einzelnen Familienmitgliedern beinahe abgelehnt, fast wie ein Fremder behandelt wurde, so nahm er sich seiner und der Braut in ritterlichster Weise an. Wie dankte sie ihm dies, ihm, dem früheren Vertrauten und Freunde ihrer Mädchenjahre! Glücklich schreibt er voll süßer Erinnerung in sein geliebtes Tagebuch: „Diese wenigen Worte von Ihr, dieselbe Herzensgüte, das Vertrauen, wie früher, gegen mich war wohlthuender, beruhigender und geistig erwärmender als zehntausend allgemeine Trostphrasen von gleichgültigen Leuten.“
In den folgenden Zeiten traten Hermann und Prutz einander näher. Gewiß hat der Dichter Prutz den jungen Mann für sich gewonnen. Als er einst in Leipzig von ihm auf der Straße angerufen wurde, begrüßten sie einander freudigst mit Hand und Mund. Daß die Ehe zwischen den beiden ihm befreundeten [199] Personen manche dunkle Wolken werde aufsteigen sehen, ahnte er. Prutz war oft melancholisch, von den Zeitinteressen nur zu gewaltig hingerissen. Dunkel mochten alle Näherstehenden bei der freiheitlichen, oft wohl stürmisch sich äußernden Gesinnung des Dichters Schlimmes ahnen. In Halle und in Dresden hatte sich Prutz an Arnold Ruge und Echtermeyer angeschlossen, die in den Hallischen Jahrbüchern kein Hehl aus ihren fortschrittlichen Gesinnungen machten.
Im Mai 1841 hatte Prutz seine Hochzeit gefeiert, und zwar in Tharandt, still und ohne Gäste. Dresdner Freunde waren an jenem Tage, mehr zufällig als geplant, an der Tharandter Kirche vorübergeschritten. Sie hören Gesang und bemerken Hochzeitsfeierlichkeiten. Die Kirchtüre öffnet sich und heraus tritt – Dr. Prutz mit seiner jungen Frau.
Letzter großer Schmerz des jungen Studentenherzens! Hübsch, wie er sich faßt und schreibt: „Bedarf Sie je eines Freundes, sollte je das Glück sich von Ihr abwenden – dann nehme ich die langgetragene Farbe wieder hervor, obschon gebleicht, und der letzte Vers aus dem Gedicht des alten preußischen Offiziers wird zur Wahrheit!“
Unter Gedichtabschriften, die seinen Papieren neben eignen Entwürfen zahlreich beiliegen, ist dies Gedicht „Lebewohl“ genannt. Es ist ein Lied, das Entsagung atmet.
Leb wohl! – Noch einmal blickt’ ich nach dem Sterne,
Der meinem Dasein kurzen Glanz verliehn,
Jetzt laß mich in des Lebens öde Ferne
Ein Wandrer ohne Weg und Hoffnung ziehn.
Hell leuchten dir der Jugend bunte Kerzen,
Die Freude schwing den Kranz um deine Brust,
Dein bleicher Freund steht mit gebrochnem Herzen
Und lächelt still von fern zu deinen Scherzen,
Doch nie trübt sein Erscheinen deine Lust.
Nur wenn, wie selbst des Tempels Säulen wanken,
Vielleicht auch dir das Unglück Wunden schlägt
Und einen Freund du suchst, der in die Schranken
Für dich mit Mut und Lust sein Leben trägt,
Nur dann noch denk an mich und gönn umwunden
Von deiner Farbe mir den blut’gen Strauß,
Und ein Cypressenkranz, von deiner Hand gebunden,
Versöhnt vielleicht doch meine letzten Stunden
Noch schön mit dem entzweiten Leben aus.
[200] Da Hermann Rachel schon ein Jahr nach der Hochzeit Prutzens gestorben ist, hat er keine Gelegenheit gehabt, irgendwie oder -wann ritterlich für die Jugendflamme einzutreten. Daß ers, wenns nötig gewesen wäre, getan hätte, wird eine später zu berichtende ritterliche Tat des jungen Mannes als wahrscheinlich hinstellen. Ida Blödes Los war kein leichtes; denn 1843 wurde Prutz aus Jena, wohin er geheiratet hatte, ausgewiesen, da er sich in einem Gedicht kühn und frei zu dem damals politisch verdächtigen Historiker Dahlmann bekannt hatte. Nach mancherlei Schicksalen wurde er 1849 außerordentlicher Professor in Halle; von hier trieb ihn 1857 / 58 die Reaktionszeit noch hinweg, und er führte bis an seinen Tod 1872 vielfach ein unsicheres Leben, erntete aber für seine Gedichte, wie schon 1841, noch im letzten Jahrzehnt seines Lebens viel Anerkennung.
Und wie des Jünglings Hermann schwärmerische Liebe zur Jugendfreundin in diesen Blättern zu seiner Charakterisierung manches ins rechte Licht gestellt hat, so ist es wohl auch richtig, aus Prutzens Gedichten einige hervorzuheben, die seine Neigung zu der jungen Dresdnerin offenbaren und somit sie charakterisieren. In diesem Buche war viel von Biedermeierzeit die Rede. Mit dem Verhältnis dieser drei und mit Prutzens Persönlichkeit und Gedichten kommt zum Schluß noch die damals neue Zeit, die Zeit des jungen Deutschland zu Wort.
Ohne tiefer in die Fülle leidenschaftlicher Liebeslieder einzudringen, ziehe ich nur die Lieder hervor, die bestimmt auf Ida Blöde gesungen worden sind, Lieder am Geburtstag der geliebten Frau, in denen er ihr dankt für das Glück, das sie und ihre Kinder[50] ihm gegeben haben und noch geben. Herzlich und offenherzig zugleich gesteht er ein, daß sie als Dichterfrau, als Frau eines Dichters, der immer im Kampf gestanden, kein leichtes Los gezogen habe. Je älter er wird, desto inniger gedenkt er der Zeiten, da er sie – 1839 – zuerst gesehen, zuerst hat feiern können. Besonders heiß flammt es in ihm auf, als widrige Schicksale und seine eigene Kränklichkeit sie einige Zeit von einander getrennt haben, als sie, der Not und Sorge nicht mehr [201] achtend, sich wieder mit ihm vereint hat. Gewiß sind viele dieser Lieder, die in der ersten Gedichtsammlung unter dem Titel „Beglückte Liebe“ stehen, in der Zeit entstanden, da ihm in Halle, in Dresden die Liebe herrlich aufgegangen war. Deutlicher noch strahlt es hervor aus der zweiten großen Sammlung „Aus der Heimat“. Wie hell klingt es heraus aus Liedern „Und noch einmal, mein Kind“, „Beruhigung“, „Wiedersehen“. Eine ganze Reihe Lob- und Preislieder der geliebten Frau gibt es in der kleinen Folge „Des Dichters Haustafel“.
Soll ich Proben geben? – Weniges! Zunächst ein Lied, das er Weihnachten 1839 als jung Verlobter hier in Dresden gedichtet hat. Er verbrachte dies Fest zum ersten Mal im Blödeschen Kreis, nicht allzu freundlich aufgenommen: Der preußische Liberale im Hause einer sächsischen Geheimfinanzratswitwe! Er gedachte dabei seiner treuen Schwestern, mit denen er sonst den heiligen Abend verbracht hatte:
Heut fern von euch – und dennoch nicht verlassen,
Von euch getrennt, doch ein beglückter Mann!
Zwei weiche Arme fühl ich mich umfassen,
Zwei holde Augen sehn mich zärtlich an;
Ein neues Leben ist mir aufgegangen,
Ein Paradies, das nie mein Traum geschaut,
Und all mein Wunsch, mein Hoffen und Verlangen,
Mein Ich, mein All, es ruht in meiner Braut.
Ein Gedicht aus „des Dichters Haustafel“, elf Jahre, nachdem sie in Tharandt die Seine geworden war, am 7. Juli 1852 zu ihrem Geburtstag verfaßt:
Kein leichtes Los ist Dir beschieden:
Im Drang der Not, in Sturm und Nacht
Sollst Du mein Anker sein, mein Frieden,
Der treue Stern, der bei mir wacht.
Reich denn an dieser Jahreswende
Bei dieser Sonne ernstem Schein,
Reich, o Geliebte, mir die Hände
Und schlage tapfern Herzens ein.
Aus dem Jahre 1857 erklingen hoffnungsvollere Töne:
Achtzehn Jahre sind geschwunden,
Bunt und wechselvoll,
Wie der Mensch hier leben soll,
Seit ich Dich zuerst gefunden;
Achtzehn Jahre Dämmerung,
Sonne will sich heben –
Herz, noch einmal werde jung!
Denn es gilt ein neues Leben.
Und von der Dichterfrau heißt es:
Dichterfrauen müssen manches dulden,
Manchen Irrtum, manch Verschulden,
Wenn die stürmischen Gedanken
Niederwerfen fromme Schranken.
Auch das „Buch der Liebe“, eine dritte Gedichtsammlung von ihm, bringt vieles, was auf sein innerstes Erleben mit ihr, der teuren Frau, zurückgeht. Nur eins davon:
Nichts vergessen, nichts vergangen.
Nichts vergessen, nichts vergangen!
Noch in maienhaftem Prangen,
Wie du einst mir aufgegangen,
Leuchten deine duft’gen Wangen,
Lächelt mir dein holder Blick!
Junge Küsse, junge Lieder,
Alles, alles kehret wieder,
Was wir ehedem besaßen.
Nichts vergangen, nichts vergessen
In der Trennung Mißgeschick!
Nichts vergessen, nichts vergangen!
Und mit seligem Erbangen,
Du mein Hoffen, mein Verlangen,
Halt’ ich wieder dich umfangen,
Wie in alter, goldner Zeit;
Lipp’ an Lippe fest gesogen,
Welch ein Fluten, welch ein Wogen!
Nichts vergangen, nichts vergessen!
Unsre Wonnen unermessen,
Endlos unsre Seligkeit!
Wohl sind die meisten Lieder Prutzens jetzt vergessen, ungekannt. Zwei aber sind, soweit meine Erinnerungen gehen, noch heute durch glückliche Vertonung bekannt geblieben. Das eine, das Klänge bringt, die er später nicht mehr erschallen läßt, stammt aus seinem 18. Lebensjahre:
Christnacht.
Heil’ge Nacht, auf Engelsschwingen
Nahst du leise dich der Welt,
Und die Glocken hör’ ich klingen,
Und die Fenster sind erhellt.
Selbst die Hütte trieft von Segen,
Und der Kindlein froher Dank
Jauchzt dem Himmelskind entgegen,
Und ihr Stammeln wird Gesang.
Heil’ge Nacht, mit tausend Kerzen
Steigst du feierlich herauf:
O so geh’ in unsern Herzen,
Strom des Lebens, geh’ uns auf!
Schau, im Himmel und auf Erden
Glänzt der Liebe Rosenschein:
Friede soll’s noch einmal werden
Und die Liebe König sein!
Und dann ein „Paulinenlied“, wie er es nennt:
Ich will’s dir nimmer sagen,
Wie ich so lieb dich hab’,
Im Herzen will ich’s tragen,
Will stumm sein wie das Grab.
Kein Lied soll dir gestehen,
Soll flehen um mein Glück:
Du selber sollst es sehen,
Du selbst – in meinem Blick.
Und kannst du es nicht lesen,
Was dort so zärtlich spricht,
So ist’s ein Traum gewesen:
Dem Träumer zürne nicht!
Doch zurück zu Hermann Rachel, der die Schilderung der Meißner Winzertage nach Prutzens, des Bräutigams, Ankunft im Oktober 1839 abgebrochen hat.
Zum Schluß von seinen Wanderungen noch eine Studentenfahrt mit Freund Oswald Reinhard, von ihm gern „liebe Waldine“ genannt; es ist eine Pfarrhausidylle. Freund Reinhards Schwester verlebte im Juli und August 1841 mit ihrer Mutter, der Frau Stadtgerichtsrat, einige Wochen bei Pfarrer Schmidts in Seelitz bei Rochlitz. Mit Post ging es von Leipzig nach Grimma, von da an „immer mehr wachsenden Bergen, für Leipziger Augen großartig genug“ über Colditz nach Rochlitz. Das Ränzel auf dem Rücken eilten die zwei „riesigen Schrittes“ dem Dorfe zu. Wie freuten sie sich, als die Kirchturmspitze, das Dach des Pfarrhauses [204] allmählich herausblickte. Herzlich wurden sie empfangen und während der drei Tage, die sie da verweilten, auf das gastlichste bewirtet. Wie wohl war ihm zu Mute, wenn er, aus der gemütlichen Fremdenstube herabblickend, das ihm so herzlich befreundete Mädchen, das eben seinen 19. Geburtstag feierte, bei einfacher wirtschaftlicher Tätigkeit auf der breiten, behaglichen Terrasse vor dem Hause decken und auftragen sah. Wanderungen in die benachbarten Täler, wobei Beeren und seltene Pflanzen unter traulichem Geschwätz gesucht wurden, erfreuten das junge Volk. Beim heiteren Mahle ließen die Wirte die Gäste und die bekannten Familien in Dresden „leben“. Dem Städtebewohner machte es Spaß, einer Pferdefütterung beizuwohnen; bei einem Besuche auf einem benachbarten Rittergute sah der Student zum ersten Mal einen alten Kachelofen mit eisernem Kasten, auf dem eine Ansicht von Leipzig mit Jahreszahl zu erblicken war.
Nachdem sich die hilfreichen Jünglinge an einem Morgen flott und lustig am Schotenaushülsen beteiligt hatten, wanderten sie in die nahe Stadt und begrüßten die Inhaber der Baumwollenfabrik Weber und Dietrich. Zuvorkommend wurden die jungen Leute aufgenommen und herumgeführt. Wie staunte er über die Zusammensetzung der künstlichen Maschinen und über den inneren Zusammenhang der äußerlich so einfach erscheinenden Arbeit! Machte doch schon damals jede einzelne Spindel in der Minute 4000 Schwingungen. Genau bucht er die einzelnen Vorgänge, die ihn lebhaft interessieren. Zum Schluß fügt er die kurze Notiz hinzu: „Bleich und siech die Arbeiter, besonders aus dem weiblichen Geschlechte“. Nachmittags wandern sie durch ein liebliches Tal nach den Schieferbrüchen von Penna, nördlich von Rochlitz. Der Schulmeister des Ortes führt die Gäste durch 5–6 Brüche. Er beobachtet genau, wie mit den 2–3 Zoll langen Meißeln die einzelnen Platten abgelöst werden, die als einfacher Dachschiefer oder große Tafelflöze erscheinen.
Am Abend erwartet sie als ein besonderer Spaß eine Theatervorstellung in der kleinen Provinzstadt Rochlitz. Sie sitzen als „noble Leute“ im Parterre, müssen die Leistungen der Männer gelten lassen; die darstellenden Damen sind ihnen aber bedauerlich. Als sie aus Hohn klatschen, erregen sie allgemeines Aufsehen unter dem Provinzpublikum.
[205] Am letzten Tage werden die Ränzel geschnürt, die Gäste verlassen sämtlich das Haus in einer Kalesche, die sie über Leisnig nach Oschatz führt, von wo sie nach zwei Seiten, Dresden und Leipzig, auseinandergehen. In Leisnig wird das Schloß bestiegen, die Ruine bewundert, die anmutige Aussicht auf Kloster Buch und seine Waldungen genossen. Der Rentverwalter, ein alter, freundlicher Mann, führt die Gesellschaft durch die wohlerhaltenen Räume des Schlosses und berichtet, daß der König Friedrich August II. alle Sorgfalt zur Erhaltung des Ganzen empfohlen habe. Feierlich wird ihnen zu Mute, als sie die ehrwürdige Schloßkapelle betreten. „Ihr freundliches Gewölbe mag wohl oft von holden Stimmen erfüllt worden sein, Stimmen von reinen Seelen, rein wie Sie, die jetzt andächtig darinnen aufschauen.“ Um die Gefühle festzuhalten, die er dort selbst empfunden, fügt er aus Lenaus „Wurmlinger Kapelle“ seinem Tagebuch die Zeilen ein:
Leise werd’ ich hier umweht
Von geheimen, frohen Schauern,
Gleich als hätt’ ein fromm Gebet
Sich verspätet in den Mauern.
Später drückte er seine Gefühle in folgenden zwei Versen aus, die ich, mit dem Vermerk „Leisnig“ versehen, in seinen Papieren gefunden habe:
Als ich eintrat in die alte Schloßkapelle,
Rings nur Schutt und alt Gerümpel sah,
Glaubt’ ich fast, von hier sei Gott gewichen,
Wo kein Kreuz und kein Altar mehr war.
Gläubig schlugst du da den Blick zum Himmel,
Seelenruhig war des Auges Strahl,
Und der Blick, der mich getroffen,
Gab mir Lieb und Glauben auf einmal.
Wie so manche andere seiner Lieder oder Liedentwürfe, haben auch diese einen Anklang an Lenaus innige, dabei schwermütige Weise.
Wenige Monate nach dieser dörflichen Idylle brachte ihn ein schwerer Kummer, der die Seinigen getroffen, und sein entschlossener ritterlicher Sinn – auch in dörflicher Gegend – in eine gefährliche Lage. Ein ihm verwandtschaftlich sehr nahestehender [206] junger Mann war durch die Untreue der Braut schwer gekränkt worden. Das Mädchen, gescheit, feurig, leicht unbefriedigt, hatte während lang andauernder Abwesenheit des Bräutigams die Huldigungen eines jungen Theologen, der sich mit ihr zu treffen und zu spazieren nicht erfolglos angestrebt hatte, angenommen. Als Hermann die niedrige Handlungsweise des Mannes, der wußte, daß er sich hinterrücks um eine Braut bewarb, erfahren, war er schnell entschlossen. „Ich bin der Einzige, dessen Verhältnisse so sind, daß ich mit Leichtigkeit die Waffen zur Hand nehmen und selbigen Schurken züchtigen kann!“ Mit tiefer Empfindung liest er bald darauf die Briefe, die der schwer Getroffene an seine Familie geschrieben: „Der Himmel ist über ihm eingebrochen, das Höchste, Theuerste ihm geraubt – um so größer lastet der Schmerz auf seiner Seele: seine Briefe sind wehmütig und weich. Bald aber fand er sich wieder. Das letzte Abschiedswort mit den zurückgegebenen Ringen muß der Unglückseligen erst den Verlust in seiner ganzen Größe offenbaren. Es ist der echte Nachklang einer wahren Liebe, warme einfache Worte, denen sicher Überzeugung zu Grunde liegt.“ Der Gegner erhielt nun einen Brief von dem ritterlichen jungen Mann und soll sich äußern, ob er die Sachlage gekannt und doch so gehandelt habe, wie er gehandelt hatte. Er fand nicht den Mut, wahr zu sein, wich aus, verlangte die „Legitimation“, mit der jener seinen Brief geschrieben, warnte vor einem „Eclat“, kurz, er kniff, wie der studentische Ausdruck ist. Die Antwort war: er habe Genugtuung zu leisten! Die Vermittelung, mit etwas zitteriger Stimme von einem Verwandten hervorgebracht, wurde fest zurückgewiesen. Dadurch erreicht er, daß sich der Beschuldigte zu stellen bereit erklärte, und zwar wegen seines „Theologentums“ mit Pistolen. Doch benutzte der Unterhändler diesen Vorschlag dazu, den Forderer zu erweichen, er solle sich mit einer Ehrenerklärung begnügen. Dieser aber blieb fest. „Was nützt eine Ehrenerklärung? Die Welt erfährt selbige nicht, und ihr gegenüber ist man sich Ehrenrettung schuldig. Dann wäre es leicht, jedes Mädchen zu umwerben und mit ihr Rendezvous vorzunehmen, unbekümmert um ihre Verhältnisse, unbekümmert um den Ausgang. Mag er so viel Schuld haben, wie jeder andere, er kannte den Verlobten, wußte um das Verhältnis und durfte nicht ins Blaue hinein [207] auf solche Art verfahren; ich bin nicht blutgierig und will etwa seinem Leben ein Ende machen, dieß liegt mir fern; er soll bloß wissen, daß solches nicht ungestraft sich thun läßt. Mag es ihm so oft gelungen seyn, als bisher versucht, dieß mag der Markstein seyn! Ich kenne meine Leute, wie gesprächig sie seyn würden, wenn die ganze Sache ungerügt vorbey ginge.“ Das wiederholte Angebot einer Ehrenerklärung wies er mit ganz entschiedenen Worten zurück. Sofort schrieb er um einen Sekundanten, der die weiteren Verhandlungen führen sollte. Dann eilte er nach der Saloppe, labte sich an dem lieben Elbtal, das sich in schönster Beleuchtung ausdehnte – es ist ein köstlicher Oktobertag! Bald wurde es kühl, und der Aufbruch mit den Freunden, die ihn liebreich empfangen hatten, nötig; kaum konnte er sich von dem Anblick des herrlichen Panoramas trennen, das er so lange nicht in solchem Schmuck und Abendglanze gesehen.
Bald darauf reiste er zu der ihm so lieben Familie des alten Malers Kersting in Meißen. Am Abend dieses Tages wird gerade der Geburtstag des Papa Kersting gefeiert. Leute aus der Stadt kommen und beschenken den beliebten und geehrten alten Lützower. Verschiedene Gesänge werden vorgetragen. Die Frau des Dompredigers, noch jung und zärtlich an der Seite des Gatten, erfreut alle mit ihrer hellen kräftigen Stimme, mit ihrem Ausdruck, ihrer Wärme. Zuletzt wird das Wort „Malervorsteher“ in einzelnen Silben dramatisch oder bloß mimisch dargestellt; am besten gelingt das Ganze: treue Kopie des Alten, wie er nach Tische in der Sofaecke schlummert, durch einen der Söhne dargestellt. Wer gedächte nicht des hübschen Innenstückes des alten Kersting selbst: Die Stickerin am Fenster, wo wir gewiß die Sofaecke seines eigenen Zimmers sehen?
Mitten in diese trauten Festlichkeiten hinein fallen die Verhandlungen mit Kerstings Sohne, der ihm als Sekundant dienen soll. Mit ihm und einem Arzt verabredete er sich zum Gang nach Oberau, wo in der Nähe des Tunnels der Zweikampf stattfinden sollte. Erst war der Heller vorgeschlagen worden, aber er scheute wegen der Stellung des Vaters in Dresden, der doch als Kämmerer dem Rate angehörte, die allzu große Nähe der Stadt. Der Gegner erschien zwar in Oberau, erklärte aber, eben [208] von einer Reise zurückgekehrt, zu so ernstem Werke nicht vorbereitet zu sein, und wollte auf die Ehrenerklärung von früher zurückkommen. Die aus Meißen herbeigeeilte Partei war entrüstet über diesen Mangel an Mut und drang darauf, daß am Reformationstage bei Volkersdorf an der Straße zwischen Rähnitz und Bärndorf (nicht weit von Moritzburg) die Sache bestimmt ausgefochten werde. Für die wenigen dazwischen liegenden Tage reiste Hermann nach Leipzig. Er übernachtete am ersten Abend bei einem Freunde Kerstings in Riesa. Er fand da außer dem närrischen, witzigen Mann und der einfachen lieben Frau interessante Kinder, deren leider drei blind waren. Ihr Wesen und Treiben erschien ihm ganz merkwürdig; höchst rührend und wehmütig ergreifend die Liebe von zweien unter ihnen zueinander. Ihn mochte dies besonders beschäftigen; war doch sein Vater, der Kämmerer Rachel, ein eifriges Mitglied des Dresdner Blindenvereins seit dessen Bestehen. Uns befremdet gewaltig der Umstand: drei blinde Kinder in einer Familie, und nur in deren Pflege. In Leipzig belehrte er sich noch eingehend über den Schießkomment; am 30. Oktober 1841 verließ er, von den Freunden herzlichst entlassen, die Stadt. Am 29. schreibt er in sein Heft „Gute Nacht; hoffentlich nicht die letzte in Leipzig“. Am 30. traf er mit seinen Helfern in Dresden ein, ging, tief in seinen Mantel gehüllt, damit er nicht auf der Straße erkannt werde, nach Stadt Coburg. Während Kersting der Sohn in die Stadt wanderte, um Pistolen zu borgen oder zu kaufen, vertrieb er sich die Zeit mit dem Rheinischen Taschenbuch von 1840, in dem er hübsche Gedichte von Nicolaus Becker, dem Rheinlieddichter, las. Gegen Abend fahren sie in einem bequemen „Wiener“ Wagen bei hellstem Mondschein nach Volkersdorf, in lebendige Unterhaltung über Charakterentwicklung und Herzensbildung vertieft. Im Gasthof bitten sie um gute Unterkunft; bald sind sie in abgelegener Stube, die sie dadurch noch sichern, daß sie die Fenster mit ihren Mänteln verhängen. Die Wirtsleute, er ein gutmütiger, geschwätziger Mann, sie eine sehr hübsche, stille bescheidene Frau, setzen das Essen auf und erfahren der Vorsicht halber nur, daß die jungen Männer botanischer Interessen wegen gekommen seien. Nach Tisch vereinigt ein guter Weinpunsch Wirtsleute und Gäste; im Gespräch erholen [209] sich diese alle nötigen Auskünfte über Standort und Aufsichtsgebiet der Landgendarme und die Grenzen der Jurisdiktion der Stadt Dresden.
Nach guter Nachtruhe überlegt sich der junge Mann seine ganze Lage! Sein Gegner hat sich mit Pässen nach der Schweiz versorgt. Er kann und will dies nicht. Trifft ihn eine Strafe, wird er sie absitzen und „in währender Zeit fortbüffeln“. „Ist doch solcher Arrest nicht mit der gewöhnlichen Art zu vergleichen, außerdem würde er auch zu lange anhalten, wie die erfahrenen Beispiele lehren. Allerdings böse Aufregung und bittren Jammer würde solches Ende mit sich führen. Quid juvant lacrymae? ich muß handeln, also satis hac de re! Nur eines wünschte ich: Paukerei auf Säbel oder größere Geschicklichkeit im Schießen; ich bin um der Meinigen willen genöthigt, anders zu handeln, als ich sonst nach meiner Überzeugung handeln würde; ich darf nicht corpus halten, wenn ich nicht riskieren will, ihn todzuschießen; ich muß mich mit den Extremitäten begnügen und fast auch da mit den Seiten – genug, dieß ist eklig und das Treffen problematisch“. Nachdem die Freunde aufgestanden, lassen sie – es ist Reformationstag – mit dem Rest Weinpunsch, der auf dem Tische steht, Dr. Martin Luther leben. Die Wirtin bringt dazu delikaten Kirmeskuchen als Frühstücksbrot herein. Die Sachen werden noch völlig ausgepackt, und alles zurechtgelegt für den Fall, daß er...!
Nun brechen sie auf, um zu botanisieren, treffen unterwegs den Sekundanten des Gegners, einen der Ärzte und einen Studenten, der sich erboten hat, den speculator ab altis, d. h. den Aufpasser auf den Höhen für den Zweikampf abzugeben. Ein passender Platz wird jenseits der Dresdner Jurisdiktionsgrenze gefunden auf fremdem Gebiet in einem Bauernholze zur Seite eines Meilen- und Wegzeigers, der an dem Scheidewege steht nach Volkersdorf-Bärndorf. Der Platz wird abgeschritten, zwei Rohrstöcke eingestoßen. Während der gegnerische Sekundant dem Gegner und dessen Doktor, einem alten, würdigen Bataillonsarzt, entgegenging, drangen die Freunde in den jungen Studenten, nicht zu kühn zu schießen, um unerwünschtes Unglück zu vermeiden. Diese Bitte wiederholen sie, als sie den Gegner näher und näher kommen sehen: sie meinen, daß selbiger durch die [210] Angst, welche er, nach seinem bleichen Gesicht zu urteilen, ausgestanden, genugsam bestraft worden sei. Und wirklich, der nicht sehr tapfere Gegner schwankte fast nur und stützte sich auf den Arm des Sekundanten, zumal beim Prozeß des Ladens, als die Kugeln aufgesetzt und die chirurgischen Instrumente ‚entwickelt‘ wurden. Alle Förmlichkeiten wurden getroffen, die Sekundanten traten einige Schritte weit zur Seite, um nötigenfalls ihr Halt zu rufen oder selbst zu schießen – in der Mitte die Doktoren – das Kommando erfolgte. Der Gegner ging nicht vorwärts, der Forderer deshalb nur wenige Schritte. Die Schüsse erfolgten, nicht gleichzeitig, der Gegner schoß 1/2 Minute früher. Er schien seitwärts zu halten, der Forderer zielte nach Schenkel und Stock, auf den jener ziemlich haltlos sich stützte. „Wir standen beide; der Sekundant fragte mich, ob ich befriedigt sey; die Bedenkzeit war kurz, ich gedachte an die Reden meiner Freunde kurz vorher; der alte Doktor sah ernst auf mich herab; ich hatte am Ende das erreicht, was ich nur im glücklichen Falle erreichen konnte, kurz – ich sagte ja! Der alte Doktor kam auf mich los, gab mir die Hand: ,Sie haben ehrenvoll und achtungswerth gehandelt!‘ – Mein Gegner kam mir entgegen, ich tat das Gleiche, gab ihm mit weg- oder niedergewendetem Haupte die Hand“. Aus dem Nachspiel sei erwähnt, daß der speculator ab altis böse Angst ausgestanden hatte, als nach dem Kugelwechsel ganz unheimliche Stille herrschte. Der Gegner, vom Sekundanten gefragt, ob er Genugtuung erlangt habe, hatte nur kurz gesagt, er sei nicht beleidigt gewesen. Während des Schießens hatte es merkwürdig geklappert; es fand sich, daß der Forderer seinen in einiger Entfernung zum Abstecken des Platzes verwendeten Stock getroffen und zerschossen hatte.
Schnell ging es zurück nach Volkersdorf in den Gasthof, um zu packen, einen mittlerweile eingetroffenen Wagen zu besteigen und nach Dresden zu fahren. Die Wirtsleute waren nicht allzu sehr erstaunt, daß die Botanisierer so schnell verschwanden: vielleicht hatten sie etwas von dem eigentlichen Vorhaben geahnt; vielleicht war ihr Haus schon früher der Ausgangspunkt für solch heimliche Unternehmen gewesen. Zur Abfahrt kamen vom Heller schnell noch andere Freunde, die drüben gewartet hatten, herüber. Alle fuhren wieder nach Dresden mitten [211] durch die Kirmeswallfahrer hindurch und stärkten sich in Stadt Coburg. Während die Freunde zum Schluß ein Spielchen machten, setzte er selbst sich in die Sofaecke und las – in Goethes Wahlverwandtschaften.
Zum Schluß macht sich bei dem ganzen Vorfall, der bei ungünstiger Wendung Tod oder Verwundung und Bestrafung hätte zur Folge haben können, das Jugendlich-Studentische geltend. Einer der Freunde, der früher erwähnte Kohlmetz, macht den Vorschlag, mit ihm in seine von der Familie zur Zeit verlassene Wohnung zu bummeln, dort Junggesellen- und Studentenwirtschaft zu treiben und ,abermalen‘ einen Weinpunsch herzustellen. „Da sich schon dicke Finsterniß auf die Stadt Dresden herabgesenkt, wird der Vorschlag befolgt, mein Mantel läßt nur meine Augen herauslugen, sonst ist alles verhüllt: ich bummle bei den vom Lincke’schen Bade zurückkehrenden Dresdnern vorbei! Die Lagerwirtschaft beginnt, einer holt Wasser, der andere spaltet Holz, der dritte macht Feuer, schlägt Zucker, preßt Citrone, wischt Terrine und Gläser aus – wahrlich, ein herrliches Genrebild, das noch ruhiger und angenehmer wird, als wir um die Bowle herumsitzen und fidel kneipen. Mein Geburtstag (am 1. Nov.) wird im voraus honoriert. Während die übrige Clique fortbummelt, wird mit Kohlmetz wieder Ordnung hergestellt, die Lagerstätten bereitet und allerlei Mäntel und Decken vertheilt, dann friedlich mit ihm geschwatzt. In voller Montur geschlafen, um morgen das lästige Anziehen zu ersparen – ich muß gewisse dämonische Gedanken abwehren, die in mir aufkommen und mich tadeln wollen ob meines Begnügens mit dem Erlebten! – Qual der Selbstunzufriedenheit! Verwünsche, daß ich mich habe überreden lassen!“
Am andern Morgen reist er nach Leipzig zurück, ohne seine Familie gesehen zu haben. Es wurde ihm schwer, wieder in das Arbeitsleben hineinzukommen, zuviel ‚lyrisches Element‘ machte sich geltend. Dann mußte er doch das Geschehene dem mitteilen, für den er, ohne es ihm anzuzeigen, so ritterlich eingetreten war. Er tat es in wilder und doch auch milder Stimmung. Leidenschaftliche Briefe kamen aus der Ferne zurück; Anerkennung, Dank, aber auch Vorwürfe wegen der möglichen Folgen wechseln darin miteinander ab. Der junge Mann schreibt darüber selbst: [212] „Wohl mag ihm der Gedanke peinigend seyn: ,ein Anderer ist um meinetwillen in solche Gefahr gekommen‘; mir half die gewisse Begeisterung alle möglichen Gefahren überstehen und überwinden; ich war über Dinge, die ihn noch nachträglich peinigen, ruhig; ruhiger, als wenn ich für mich selbst dagestanden, da ich wissen konnte, daß die mich treffenden Vorwürfe minder heftig sein würden. Ihm fehlen diese Hebel; eben aus Liebe zu mir denkt er sich alle möglichen Gefährnisse, in die ich mich gebracht; allen Kummer, den ich über Eltern und Geschwister gebracht; und zuletzt die qualvollen Betrachtungen, zu welchen er veranlaßt worden!“ Der Briefwechsel wurde ruhiger, die Familie erfuhr samt den befreundeten Familien allmählich von der kühnen Unternehmung. Die Anerkennung überwog selbstverständlich die Verurteilung der Tat. Man hatte den liebenswerten Charakter selbst in dieser Handlung erkennen und schätzen gelernt.
Sie bildet zugleich die letzte Niederschrift bedeutenderen Inhaltes in den Heften, die er unter der Bezeichnung ‚Erlebtes‘ hinterlassen hat. In den wenigen Wochen, die das Jahr 1841 noch übrig hatte, überwiegen Angaben über seine wissenschaftlichen Studien, die Vorbereitung zu seinem ersten Examen. Aus dem Jahre 1842 ist nichts übriggeblieben; gewiß hat er das seit 1837 mit solcher Liebe betriebene Werk, Erlebnisse kurz festzulegen und später ausführlicher zu beschreiben, noch fortgesetzt; wodurch gerade die des Jahres 1842 verloren gegangen, ist mir nicht bekannt. 1842 wurde sein Todesjahr. Es ist das durch seine Hitze so verderbliche Jahr. Manche deutsche Städte fielen ihr zum Opfer, so Hamburg, und im engeren Vaterlande Oschatz und Camenz. Zugleich schädigten auch, wie so oft bei außerordentlichen Witterungsverhältnissen, Krankheiten die Menschen. So wurde auch Hermann Rachel im heißen Leipzig während des Monats Juli vom Nervenfieber ergriffen. Vater und Bruder Julius eilten hin, um sich an seiner Pflege zu beteiligen. Täglich schrieb der liebende Vater, der dem Erkrankten alle kleinen Liebesdienste am Bett selbst leistete, zweimal der besorgten Mutter. Klarheit und Fieberphantasien wechselten tagelang. Als ihm der Vater in lichtem Augenblick Gutes erwies, zog ihn der Sohn an sich und küßte ihn voller Dankbarkeit. „Er schlummert wieder sanft. Die Sophie kehrt eben jetzt aus; da verlangt er [213] nach einem Spiegel, welchen sie holt. Er wollte seine Unterlippe sehen, die von der Fieberhitze schwarz geworden war, weil derartige Kranke nur durch den Mund atmen. Er beruhigte sich bei der Versicherung, als ich ihm sagte, der Doktor werde ein bischen Salbe verordnen, damit er das Zupfen an der vertrockneten Lippenhaut läßt. Dies that auch gute Wirkung“.
„Als ich ihm wieder behilflich gewesen, zog er mich an sich, klopfte mich auf die Achsel und streichelte mir den Backen. Ich bat ihn, die Augen zu schließen, um zu schlafen; da zog er mich wieder an sich und sagte mit fast unhörbarer Stimme: ,wenn ich kann!‘ Bald schloß er die Augen – nun schlummert er auch wirklich sanft“.
Wenige Tage darauf schloß der hoffnungsvolle junge Mann seine Augen für immer. Er wurde auf dem nun alten Leipziger Johannisfriedhof bestattet. 73 Jahre sind darüber hingegangen; aber noch heute lassen wir Überbliebenen dies Grab pfleglich erhalten, bis – es wird wohl 1916 geschehen – dieser Friedhof, wie im selben Jahr der Dresdner Eliasfriedhof, auf dem seine Großmutter, seine Eltern, seine Schwester ruhen, verweltlicht wird. Diese seine Schwester, Anna Rachel, ist sechs Jahre später, 1848, das Opfer derselben schweren Krankheit geworden, der er erlegen ist. Sie war den Brüdern und den Eltern eine stille, liebe Lebensgefährtin gewesen, die nach außen hin wenig hervortrat. Herzenskummer hatte sie früh getroffen, den sie, die erst 24 jährige, noch nicht überwunden hatte, als ihr Tod die Eltern in tiefen Schmerz versetzte. Bei ihr gedenkt man der Antwort Violas in „Was ihr wollt“ auf die Frage: „Was war ihr Lebenslauf?“
„Ein leeres Blatt. Sie sagte ihre Liebe nie
Und ließ Verheimlichung, wie in der Knospe
Den Wurm, an ihrer Purpurwange nagen.
Sich härmend, und in bleicher, welker Schwermut,
Saß sie wie die Geduld auf einer Gruft,
Dem Grame lächelnd.“
Ihre Tagebuchblätter enthalten kurze, schmerzliche Worte über inneres Erleben und Erleiden.
Hermann Rachel ist von seiner Familie, von seinen Freunden herzlich betrauert worden. Eine hochbejahrte Tante hat ihm ein schlichtes Trauergedicht geweiht. Auch Gustav Blöde, der Bruder [214] der Ida Prutz, mit der Hermann auch nach ihrer Verheiratung in freundschaftlichem Briefverkehr geblieben war, widmete dem Freunde seines Hauses ein Sonett.
Es lautet:
Heil Dir, o Geist, Du schiedest von dem kranken
Gefährten Deiner selbst, Du hast vollbracht
Den schönen Sieg, nach dem das Licht dir lacht,
Das ew’ge Licht jenseits der Erde Schranken.
Dich preisen wir, denn Deine Fesseln sanken,
Und über Dich, befreit aus Erdennacht,
Verloren Schmerz und Irrtum ihre Macht;
Du weilst verklärt am Urquell der Gedanken.
Doch wir, die wir noch in den Fesseln leben,
Dem Schmetterlinge gleich, der flügelschlagend
Den Ausgang sucht, geängstigt und gequält,
Wir, denen noch des Todes Freiheit fehlt,
Wir, noch in der Beschränkung zweifelnd, klagend,
Wir sind dem Schmerz, dem ird’schen, preisgegeben.
Wenn ich in jüngeren Jahren in meiner Familie die älteren Mitglieder, die ihn gekannt hatten, über ihn sprechen hörte, vernahm ich stets die besonders hervorgehobene Bezeichnung: Der gute Hermann. Und in seines Vaters, des Kämmerers, Rechnungsbüchern, die ich so oft benutzt habe, sind die Ausgaben, die Krankheit, Tod und Nachlaßordnung für den geliebten Sohn veranlaßten, von demselben Vermerk begleitet: für den guten Hermann. –
Ich darf wohl hoffen, daß das Zeit- und Menschenbild, das ich auf Grund alter Niederschriften an den stillen Abenden einer bewegten Zeit zusammengestellt habe, nicht nur im bescheiden geschichtlichen Sinn manchen erfreut hat und für später einen gewissen Wert behalten wird, sondern daß auch die Schilderung der Entwickelung dreier junger Dresdner freundlich beurteilt werden wird.
Ein junger Jurist, eifrig, strebsam, verstandes- und geschäftsmäßig alles betreibend; ein junger Techniker, alles Neue, Praktische rasch ergreifend, unermüdlich ausübend; ein junger Mediziner, mehr schwärmerisch noch, als tätig fest eingreifend: drei Brüder aus einem Stamme, verschieden in ihrer Anlage, ihrem Auftreten, ihrer Wirkung, darin aber einander gleichend, [215] daß sie an der Heimatstadt, in der sie friedvoll aufgewachsen sind, an ihrer Familie, in deren Schoß sie Herzensbildung erhalten haben, an ihren Freunden, denen sie in ihrem Jugendleben viel Beglückung verdankten, mit großer Liebe hängen.
Wenn dieses Buch dazu anregen sollte, daß so manche schriftliche oder mündliche Erinnerung, die in Dresdner Bürgerfamilien an Vorfahren noch vorhanden sein mag, auch der Vergessenheit entrissen und zusammengefaßt der Zukunft gesichert würde, so wäre ein gewiß nicht nur von mir gehegter Wunsch erfüllt. Die bürgerlichen Familien sollten, so wenig günstig bei unsrer schnellebenden Zeit Aussichten und Möglichkeiten dafür sind, den familiengeschichtlichen Sinn mehr hegen und pflegen, als dies wohl geschieht.[51]
[Inhalt]
Seite
| |
| Vorwort | |
| Etwas von der Rachelschen Familie im 17. und 18. Jahrhundert | 1–11 |
| Vom Buchhalter, Stadtrat und Kämmerer Heinrich Wilhelm Rachel | 12–38 |
| Aus dem Leben des Kreuzschülers Julius Wilhelm Rachel | 39–116 |
| Aus dem Leben des Technikers Gustav Heinrich Rachel | 117–155 |
| „Erlebtes“ von Hermann Moritz Rachel | 156–215 |
- ↑ Die Matrikel der Universität Rostock, herausgegeben von Hofmeister I–III. Der erste aus der Familie Rachel, der 1523 inskribiert wurde, war ein Johannes Rachel aus Malchow; ein Johannes Heinrich Rachel aus Husum 1691 der letzte. Vier von den 14 Rachels hießen Joachim, vier Moritz, zwei Samuel, je einer Nikolaus, Albert, Johannes, Johannes Heinrich.
- ↑ Über ihn habe ich im XIV. Jahrgang der Dresdner Geschichtsblätter S. 58 gehandelt.
- ↑ H. St. A. Allerhöchste Spezial-Reskripte 1748. Nr. 38. Kurfürst Friedrich August II. an das Kammerkollegium 8. Jan. 1748. Über den Augsburger Zweig der Rachels boten das Augsburger Stadtarchiv und die Kirchenbücher der St.-Anna-Gemeinde manche Nachrichten.
- ↑ H. St. A. Loc. 32 638 Bl. 76. Friedrich August II. an das Acciskollegium 20. Sept. 1760. Interessant ist folgende Notiz aus der Zeit, da er als Assessor vereidet wurde. H. St. A. Pflichtbuch de Anno 1737–1752 Vol. I Folio 180: Georg Matthias Rachel von Löwmannsegk, Legations-Rath, wurde als Assessor bey der Commerciendeputation gewöhnlichermaßen vereydet. In Hut und Degen, und mit Adhibirung des Wortes: Er: beider Vorhaltung. Dreßden am 7. Juli 1752.
- ↑ Durch die Güte des Herrn Geheimrat W. v. Seidlitz konnte ich dessen Auszüge aus den diesen Kunsthandel betreffenden Gemäldegalerie-Akten benutzen.
- ↑ Fornimento = Gerät, Hausrat.
- ↑ Th. Elze, Geschichte der protestantischen Bewegungen und der evangelischen Gemeinde in Venedig. Bielefeld 1883.
- ↑ Georg Erler, die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1909. III S. 314.
- ↑ Nach Aufzeichnungen im Besitz des Herrn Direktor Wilhelm Rachel in Blasewitz, der einem der auch aus Norddeutschland stammenden Rachelschen Familienzweige angehört.
- ↑ Umständliche Beschreibung Dresdens I 355.
- ↑ H. St. A. Die Kassenbillets-Commissions-Akten Loc. 32 736 geben hierfür mancherlei Nachweise.
- ↑ Über das Leben in der Familie Winkler habe ich nach dem von Emiliens Schwester Auguste geführten Tagebuch in den Dresdner Geschichtsblättern IV, 4 S. 223 gehandelt.
- ↑ S. S. 16, Anmerkung.
- ↑ Wie lange die Dresdner Verhältnisse sich vielfach gleich blieben, geht aus einer Notiz vom März 1857 in seinem Ausgabebuch hervor. In diesem Monat hat er sich mit seinen Enkeln – einen Elefanten für 17 Gr. angesehen! Im folgenden Jahr bemerkt er ebenda: in der Affenkomödie!
- ↑ Der Lithograph und Inhaber einer Kunstdruckerei L. Zöllner wohnte Albrechtsgasse 8; der „Maler“ F. Brockmann, wie er sich im Adreßbuch angab, merkwürdigerweise daneben, Albrechtsgasse 7, gegenüber dem Rektor Gröbel. Später nannte er sich Maler und Photograph, zuletzt nur Photograph.
- ↑ S. hierüber auch Klemm a. a. O. 1, 29.
- ↑ 5 Jahre war Bürgermeister Jacobi einer seiner Abmieter.
- ↑ Als er 1861 starb, rühmte ihm der Direktor der Königl. Blindenanstalt Georgi im Jahresberichte hohe Verdienste, die er sich um diese Anstalt erworben habe, nach.
- ↑ Bei seiner Anstellung war er verpflichtet worden zum Verwalter des Bauamtes und der Immobiliar-Brandkasse, zum Deputierten bei der Personen-, Scheck- und Quatember-Steuer-Einnahme, bei der Inspektion der Kirche, besonders der Sophienkirche und den Dorfkirchen, sowie zum Administrator des Sophien-Kirchenvermögens. – Über seine amtliche Tätigkeit zu berichten, ist hier nicht der Ort.
- ↑ S. auch Gustav Klemm, Vor fünfzig Jahren, Bd. 2, S. 259.
- ↑ Im Kreuzschularchiv vorhanden. Für die Einsicht in diese Schulpapiere habe ich Herrn Rektor Prof. Dr. Stange an der Kreuzschule bestens zu danken.
- ↑ Klemm a. a. O. Bd. 1, 103. 1830 zum letzten Male gefeiert.
- ↑ Nach Prölß, Geschichte des Hoftheaters zu Dresden, S. 410, besaß sie eine der schönsten Sopranstimmen.
- ↑ H. v. Friesen. Ein Beitrag zur Geschichte der Dresdner Gemälde-Galerie. Neues Archiv für Sächs. Geschichte. Bd. 1, S. 315 flgde. Klemm a. a. O. Bd. 2, S. 217.
- ↑ Siehe hierzu Klemm a. a. O. 2, S. 267.
- ↑ Nach „Goethes Gespräche“, herausgeg. v. Biedermann III, S. 127, ist G. F. Kersting am 18. August 1824 bei Goethe gewesen und hat darüber an seine Frau geschrieben: „Ich fand Goethen zwar sehr gealtert, auch etwas zittrig an den Armen, aber am Geiste stark und jung, er bot mir freundlich guten Tag, und ich mußte mich zu ihm auf das Sopha setzen, war herzlich und sprach ohngefähr eine halbe Stunde mit mir über meine Verhältnisse, auch Weib und Kinder wurde freundlich gedacht. Gute Seele, hättest Du doch in diesen Augenblicken den herrlichen Greis sehen können, der mich so freundlich mit seinen gewaltigen Augen fortwährend ansah, und wie er mich beim Fortgang so herzlich noch die Hand drückte und mir ferner Glück und Zufriedenheit wünschte, Du würdest gewiß auch Freudentränen geweint haben so wie ich.“ – Von Kerstings erstem Besuch bei Goethe, im April 1813 zu Dresden, war wohl bisher nichts bekannt. Der Segenswunsch des Dichters zu dem vaterländischen Unternehmen, an dem Körner wie Kersting sich beteiligen wollten, steht in erfreulichem Gegensatz zu Arndts bekannter Mitteilung von Goethes Äußerung: „Schüttelt nur an Euren Ketten, der Mann ist Euch zu groß, Ihr werdet sie nicht zerbrechen!“ Biedermann, a. a. Ort, II S. 180.
- ↑ Über Dresden in jener Zeit s. Klemm a. a. O. Bd. 1, 249.
- ↑ Nach den Ratsakten mitgeteilt.
- ↑ Eine mir nicht verständliche Anspielung.
- ↑ Treitschke, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, IV, S. 270 flgde.
- ↑ Bd. IV, S. 270.
- ↑ S. Dresdner Geschichtsblätter Jahrg. 24, Nr. 1, S.104.
- ↑ Nach ihm ist jetzt in der Vorstadt Reick eine Straße benannt; ein Bild von ihm und seine berühmte Mondkarte sind im math.-physik. Salon.
- ↑ R. S. Blochmann war Inspektor bei der Kunstkammer und damals schon Ehrenmitglied der Ökonomischen Gesellschaft.
- ↑ Jetzt Terrassengasse.
- ↑ 1. Mitternacht zwischen dem 2 ten und 3 ten April 1839 im Tunnel bey Oberau. – Sieben Stunden darauf ging die erste Locomotive durch. – 2. Nachmittags 2 Uhr den 6 ten März 1840. Durchschlag der Hauptörter. Arbeiterfest. – Nachmittags 4 Uhr d. 25. Juni 1840. Grundsteinlegung ohnweit Baden b. Wien. 22 Tge darauf letztes Glück auf.
- ↑ S. 50, 75.
- ↑ Oswald Reinhard, geb. 1818 in Dresden, gest. ebenda 1876 als Appellationsgerichtsrat, war ein Sohn des Senators und Stadtgerichtsrats H. Reinhard, geb. 1784, gest. 1832 zu Dresden.
- ↑ Caroline Bauer, später Gräfin Plater, die fesselnde „Erinnerungen aus ihrem Leben“ hinterlassen hat.
- ↑ Die Dresdner Gasbeleuchtung war dem Mechanikus und Inspektor am mathematisch-physikalischen Salon Blochmann übertragen worden.
- ↑ Hermann Reinhard, ebenfalls Sohn des Stadtgerichtsrats, geb. 1816, gest. als Präsident des Landesmedizinalkollegiums 1892.
- ↑ Ausführlich bezeichnet als Besitzer einer Cichorienfabrik, einer Fabrik für Dampfschocolade und Cacaomasse, sowie einer Fabrik für Kaffee-Surrogate (Cichorien-, Runkelrüben-, Möhren- und Eichelkaffee).
- ↑ S. 25.
- ↑ Erschienen Leipzig 1839. S. 8.
- ↑ Bei den Tunnelarbeiten hatten Freiberger Bergknappen mitgewirkt.
- ↑ Die ersten Fahrten auf der Leipzig-Dresdner Eisenbahn. Nach dem Tagebuche eines Verstorbenen. Zeitschrift für Wandern und Reisen. Düsseldorf 1903.
- ↑ Geb. 1813 in Dresden, gestorben 1886 in Blasewitz.
- ↑ An der Stelle des Kanapees steht seit 1854 die Begerburg. Ein sehr hübsches Bild des Kanapees in der Mappe des Vereins für Geschichte Dresdens 1902 Nr. 5 nach J. F. Wizani.
- ↑ Es war ein General von Langen.
- ↑ Eines von ihnen, der Historiker Hans Prutz, hat in „Nord und Süd“, 1914, Juliheft usw., sehr hübsche „Jugenderinnerungen eines Dankbaren“ veröffentlicht.
- ↑ In den letzten Jahren sind bei L. Ungelenk, Dresden, zwei Bücher solches Inhalts erschienen: „Das Sonnenkind“ und „Sonnenkinds Ehejahre“.
Anmerkungen (Wikisource)