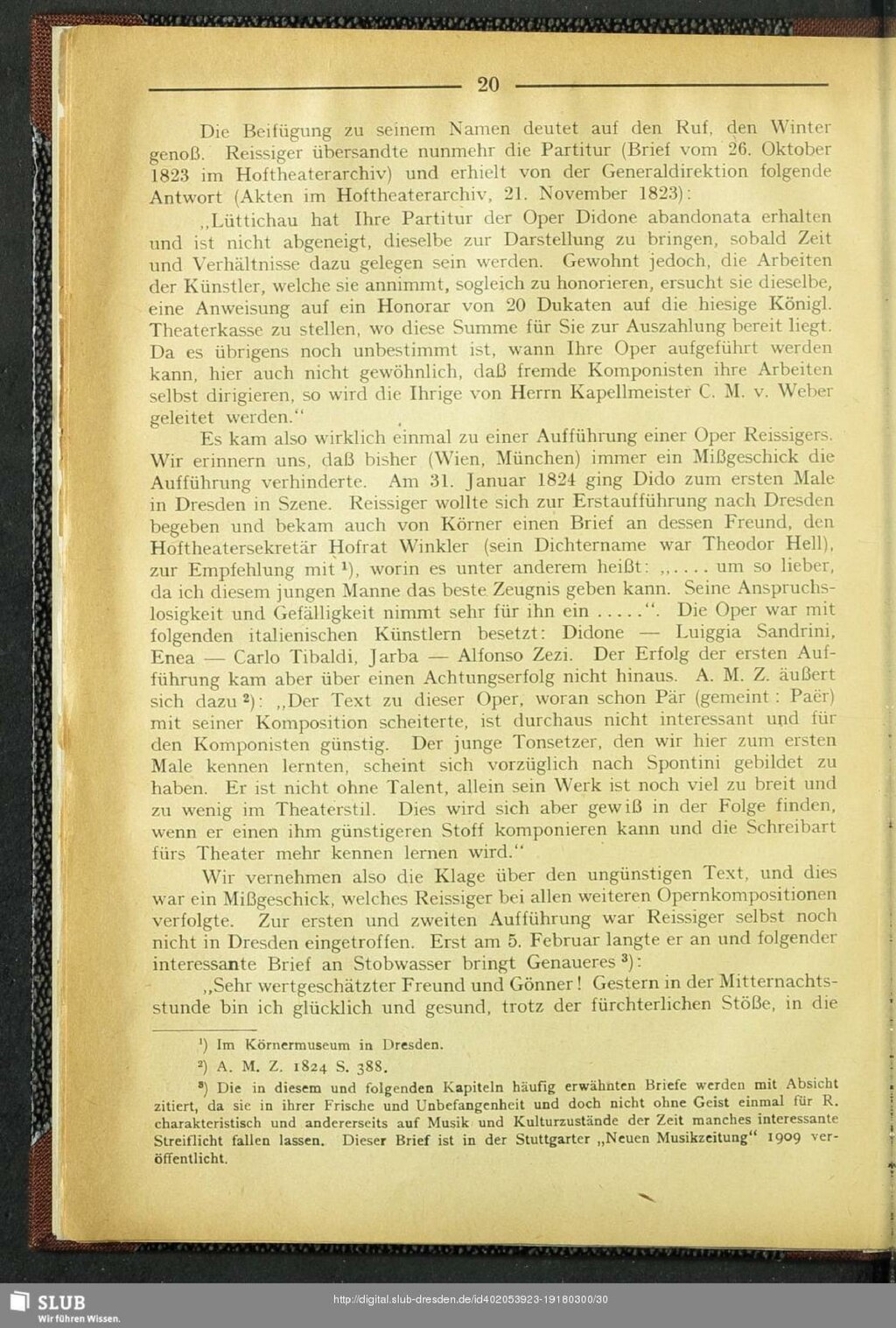| Kurt Kreiser: Carl Gottlieb Reissiger. Sein Leben nebst einigen Beiträgen zur Geschichte des Konzertwesens in Dresden | |
|
|
Die Beifügung zu seinem Namen deutet auf den Ruf, den Winter genoß. Reissiger übersandte nunmehr die Partitur (Brief vom 26. Oktober 1823 im Hoftheaterarchiv) und erhielt von der Generaldirektion folgende Antwort (Akten im Hoftheaterarchiv, 21. November 1823):
„Lüttichau hat Ihre Partitur der Oper Didone abandonata erhalten und ist nicht abgeneigt, dieselbe zur Darstellung zu bringen, sobald Zeit und Verhältnisse dazu gelegen sein werden. Gewohnt jedoch, die Arbeiten der Künstler, welche sie annimmt, sogleich zu honorieren, ersucht sie dieselbe, eine Anweisung auf ein Honorar von 20 Dukaten auf die hiesige Königl. Theaterkasse zu stellen, wo diese Summe für Sie zur Auszahlung bereit liegt. Da es übrigens noch unbestimmt ist, wann Ihre Oper aufgeführt werden kann, hier auch nicht gewöhnlich, daß fremde Komponisten ihre Arbeiten selbst dirigieren, so wird die Ihrige von Herrn Kapellmeister C. M. v. Weber geleitet werden.“
Es kam also wirklich einmal zu einer Aufführung einer Oper Reissigers. Wir erinnern uns, daß bisher (Wien, München) immer ein Mißgeschick die Aufführung verhinderte. Am 31. Januar 1824 ging Dido zum ersten Male in Dresden in Szene. Reissiger wollte sich zur Erstaufführung nach Dresden begeben und bekam auch von Körner einen Brief an dessen Freund, den Hoftheatersekretär Hofrat Winkler (sein Dichtername war Theodor Hell), zur Empfehlung mit[1], worin es unter anderem heißt: „. . . . um so lieber, da ich diesem jungen Manne das beste Zeugnis geben kann. Seine Anspruchslosigkeit und Gefälligkeit nimmt sehr für ihn ein. . . . . “. Die Oper war mit folgenden italienischen Künstlern besetzt: Didone – Luiggia Sandrini, Enea – Carlo Tibaldi, Jarba – Alfonso Zezi. Der Erfolg der ersten Aufführung kam aber über einen Achtungserfolg nicht hinaus. A. M. Z. äußert sich dazu[2]: „Der Text zu dieser Oper, woran schon Pär (gemeint: Paër) mit seiner Komposition scheiterte, ist durchaus nicht interessant und für den Komponisten günstig. Der junge Tonsetzer, den wir hier zum ersten Male kennen lernten, scheint sich vorzüglich nach Spontini gebildet zu haben. Er ist nicht ohne Talent, allein sein Werk ist noch viel zu breit und zu wenig im Theaterstil. Dies wird sich aber gewiß in der Folge finden, wenn er einen ihm günstigeren Stoff komponieren kann und die Schreibart fürs Theater mehr kennen lernen wird.“
Wir vernehmen also die Klage über den ungünstigen Text, und dies war ein Mißgeschick, welches Reissiger bei allen weiteren Opernkompositionen verfolgte. Zur ersten und zweiten Aufführung war Reissiger selbst noch nicht in Dresden eingetroffen. Erst am 5. Februar langte er an und folgender interessante Brief an Stobwasser bringt Genaueres[3]:
„Sehr wertgeschätzter Freund und Gönner! Gestern in der Mitternachtsstunde bin ich glücklich und gesund, trotz der fürchterlichen Stöße, in die
- ↑ Im Körnermuseum in Dresden.
- ↑ A. M. Z. 1824 S. 388.
- ↑ Die in diesem und folgenden Kapiteln häufig erwähnten Briefe werden mit Absicht zitiert, da sie in ihrer Frische und Unbefangenheit und doch nicht ohne Geist einmal für R. charakteristisch und andererseits auf Musik und Kulturzustände der Zeit manches interessante Streiflicht fallen lassen. Dieser Brief ist in der Stuttgarter „Neuen Musikzeitung“ 1909 veröffentlicht.
Kurt Kreiser: Carl Gottlieb Reissiger. Sein Leben nebst einigen Beiträgen zur Geschichte des Konzertwesens in Dresden. i. A. des Verein für Geschichte und Topographie Dresdens und seiner Umgebung, Dresden 1918, Seite 20. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Heft26VereinGeschichteDresden1918.pdf/30&oldid=- (Version vom 9.5.2024)