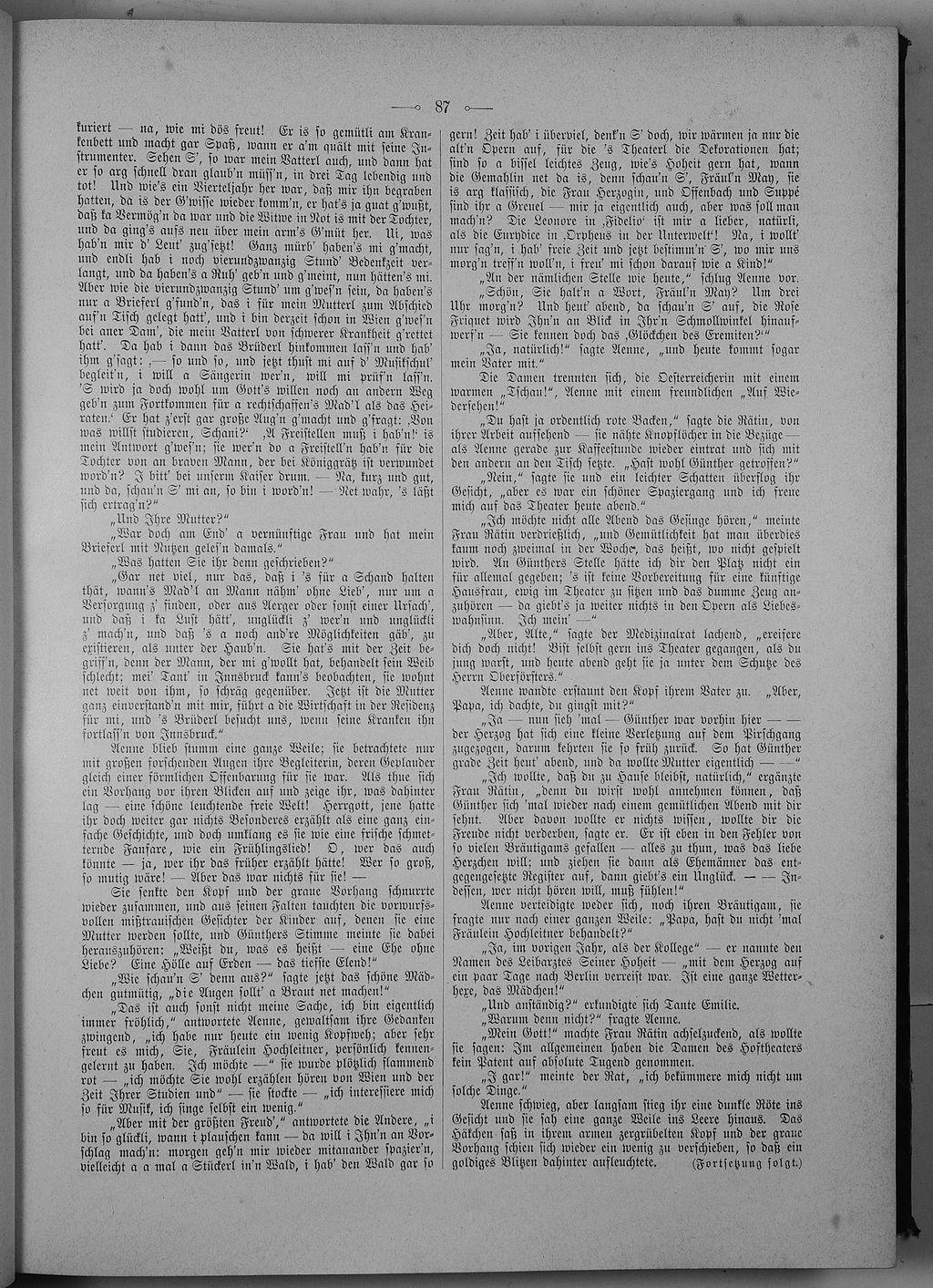| verschiedene: Die Gartenlaube (1897) | |
|
|
kuriert – na, wie mi dös freut! Er is so gemütli am Krankenbett und macht gar Spaß, wann er a’m quält mit seine Instrumenter. Sehen S’, so war mein Vatterl auch, und dann hat er so arg schnell dran glaub’n müss’n, in drei Tag lebendig und tot! Und wie’s ein Vierteljahr her war, daß mir ihn begraben hatten, da is der G’wisse wieder komm’n, er hat’s ja guat g’wußt daß ka Vermög’n da war und die Witwe in Not is mit der Tochter, und da ging’s aufs neu über mein arm’s G’müt her. Ui, was hab’n mir d’ Leut’ zug’setzt! Ganz mürb’ haben’s mi g’macht, und endli hab i noch vierundzwanzig Stund’ Bedenkzeit verlangt, und da haben’s a Ruh’ geb’n und g’meint, nun hätten’s mi. Aber wie die vierundzwanzig Stund’ um g’wes’n sein, da haben’s nur a Brieferl g’fund’n, das i für mein Mutterl zum Abschied auf’n Tisch gelegt hatt’, und i bin derzeit schon in Wien g’wes’n bei aner Dam’, die mein Vatterl von schwerer Krankheit g’rettet hatt’. Da hab i dann das Brüderl hinkommen lass’n und hab’ ihm g’sagt. – so und so, und jetzt thust mi auf d’ Musikschul’ begleit’n, i will a Sängerin wer’n, will mi prüf’n lass’n. ’S wird ja doch wohl um Gott’s willen noch an andern Weg geb’n zum Fortkommen für a rechtschaffen’s Mad’l als das Heiraten.’ Er hat z’erst gar große Aug’n g’macht und g’fragt: „Von was willst studieren, Schani?“ ,A Freistellen muß i hab’n!’ is mein Antwort g’wes’n, sie wer’n do a Freistell’n hab’n für die Tochter von an braven Mann, der bei Königgrätz ist verwundet word’n? I bitt’ bei unserm Kaiser drum. – Na, kurz und gut, und da, schau’n S’ mi an, so bin i word’n! – Net wahr, ’s läßt sich ertrag’n?“
„Und Ihre Mutter?“
„War doch am End’ a vernünftige Frau und hat mein Brieferl mit Nutzen geles’n damals.“
„Was hatten Sie ihr denn geschrieben?“
„Gar net viel, nur das, daß i ’s für a Schand halten thät, wann’s Mad’l an Mann nähm’ ohne Lieb’, nur um a Versorgung z’ finden, oder aus Aerger oder sonst einer Ursach’, und daß i ka Lust hätt’, unglückli z’ wer’n und unglückli z’ mach’n, und daß ’s a noch and’re Möglichkeiten gab’, zu existieren, als unter der Haub’n. Sie hat’s mit der Zeit begriff’n, denn der Mann, der mi g’wollt hat, behandelt sein Weib schlecht; mei’ Tant’ in Innsbruck kann’s beobachten, sie wohnt net weit von ihm, so schräg gegenüber. Jetzt ist die Mutter ganz einverstand’n mit mir, führt a die Wirtschaft in der Residenz für mi, und ’s Brüderl besucht uns, wenn seine Kranken ihn fortlass’n von Innsbruck.“
Aenne blieb stumm eine ganze Weile; sie betrachtete nur mit großen forschenden Augen ihre Begleiterin, deren Geplauder gleich einer förmlichen Offenbarung für sie war. Als thue sich ein Vorhang vor ihren Blicken auf und zeige ihr, was dahinter lag – eine schöne leuchtende freie Welt! Herrgott, jene hatte ihr doch weiter gar nichts Besonderes erzählt als eine ganz einfache Geschichte, und doch umklang es sie wie eine frische schmetternde Fanfare, wie ein Frühlingslied! O, wer das auch könnte – ja, wer ihr das früher erzählt hätte! Wer so groß, so mutig wäre! – Aber das war nichts für sie! –
Sie senkte den Kopf und der graue Vorhang schnurrte wieder zusammen, und aus seinen Falten tauchten die vorwurfsvollen mißtrauischen Gesichter der Kinder auf, denen sie eine Mutter werden sollte, und Günthers Stimme meinte sie dabei herauszuhören „Weißt du, was es heißt – eine Ehe ohne Liebe? Eine Hölle auf Erden – das tiefste Elend!“
„Wie schau’n S’ denn aus?“ sagte jetzt das schöne Mädchen gutmütig, „die Augen sollt’ a Braut net machen!“
„Das ist auch sonst nicht meine Sache, ich bin eigentlich immer fröhlich,“ antwortete Aenne, gewaltsam ihre Gedanken zwingend, „ich habe nur heute ein wenig Kopfweh; aber sehr freut es mich, Sie, Fräulein Hochleitner, persönlich kennen. gelernt zu haben. Ich möchte – sie wurde plötzlich flammeud rot – „ich möchte Sie wohl erzählen hören von Wien in der Zeit Ihrer Studien und – sie stockte – „ich interessiere mich ja für Musik, ich singe selbst ein wenig.“
„Aber mit der größten Freud’, antwortete die Andere, „i bin so glückli, wann i plauschen kann – da will i Ihn’n an Vorschlag mach’n morgen geh’n mir wieder mitanander spazier’n, vielleicht a a mal a Stückerl in’n Wald, i hab’ den Wald gar so gern! Zeit hab’ i überviel, denk’n S’ doch, wir wärmen ja nur die alt’n Opern auf, für die ’s Theater die Dekorationen hat, sind so a bissel leichtes Zeug, wie’s Hoheit gern hat, wann die Gemahlin net da is, denn schau’n S’, Fräul’n May, sie is arg klassisch, die Frau Herzogin und Offenbach und Suppe sind ihr a Greuel – mir ja eigentlich auch, aber was soll man mach’n? Die Leonore in Fidelio’ ist mir a lieber, natürli, als die Eurydice in ‚Orpheus in der Unterwelt’! Na, i wollt’ nur sag’n, i hab’ freie Zeit und jetzt bestimm’n S’, wo mir uns morg’n treff’n woll’n, i freu’ mi schon darauf wie a Kind!“
„An der nämlichen Stelle wie heute,“ schlug Aenne vor.
„Schön, Sie halt’n a Wort, Fräul’n May? Um drei Uhr morg’n? Und heut abend, da schau’n S’ auf, die Rose Friguet wird Ihn’n an Blick in Ihr’n Schmollwinkel hinaufwerf’n – Sie kennen doch das ’Glöckchen des Eremiten’?“
„Ja, natürlich!“ sagte Aenne, „und heute kommt sogar mein Vater mit.
Die Damen trennten sich, die Oesterreicherin mit einem warmen „Tschau!“, Aenne mit einem freundlichen „Auf Wiedersehen!“
„Du hast ja ordentlich rote Backen, sagte die Rätin, von ihrer Arbeit aufsehend – sie nähte Knopflöcher in die Bezüge, als Aenne gerade zur Kaffeestunde wieder eintrat und sich mit den andern an den Tisch setzte. „Hast wohl Günther getroffen?“
„Nein“, sagte sie und ein leichter Schatten überflog ihr Gesicht, „aber es war ein schöner Spaziergang und ich freue mich auf das Theater heute abend.
„Ich möchte nicht alle Abend das Gesinge hören, meinte Frau Rätin verdrießlich, „und Gemütlichkeit hat man überdies kaum noch zweimal in der Wochen, das heißt, wo nicht gespielt wird. An Günthers Stelle hätte ich dir den Platz nicht ein für allemal gegeben ’s ist keine Vorbereitung für eine künftige Hausfrau, ewig im Theater zu sitzen und das dumme Zeug anzuhören – da giebt’s ja weiter nichts in den Opern als Liebeswahnsinn. Ich mein’ –
„Aber, Alte, sagte der Medizinälrat lachend, ereifere dich doch nicht! Bist selbst gern ins Theater gegangen, als du jung warst, und heute abend geht sie ja unter dem Schutze des Herrn Oberförsters.
Aenne wandte erstaunt den Kopf ihrem Vater zu. „Aber, Papa, ich dachte, du gingst mit?“
„Ja – nun sieh ’mal – Günther war vorhin hier – – der Herzog hat sich eine kleine Verletzung auf dem Pirschgang zugezogen, darum kehrten sie so früh zurück. So hat Günther grade Zeit heut’ abend, und da wollte Mutter eigentlich – –“
„Ich wollte, daß du zu Hause bleibst, natürlich, ergänzte Frau Rätin, „denn du wirst wohl annehmen können, daß Günther sich ’mal wieder nach einem gemütlichen Abend mit dir sehnt. Aber davon wollte er nichts wissen, wollte dir die Freude nicht verderben, sagte er. Er ist eben in den Fehler von so vielen Bräutigams gefallen – alles zu thun, was das liebe Herzchen will und ziehen sie dann als Ehemänner das entgegengesetzte Register auf, dann giebt’s ein Unglück. – Indessen, wer nicht hören will, muß fühlen!“
Aenne verteidigte weder sich, noch ihren Bräutigam, sie fragte nur nach einer ganzen Weile. „Papa, hast du nicht ’mal Fräulein Hochleitner behandelt?“
„Ja, im vorigen Jahr, als der Kollege – er nannte den Namen des Leibarztes Seiner Hoheit – „mit dem Herzog auf ein paar Tage nach Berlin verreist war. Ist eine ganze Wetterhexe, das Mädchen!“
„Und anständig?“ erkundigte sich Tante Emilie.
„Warum denn nicht?“ fragte Aenne.
„Mein Gott!“ machte Frau Rätin achselzuckend, als wollte sie sagen: Im allgemeinen haben die Damen des Hoftheaters kein Patent auf absolute Tugend genommen.
„I gar!“ meinte der Rat, „ich bekümmere mich nicht um solche Dinge.“
Aenne schwieg, aber langsam stieg ihr eine dunkle Röte ins Gesicht und sie sah eine ganze Weile ins Leere hinaus. Das Häkchen saß in ihrem armen zergrübelten Kopf und der graue Vorhang schien sich wieder ein wenig zu verschieben so daß ein goldiges Blitzen dahinter aufleuchtete.
verschiedene: Die Gartenlaube (1897). Ernst Keil's Nachfolger, Leipzig 1897, Seite 87. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1897)_087.jpg&oldid=- (Version vom 20.11.2016)