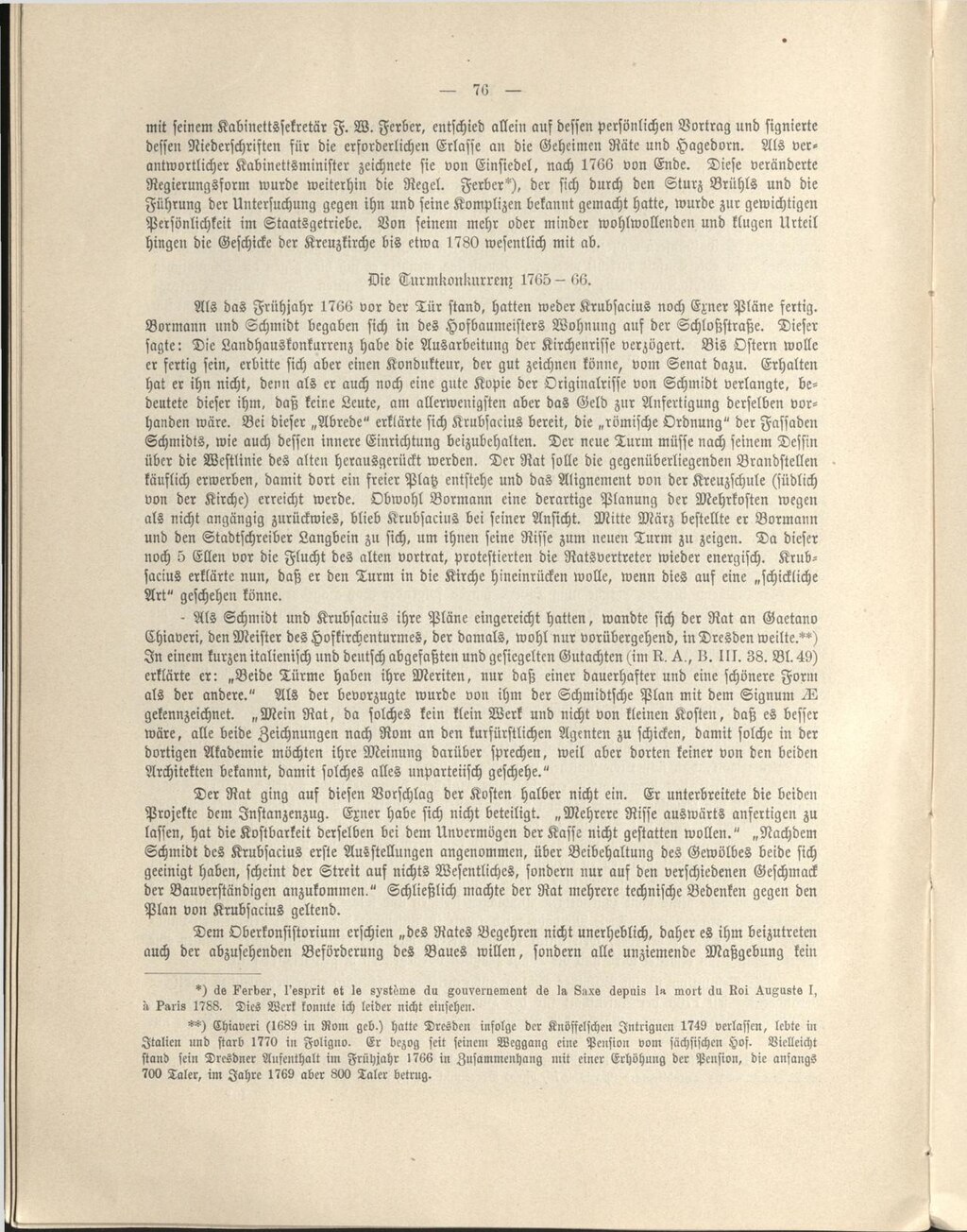mit seinem Kabinettssekretär F. W. Ferber, entschied allein auf dessen persönlichen Vortrag und signierte dessen Niederschriften für die erforderlichen Erlasse an die Geheimen Räte und Hagedorn. Als verantwortlicher Kabinettsminister zeichnete sie von Einsiedel, nach 1766 von Ende. Diese veränderte Regierungsform wurde weiterhin die Regel. Ferber[1], der sich durch den Sturz Brühls und die Führung der Untersuchung gegen ihn und seine Komplizen bekannt gemacht hatte, wurde zur gewichtigen Persönlichkeit im Staatsgetriebe. Von seinem mehr oder minder wohlwollenden und klugen Urteil hingen die Geschicke der Kreuzkirche bis etwa 1780 wesentlich mit ab.
Als das Frühjahr 1766 vor der Tür stand, hatten weder Krubsacius noch Exner Pläne fertig. Bormann und Schmidt begaben sich in des Hofbaumeisters Wohnung auf der Schloßstraße. Dieser sagte: Die Landhauskonkurrenz habe die Ausarbeitung der Kirchenrisse verzögert. Bis Ostern wolle er fertig sein, erbitte sich aber einen Kondukteur, der gut zeichnen könne, vom Senat dazu. Erhalten hat er ihn nicht, denn als er auch noch eine gute Kopie der Originalrisse von Schmidt verlangte, bedeutete dieser ihm, daß keine Leute, am allerwenigsten aber das Geld zur Anfertigung derselben vorhanden wäre. Bei dieser „Abrede“ erklärte sich Krubsacius bereit, die „römische Ordnung“ der Fassaden Schmidts, wie auch dessen innere Einrichtung beizubehalten. Der neue Turm müsse nach seinem Dessin über die Westlinie des alten herausgerückt werden. Der Rat solle die gegenüberliegenden Brandstellen käuflich erwerben, damit dort ein freier Platz entstehe und das Alignement von der Kreuzschule (südlich von der Kirche) erreicht werde. Obwohl Bormann eine derartige Planung der Mehrkosten wegen als nicht angängig zurückwies, blieb Krubsacius bei seiner Ansicht. Mitte März bestellte er Bormann und den Stadtschreiber Langbein zu sich, um ihnen seine Risse zum neuen Turm zu zeigen. Da dieser noch 5 Ellen vor die Flucht des alten vortrat, protestierten die Ratsvertreter wieder energisch. Krubsacius erklärte nun, daß er den Turm in die Kirche hineinrücken wolle, wenn dies auf eine „schickliche Art“ geschehen könne.
Als Schmidt und Krubsacius ihre Pläne eingereicht hatten, wandte sich der Rat an Gaetano Chiaveri, den Meister des Hofkirchenturmes, der damals, wohl nur vorübergehend, in Dresden weilte.[2] In einem kurzen italienisch und deutsch abgefaßten und gesiegelten Gutachten (im R. A., B. III. 38. Bl. 49) erklärte er: „Beide Türme haben ihre Meriten, nur daß einer dauerhafter und eine schönere Form als der andere.“ Als der bevorzugte wurde von ihm der Schmidtsche Plan mit dem Signum Æ gekennzeichnet. „Mein Rat, da solches kein klein Werk und nicht von kleinen Kosten, daß es besser wäre, alle beide Zeichnungen nach Rom an den kurfürstlichen Agenten zu schicken, damit solche in der dortigen Akademie möchten ihre Meinung darüber sprechen, weil aber dorten keiner von den beiden Architekten bekannt, damit solches alles unparteiisch geschehe.“
Der Rat ging auf diesen Vorschlag der Kosten halber nicht ein. Er unterbreitete die beiden Projekte dem Instanzenzug. Exner habe sich nicht beteiligt. „Mehrere Risse auswärts anfertigen zu lassen, hat die Kostbarkeit derselben bei dem Unvermögen der Kasse nicht gestatten wollen.“ „Nachdem Schmidt des Krubsacius erste Ausstellungen angenommen, über Beibehaltung des Gewölbes beide sich geeinigt haben, scheint der Streit auf nichts Wesentliches, sondern nur auf den verschiedenen Geschmack der Bauverständigen anzukommen.“ Schließlich machte der Rat mehrere technische Bedenken gegen den Plan von Krubsacius geltend.
Dem Oberkonsistorium erschien „des Rates Begehren nicht unerheblich, daher es ihm beizutreten
auch der abzusehenden Beförderung des Baues willen, sondern alle unziemende Maßgebung kein
- ↑ de Ferber, l’esprit et le système du gouvernement de la Saxe depuis la mort du Roi Auguste I, à Paris 1788. Dies Werk konnte ich leider nicht einsehen.
- ↑ Chiaveri (1689 in Rom geb.) hatte Dresden infolge der Knöffelschen Intriguen 1749 verlassen, lebte in Italien und starb 1770 in Foligno. Er bezog seit seinem Weggang eine Pension vom sächsischen Hof. Vielleicht stand sein Dresdner Aufenthalt im Frühjahr 1766 in Zusammenhang mit einer Erhöhung der Pension, die anfangs 700 Taler, im Jahre 1769 aber 800 Taler betrug.
Alfred Barth: Zur Baugeschichte der Dresdner Kreuzkirche. C. C. Meinhold & Söhne, Dresden 1907, Seite 76. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Alfred_Barth_Zur_Baugeschichte_der_Dresdner_Kreuzkirche.pdf/84&oldid=- (Version vom 9.4.2024)