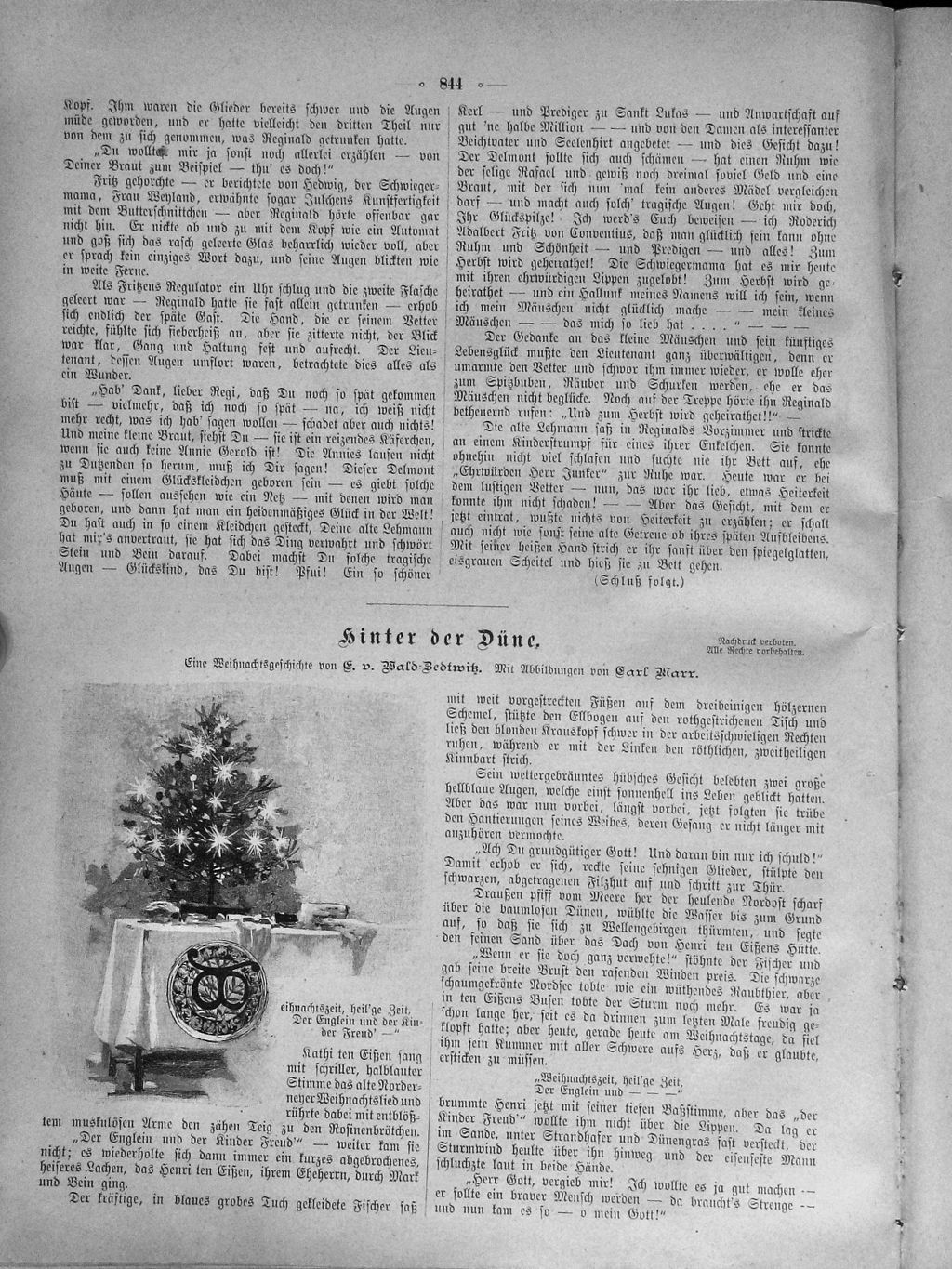| Verschiedene: Die Gartenlaube (1890) | |
|
|
Kopf. Ihm waren die Glieder bereits schwer und die Augen
müde geworden, und er hatte vielleicht den dritten Theil nur
von dem zu sich genommen, was Reginald getrunken hatte.
„Du wolltest mir ja sonst noch allerlei erzählen – von Deiner Braut zum Beispiel ’ thu’ es doch!“
Fritz gehorchte – er berichtete von Hedwig, der Schwiegermama, Frau Weyland, erwähnte sogar Julchens Kunstfertigkeit mit dem Butterschnittchen – aber Reginald hörte offenbar gar nicht hin. Er nickte ab und zu mit dem Kopf wie ein Automat und goß sich das rasch geleerte Glas beharrlich wieder voll, aber er sprach kein einziges Wort dazu, und seine Augen blickten wie in weite Ferne.
Als Fritzens Regulator ein Uhr schlug und die zweite Flasche geleert war – Reginald hatte sie fast allein getrunken – erhob sich endlich der späte Gast. Die Hand, die er seinem Vetter reichte, fühlte sich fieberheiß an, aber sie zitterte nicht, der Blick war klar, Gang und Haltung fest und aufrecht. Der Lieutenant, dessen Augen umflort waren, betrachtete dies alles als ein Wunder.
„Hab’ Dank, lieber Regi, daß Du noch so spät gekommen bist – vielmehr, daß ich noch so spät – na, ich weiß nicht mehr recht, was ich hab’ sagen wollen – schadet aber auch nichts! Und meine kleine Braut, siehst Du – sie ist ein reizendes Käferchen, wenn sie auch keine Annie Gerold ist! Die Annies laufen nicht zu Dutzenden so herum, muß ich Dir sagen! Dieser Delmont muß mit einem Glückskleidchen geboren sein – es giebt solche Häute – sollen aussehen wie ein Netz – mit denen wird man geboren, und dann hat man ein heidenmäßiges Glück in der Welt! Du hast auch in so einem Kleidchen gesteckt, Deine alte Lehmann hat mir’s anvertraut, sie hat sich das Ding verwahrt und schwört Stein und Bein darauf. Dabei machst Du solche tragische Augen – Glückskind, das Du bist! Pfui! Ein so schöner Kerl – und Prediger zu Sankt Lukas – und Anwartschaft auf gut ’ne halbe Million – – und von den Damen als interessanter Beichtvater und Seelenhirt angebetet – und dies Gesicht dazu! Der Delmont sollte sich auch schämen – hat einen Ruhm wie der selige Rafael und gewiß noch dreimal soviel Geld und eine Braut, mit der sich nun ’mal kein anderes Mädel vergleichen darf – und macht auch solch’ tragische Augen! Geht mir doch, Ihr Glückspilze! – Ich werd’s Euch beweisen – ich Roderich Adalbert Fritz von Conventius, daß man glücklich sein kann ohne Ruhm und Schönheit – und Predigen – und alles! Zum Herbst wird geheirathet! Die Schwiegermama hat es mir heute mit ihren ehrwürdigen Lippen zugelobt! Zum Herbst wird geheirathet - und ein Hallunk meines Namens will ich sein, wenn ich mein Mäuschen nicht glücklich mache – – mein kleines Mäuschen – — das mich so lieb hat … “ – – –
Der Gedanke an das kleine Mäuschen und sein künftiges Lebensglück mußte den Lieutenant ganz überwältigen, denn er umarmte den Vetter und schwor ihm immer wieder, er wolle eher zum Spitzbuben, Räuber und Schurken werden, ehe er das Mäuschen nicht beglücke. Noch auf der Treppe hörte ihn Reginald betheuernd rufen: „Und zum Herbst wird geheirathet!!“ –
Die alte Lehmann saß in Reginalds Vorzimmer und strickte an einem Kinderstrumpf für eines ihrer Enkelchen. Sie konnte ohnehin nicht viel schlafen und suchte nie ihr Bett auf, ehe „Ehrwürden Herr Junker“ zur Ruhe war. Heute war er bei dem lustigen Vetter – nun, das war ihr lieb, etwas Heiterkeit konnte ihm nicht schaden! – – Aber das Gesicht, mit dem er jetzt eintrat, wußte nichts von Heiterkeit zu erzählen; er schalt auch nicht wie sonst seine alte Getreue ob ihres späten Aufbleibens. Mit seiner heißen Hand strich er ihr sanft über den spiegelglatten, eisgrauen Scheitel und hieß sie zu Bett gehen.
Alle Rechte vorbehalten.
Hinter der Düne.
„Weihnachtszeit, heil’ge Zeit,
Der Englein und der Kinder Freud’ –“
Kathi ten Eißen sang mit schriller, halblauter Stimme das alte Norderneyer Weihnachtslied und rührte dabei mit entblößtem muskulösen Arme den zähen Teig zu den Rosinenbrötchen.
„Der Englein und der Kinder Freud’“ – weiter kam sie nicht; es wiederholte sich dann immer ein kurzes abgebrochenes, heiseres Lachen, das Henri ten Eißen, ihrem Eheherrn, durch Mark und Bein ging.
Der kräftige, in blaues grobes Tuch gekleidete Fischer saß mit weit vorgestreckten Füßen auf dem dreibeinigen hölzernen Schemel, stützte den Ellbogen auf den rothgestrichenen Tisch und ließ den blonden Krauskopf schwer in der arbeitsschwieligen Rechten ruhen, während er mit der Linken den röthlichen, zweitheiligen Kinnbart strich.
Sein wettergebräuntes hübsches Gesicht belebten zwei große hellblaue Augen, welche einst sonnenhell ins Leben geblickt hatten. Aber das war nun vorbei, längst vorbei, jetzt folgten sie trübe den Hantierungen seines Weibes, deren Gesang er nicht länger mit anzuhören vermochte.
„Ach Du grundgütiger Gott! Und daran bin nur ich schuld!“ Damit erhob er sich, reckte seine sehnigen Glieder, stülpte den schwarzen, abgetragenen Filzhut auf und schritt zur Thür.
Draußen pfiff vom Meere her der heulende Nordost scharf über die baumlosen Dünen, wühlte die Wasser bis zum Grund auf, so daß sie sich zu Wellengebirgen thürmten, und fegte den feinen Sand über das Dach von Henri ten Eißens Hütte.
„Wenn er sie doch ganz verwehte!“ stöhnte der Fischer und gab seine breite Brust den rasenden Winden preis. Die schwarze schaumgekrönte Nordsee tobte wie ein wüthendes Raubthier, aber in ten Eißens Busen tobte der Sturm noch mehr. Es war ja schon lange her, seit es da drinnen zum letzten Male freudig geklopft hatte; aber heute, gerade heute am Weihnachtstage, da fiel ihm sein Kummer mit aller Schwere aufs Herz, daß er glaubte, ersticken zu müssen.
„Weihnachtszeit, heil’ge Zeit,
Der Englein und – – –“
brummte Henri jetzt mit seiner tiefen Baßstimme, aber das „der Kinder Freud’“ wollte ihm nicht über die Lippen. Da lag er im Sande, unter Strandhafer und Dünengras fast versteckt, der Sturmwind heulte über ihn hinweg und der eisenfeste Mann schluchzte laut in beide Hände.
„Herr Gott, vergieb mir! Ich wollte es ja gut machen – er sollte ein braver Mensch werden – da braucht’s Strenge – und nun kam es so – o mein Gott!“
Verschiedene: Die Gartenlaube (1890). Leipzig: Ernst Keil, 1890, Seite 844. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1890)_844.jpg&oldid=- (Version vom 23.1.2023)