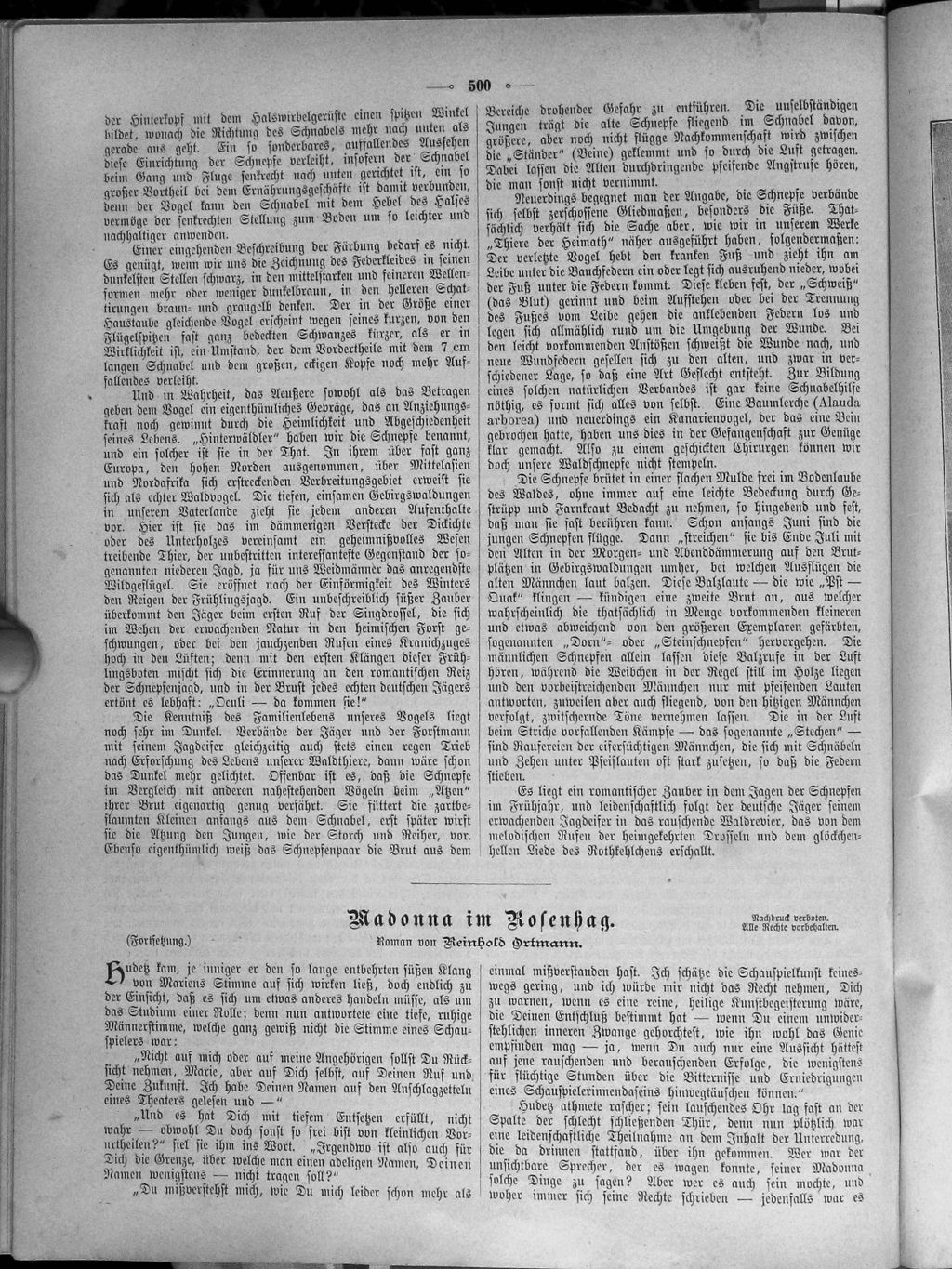| Verschiedene: Die Gartenlaube (1890) | |
|
|
der Hinterkopf mit dem Halswirbelgerüste einen spitzen Winkel
bildet, wonach die Richtung des Schnabels mehr nach unten als
gerade aus geht. Ein so sonderbares, auffallendes Aussehen
diese Einrichtung der Schnepfe verleiht, insofern der Schnabel
beim Gang und Fluge senkrecht nach unten gerichtet ist, ein so
großer Vortheil bei dem Ernährungsgeschäfte ist damit verbunden,
denn der Vogel kann den Schnabel mit dem Hebel des Halses
vermöge der senkrechten Stellung zum Boden um so leichter und
nachhaltiger anwenden.
Einer eingehenden Beschreibung der Färbung bedarf es nicht. Es genügt, wenn wir uns die Zeichnung des Federkleides in seinen dunkelsten Stellen schwarz, in den mittelstarken und feineren Wellenformen mehr oder weniger dunkelbraun, in den helleren Schattirungen braun- und graugelb denken. Der in der Größe einer Haustaube gleichende Vogel erscheint wegen seines kurzen, von den Flügelspitzen fast ganz bedeckten Schwanzes kürzer, als er in Wirklichkeit ist, ein Umstand, der dem Vordertheile mit dem 7 cm langen Schnabel und dem großen, eckigen Kopfe noch mehr Auffallendes verleiht.
Und in Wahrheit, das Aeußere sowohl als das Betragen geben dem Vogel ein eigenthümliches Gepräge, das an Anziehungskraft noch gewinnt durch die Heimlichkeit und Abgeschiedenheit seines Lebens. „Hinterwäldler“ haben wir die Schnepfe benannt, und ein solcher ist sie in der That. In ihrem über fast ganz Europa, den hohen Norden ausgenommen, über Mittelasien und Nordafrika sich erstreckenden Verbreitungsgebiet erweist sie sich als echter Waldvogel. Die tiefen, einsamen Gebirgswaldungen in unserem Vaterlande zieht sie jedem anderen Aufenthalte vor. Hier ist sie das im dämmerigen Verstecke der Dickichte oder des Unterholzes vereinsamt ein geheimnißvolles Wesen treibende Thier, der unbestritten interessanteste Gegenstand der sogenannten niederen Jagd, ja für uns Weidmänner das anregendste Wildgeflügel. Sie eröffnet nach der Einförmigkeit des Winters den Reigen der Frühlingsjagd. Ein unbeschreiblich süßer Zauber überkommt den Jäger beim ersten Ruf der Singdrossel, die sich im Wehen der erwachenden Natur in den heimischen Forst geschwungen, oder bei den jauchzenden Rufen eines Kranichzuges hoch in den Lüften; denn mit den ersten Klängen dieser Frühlingsboten mischt sich die Erinnerung an den romantischen Reiz der Schnepfenjagd, und in der Brust jedes echten deutschen Jägers ertönt es lebhaft. „Oculi – da kommen sie!“
Die Kenntniß des Familienlebens unseres Vogels liegt noch sehr im Dunkel. Verbände der Jäger und der Forstmann mit seinem Jagdeifer gleichzeitig auch stets einen regen Trieb nach Erforschung des Lebens unserer Waldthiere, dann wäre schon das Dunkel mehr gelichtet. Offenbar ist es, daß die Schnepfe im Vergleich mit anderen nahestehenden Vögeln beim „Atzen“ ihrer Brut eigenartig genug verfährt. Sie füttert die zartbeflaumten Kleinen anfangs aus dem Schnabel, erst später wirft sie die Atzung den Jungen, wie der Storch und Reiher, vor. Ebenso eigentümlich weiß das Schnepfenpaar die Brut aus dem Bereiche drohender Gefahr zu entführen. Die unselbständigen Jungen trägt die alte Schnepfe fliegend im Schnabel davon, größere, aber noch nicht flügge Nachkommenschaft wird zwischen die „Ständer“ (Beine) geklemmt und so durch die Luft getragen. Dabei lassen die Alten durchdringende pfeifende Angstrufe hören, die man sonst nicht vernimmt.
Neuerdings begegnet man der Angabe, die Schnepfe verbände sich selbst zerschossene Gliedmaßen, besonders die Füße. Thatsächlich verhält sich die Sache aber, wie wir in unserem Werke „Thiere der Heimath“ näher ausgeführt haben, folgendermaßen: Der verletzte Vogel hebt den kranken Fuß und zieht ihn am Leibe unter die Bauchfedern ein oder legt sich ausruhend nieder, wobei der Fuß unter die Federn kommt. Diese kleben fest, der „Schweiß“ (das Blut) gerinnt und beim Aufstehen oder bei der Trennung des Fußes vom Leibe gehen die anklebenden Federn los und legen sich allmählich rund um die Umgebung der Wunde. Bei den leicht vorkommenden Anstößen schweißt die Wunde nach, und neue Wundfedern gesellen sich zu den alten, und zwar in verschiedener Lage, so daß eine Art Geflecht entsteht. Zur Bildung eines solchen natürlichen Verbandes ist gar keine Schnabelhilfe nöthig, es formt sich alles von selbst. Eine Baumlerche (Alauda arborea) und neuerdings ein Kanarienvogel, der das eine Bein gebrochen hatte, haben uns dies in der Gefangenschaft zur Genüge klar gemacht. Also zu einem geschickten Chirurgen können wir doch unsere Waldschnepfe nicht stempeln.
Die Schnepfe brütet in einer flachen Mulde frei im Bodenlaube des Waldes, ohne immer auf eine leichte Bedeckung durch Gestrüpp und Farnkraut Bedacht zu nehmen, so hingebend und fest, daß man sie fast berühren kann. Schon anfangs Juni sind die jungen Schnepfen flügge. Dann „streichen“ sie bis Ende Juli mit der Alten in der Morgen- und Abenddämmerung auf den Brutplätzen in Gebirgswaldungen umher, bei welchen Ausflügen die alten Männchen laut balzen. Diese Balzlaute – die wie „Pst – Quak“ klingen – kündigen eine zweite Brut an, aus welcher wahrscheinlich die thatsächlich in Menge vorkommenden kleineren und etwas abweichend von den größeren Exemplaren gefärbten, sogenannten „Dorn“- oder „Steinschnepfen“ hervorgehen. Die männlichen Schnepfen allein lassen diese Balzrufe in der Luft hören, während die Weibchen in der Regel still im Holze liegen und den vorbeistreichenden Männchen nur mit pfeifenden Lauten antworten, zuweilen aber auch fliegend, von den hitzigen Männchen verfolgt, zwitschernde Töne vernehmen lassen. Die in der Luft beim Striche vorfallenden Kämpfe – das sogenannte „Stechen“ – sind Raufereien der eifersüchtigen Männchen, die sich mit Schnäbeln und Zehen unter Pfeiflauten oft stark zusetzen, so daß die Federn stieben.
Es liegt ein romantischer Zauber in dem Jagen der Schnepfen im Frühjahr, und leidenschaftlich folgt der deutsche Jäger seinem erwachenden Jagdeifer in das rauschende Waldrevier, das von dem melodischen Rufen der heimgekehrten Drosseln und dem glöckchenhellen Liede des Rothkehlchens erschallt.
Madonna im Rosenhag.
Hudetz kam, je inniger er den so lange entbehrten süßen Klang
von Mariens Stimme auf sich wirken ließ, doch endlich zu
der Einsicht, daß es sich um etwas anderes handeln müsse, als um
das Studium einer Rolle; denn nun antwortete eine tiefe, ruhige
Männerstimme, welche ganz gewiß nicht die Stimme eines Schauspielers
war:
„Nicht auf mich oder auf meine Angehörigen sollst Du Rücksicht nehmen, Marie, aber auf Dich selbst, auf Deinen Ruf und Deine Zukunft. Ich habe Deinen Namen auf den Anschlagzetteln eines Theaters gelesen und –“
„Und es hat Dich mit tiefem Entsetzen erfüllt, nicht wahr – obwohl Du doch sonst so frei bist von kleinlichen Vorurtheilen?“ fiel sie ihm ins Wort. „Irgendwo ist also auch für Dich die Grenze, über welche man einen adeligen Namen, Deinen Namen wenigstens – nicht tragen soll?“
„Du mißverstehst mich, wie Du mich leider schon mehr als einmal mißverstanden hast. Ich schätze die Schauspielkunst keineswegs gering, und ich würde mir nicht das Recht nehmen, Dich zu warnen, wenn es eine reine, heilige Kunstbegeisterung wäre, die Deinen Entschluß bestimmt hat – wenn Du einem unwiderstehlichen inneren Zwange gehorchtest, wie ihn wohl das Genie empfinden mag – ja, wenn Du auch nur eine Aussicht hättest auf jene rauschenden und berauschenden Erfolge, die wenigstens für flüchtige Stunden über die Bitternisse und Erniedrigungen eines Schauspielerinnendaseins hinwegtäuschen können.“
Hudetz athmete rascher; sein lauschendes Ohr lag fast an der Spalte der schlecht schließenden Thür, denn nun plötzlich war eine leidenschaftliche Theilnahme an dem Inhalt der Unterredung, da drinnen stattfand, über ihn gekommen. Wer war der unsichtbare Sprecher, der es wagen konnte, seiner Madonna solche Dinge zu sagen? Aber wer es auch sein mochte, und woher immer sich seine Rechte schrieben – jedenfalls war es
Verschiedene: Die Gartenlaube (1890). Leipzig: Ernst Keil, 1890, Seite 500. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1890)_500.jpg&oldid=- (Version vom 20.8.2021)