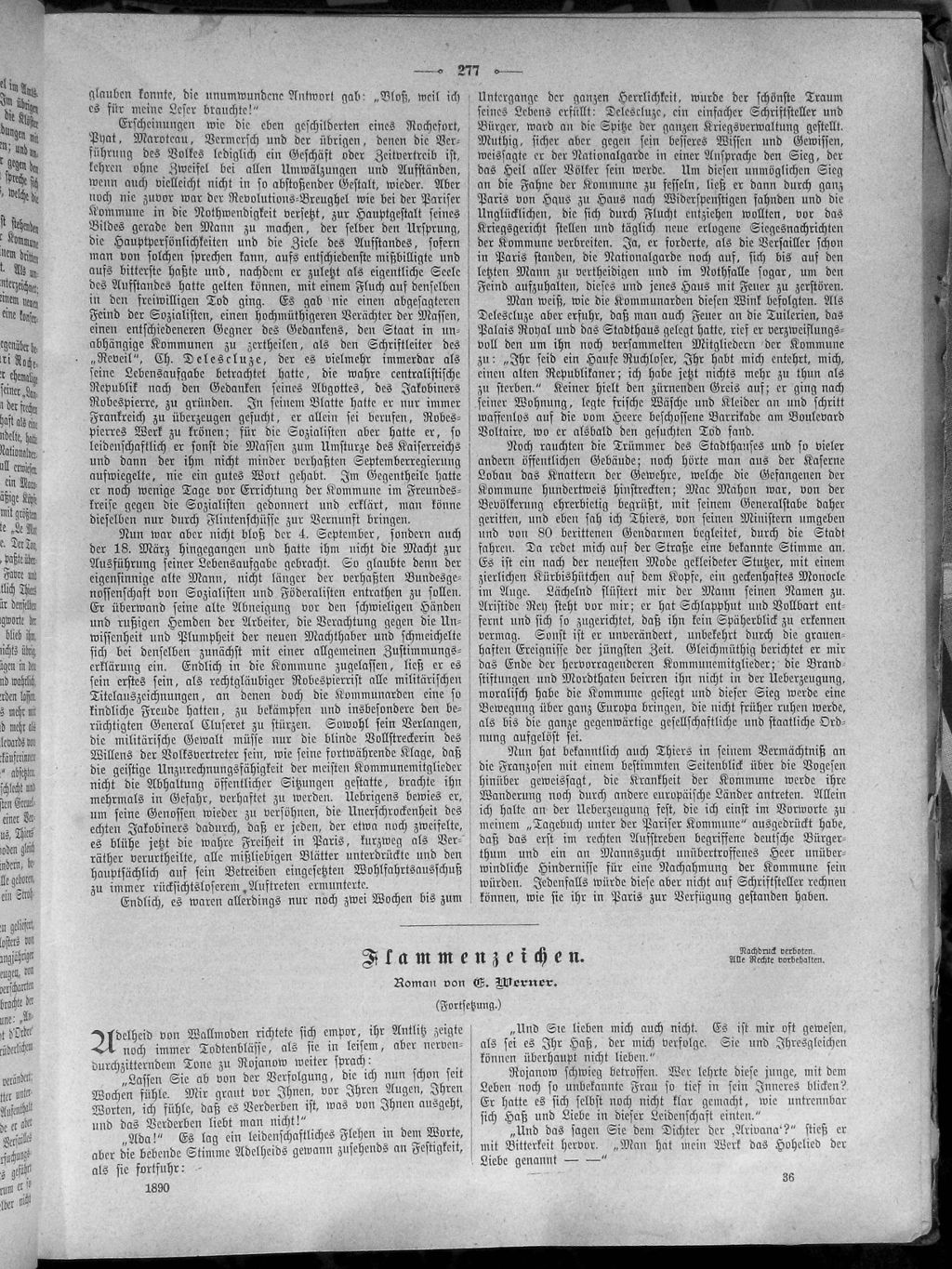| Verschiedene: Die Gartenlaube (1890) | |
|
|
glauben konnte, die unumwundene Antwort gab: „Bloß, weil ich
es für meine Leser brauchte!“
Erscheinungen wie die eben geschilderten eines Rochefort, Pyat, Maroteau, Vermersch und der übrigen, denen die Verführung des Volkes lediglich ein Geschäft oder Zeitvertreib ist, kehren ohne Zweifel bei allen Umwälzungen und Aufständen, wenn auch vielleicht nicht in so abstoßender Gestalt, wieder. Aber noch nie zuvor war der Revolutions-Breughel wie bei der Pariser Kommune in die Nothwendigkeit versetzt, zur Hauptgestalt seines Bildes gerade den Mann zu machen, der selber den Ursprung, die Hauptpersönlichkeiten und die Ziele des Aufstandes, sofern man von solchen sprechen kann, aufs entschiedenste mißbilligte und aufs bitterste haßte und, nachdem er zuletzt als eigentliche Seele des Aufstandes hatte gelten können, mit einem Fluch auf denselben in den freiwilligen Tod ging. Es gab nie einen abgesagteren Feind der Sozialisten, einen hochmüthigeren Verächter der Massen, einen entschiedeneren Gegner des Gedankens, den Staat in unabhängige Kommunen zu zertheilen, als den Schriftleiter des „Reveil“, Ch. Delescluze, der es vielmehr immerdar als seine Lebensaufgabe betrachtet hatte, die wahre centralistische Republik nach den Gedanken seines Abgottes, des Jakobiners Robespierre, zu gründen. In seinem Blatte hatte er nur immer Frankreich zu überzeugen gesucht, er allein sei berufen, Robespierres Werk zu krönen; für die Sozialisten aber hatte er, so leidenschaftlich er sonst die Massen zum Umsturze des Kaiserreichs und dann der ihm nicht minder verhaßten Septemberregierung aufwiegelte, nie ein gutes Wort gehabt. Im Gegentheile hatte er noch wenige Tage vor Errichtung der Kommune im Freundeskreise gegen die Sozialisten gedonnert und erklärt, man könne dieselben nur durch Flintenschüsse zur Vernunft bringen.
Nun war aber nicht bloß der 4. September, sondern auch der 10. März hingegangen und hatte ihm nicht die Macht zur Ausführung seiner Lebensaufgabe gebracht. So glaubte denn der eigensinnige alte Mann, nicht länger der verhaßten Bundesgenossenschaft von Sozialisten und Föderalisten entrathen zu sollen. Er überwand seine alte Abneigung vor den schwieligen Händen und rußigen Hemden der Arbeiter, die Verachtung gegen die Unwissenheit und Plumpheit der neuen Machthaber und schmeichelte sich bei denselben zunächst mit einer allgemeinen Zustimmungserklärung ein. Endlich in die Kommune zugelassen, ließ er es sein erstes sein, als rechtgläubiger Robespierrist alle militärischen Titelauszeichnungen, an denen doch die Kommunarden eine so kindliche Freude hatten, zu bekämpfen und insbesondere den berüchtigten General Cluseret zu stürzen. Sowohl sein Verlangen, die militärische Gewalt müsse nur die blinde Vollstreckerin des Willens der Volksvertreter sein, wie seine fortwährende Klage, daß die geistige Unzurechnungsfähigkeit der meisten Kommunemitglieder nicht die Abhaltung öffentlicher Sitzungen gestatte, brachte ihn mehrmals in Gefahr, verhaftet zu werden. Uebrigens bewies er, um seine Genossen wieder zu versöhnen, die Unerschrockenheit des echten Jakobiners dadurch, daß er jeden, der etwa noch zweifelte, es blühe jetzt die wahre Freiheit in Paris, kurzweg als Verräther verurtheilte, alle mißliebigen Blätter unterdrückte und den hauptsächlich auf sein Betreiben eingesetzten Wohlfahrtsausschuß zu immer rücksichtsloserem Auftreten ermunterte.
Endlich, es waren allerdings nur noch zwei Wochen bis zum Untergange der ganzen Herrlichkeit, wurde der schönste Traum seines Lebens erfüllt: Delescluze, ein einfacher Schriftsteller und Bürger, ward an die Spitze der ganzen Kriegsverwaltung gestellt. Muthig, sicher aber gegen sein besseres Wissen und Gewissen, weissagte er der Nationalgarde in einer Ansprache den Sieg, der das Heil aller Völker sein werde. Um diesen unmöglichen Sieg an die Fahne der Kommune zu fesseln, ließ er dann durch ganz Paris von Haus zu Haus nach Widerspenstigen fahnden und die Unglücklichen, die sich durch Flucht entziehen wollten, vor das Kriegsgericht stellen und täglich neue erlogene Siegesnachrichten der Kommune verbreiten. Ja, er forderte, als die Versailler schon in Paris standen, die Nationalgarde noch auf, sich bis auf den letzten Mann zu vertheidigen und im Nothfalle sogar, um den Feind aufzuhalten, dieses und jenes Haus mit Feuer zu zerstören.
Man weiß, wie die Kommunarden diesen Wink befolgten. Als Delescluze aber erfuhr, daß man auch Feuer an die Tuilerien, das Palais Royal und das Stadthaus gelegt hatte, rief er verzweiflungsvoll den um ihn noch versammelten Mitgliedern der Kommune zu: „Ihr seid ein Haufe Ruchloser, Ihr habt mich entehrt, mich, einen alten Republikaner; ich habe jetzt nichts mehr zu thun als zu sterben.“ Keiner hielt den zürnenden Greis auf; er ging nach seiner Wohnung, legte frische Wäsche und Kleider an und schritt waffenlos auf die vom Heere beschossene Barrikade am Boulevard Voltaire, wo er alsbald den gesuchten Tod fand.
Noch rauchten die Trümmer des Stadthauses und so vieler andern öffentlichen Gebäude; noch hörte man aus der Kaserne Loban das Knattern der Gewehre, welche die Gefangenen der Kommune hundertweis hinstreckten; Mac Mahon war, von der Bevölkerung ehrerbietig begrüßt, mit seinem Generalstabe daher geritten, und eben sah ich Thiers, von seinen Ministern umgeben und von 80 berittenen Gendarmen begleitet, durch die Stadt fahren. Da redet mich auf der Straße eine bekannte Stimme an. Es ist ein nach der neuesten Mode gekleideter Stutzer, mit einem zierlichen Kürbishütchen auf dem Kopfe, ein geckenhaftes Monocle im Auge. Lächelnd flüstert mir der Mann seinen Namen zu. Aristide Rey steht vor mir; er hat Schlapphut und Vollbart entfernt und sich so zugerichtet, daß ihn kein Späherblick zu erkennen vermag. Sonst ist er unverändert, unbekehrt durch die grauenhaften Ereignisse der jüngsten Zeit. Gleichmüthig berichtet er mir das Ende der hervorragenderen Kommunemitglieder; die Brandstiftungen und Mordthaten beirren ihn nicht in der Ueberzeugung, moralisch habe die Kommune gesiegt und dieser Sieg werde eine Bewegung über ganz Europa bringen, die nicht früher ruhen werde, als bis die ganze gegenwärtige gesellschaftliche und staatliche Ordnung aufgelöst sei.
Nun hat bekanntlich auch Thiers in seinem Vermächtniß an die Franzosen mit einem bestimmten Seitenblick über die Vogesen hinüber geweissagt, die Krankheit der Kommune werde ihre Wanderung noch durch andere europäische Länder antreten. Allein ich halte an der Ueberzeugung fest, die ich einst im Vorworte zu meinem „Tagebuch unter der Pariser Kommune“ ausgedrückt habe, daß das erst im rechten Aufstreben begriffene deutsche Bürgerthum und ein an Mannszucht unübertroffenes Heer unüberwindliche Hindernisse für eine Nachahmung der Kommune sein würden. Jedenfalls würde diese aber nicht auf Schriftsteller rechnen können, wie sie ihr in Paris zur Verfügung gestanden haben.
Adelheid von Wallmoden richtete sich empor, ihr Antlitz zeigte
noch immer Todtenblässe, als sie in leisem, aber nervendurchzitterndem
Tone zu Rojanow weiter sprach:
„Lassen Sie ab von der Verfolgung, die ich nun schon seit Wochen fühle. Mir graut vor Ihnen, vor Ihren Augen, Ihren Worten, ich fühle, daß es Verderben ist, was von Ihnen ausgeht, und das Verderben liebt man nicht!“
„Ada!“ Es lag ein leidenschaftliches Flehen in dem Worte, aber die bebende Stimme Adelheids gewann zusehends an Festigkeit, als sie fortfuhr:
„Und Sie lieben mich auch nicht. Es ist mir oft gewesen, als sei es Ihr Haß, der mich verfolge. Sie und Ihresgleichen können überhaupt nicht lieben.“
Rojanow schwieg betroffen. Wer lehrte diese junge, mit dem Leben noch so unbekannte Frau so tief in sein Inneres blicken? Er hatte es sich selbst noch nicht klar gemacht, wie untrennbar sich Haß und Liebe in dieser Leidenschaft einten.
„Und das sagen Sie dem Dichter der ‚Arivana‘?“ stieß er mit Bitterkeit hervor. „Man hat mein Werk das Hohelied der Liebe genannt – –“
Verschiedene: Die Gartenlaube (1890). Leipzig: Ernst Keil, 1890, Seite 277. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1890)_277.jpg&oldid=- (Version vom 19.5.2021)