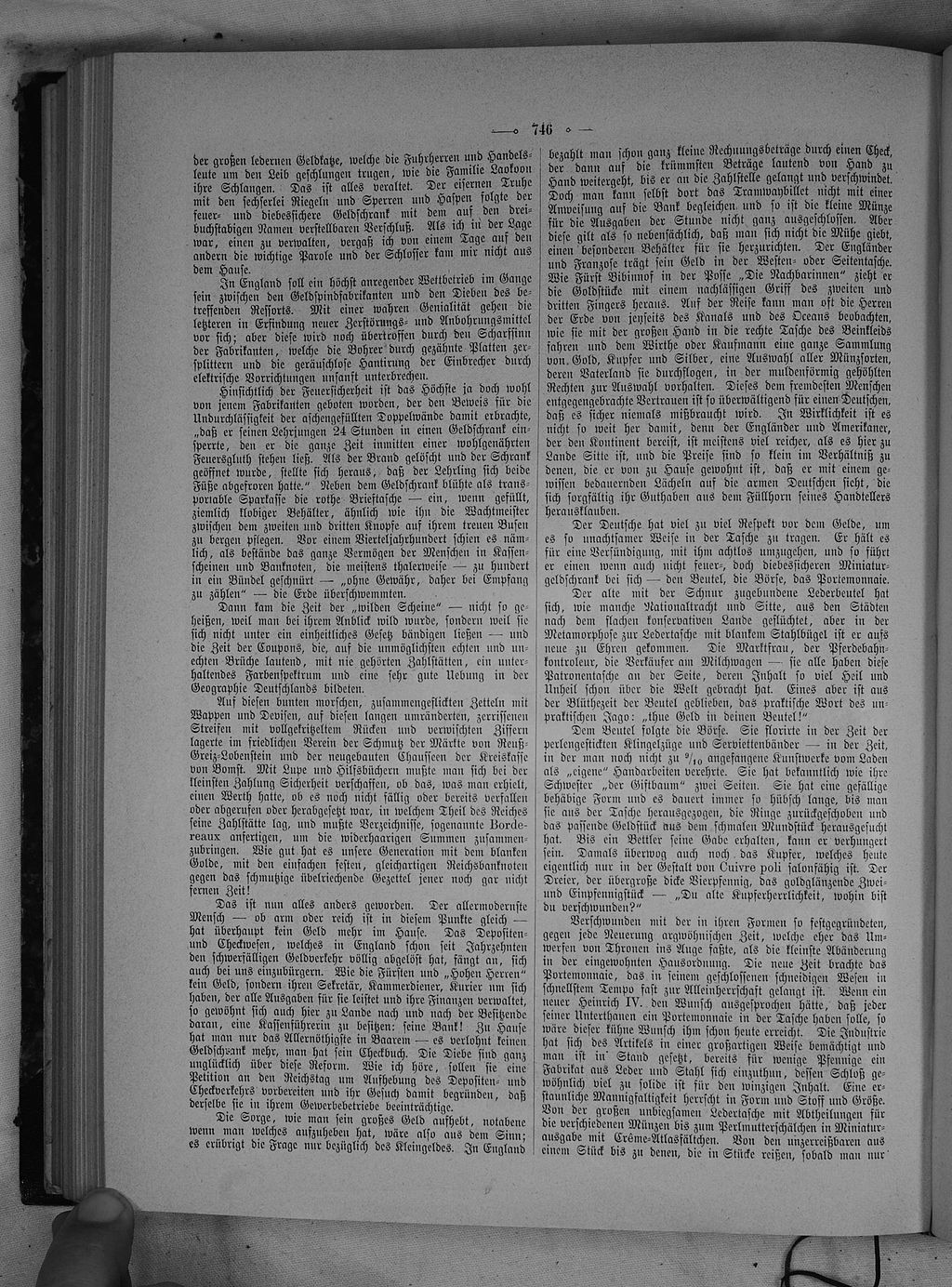| Verschiedene: Die Gartenlaube (1888) | |
|
|
der großen ledernen Geldkatze, welche die Fuhrherren und Handelsleute um den Leib geschlungen trugen, wie die Familie Laokoon ihre Schlangen. Das ist alles veraltet. Der eisernen Truhe mit den sechserlei Riegeln und Sperren und Haspen folgte der feuer- und diebessichere Geldschrank mit dem auf den dreibuchstabigen Namen verstellbaren Verschluß. Als ich in der Lage war, einen zu verwalten, vergaß ich von einem Tage auf den andern die wichtige Parole und der Schlosser kam mir nicht aus dem Hause.
In England soll ein höchst anregender Wettbetrieb im Gange sein zwischen den Geldspindfabrikanten und den Dieben des betreffenden Ressorts. Mit einer wahren Genialität gehen die letzteren in Erfindung neuer Zerstörungs- und Anbohrungsmittel vor sich; aber diese wird noch übertroffen durch den Scharfsinn der Fabrikanten, welche die Bohrer durch gezähnte Platten zersplittern und die geräuschlose Hantirung der Einbrecher durch elektrische Vorrichtungen unsanft unterbrechen.
Hinsichtlich der Feuersicherheit ist das Höchste ja doch wohl von jenem Fabrikanten geboten worden, der den Beweis für die Undurchlässigkeit der aschengefüllten Doppelwände damit erbrachte, „daß er seinen Lehrjungen 24 Stunden in einen Geldschrank einsperrte, den er die ganze Zeit inmitten einer wohlgenährten Feuersgluth stehen ließ. Als der Brand gelöscht und der Schrank geöffnet wurde, stellte sich heraus, daß der Lehrling sich beide Füße abgefroren hatte.“ Neben dem Geldschrank blühte als transportable Sparkasse die rothe Brieftasche – ein, wenn gefüllt, ziemlich klobiger Behälter, ähnlich wie ihn die Wachtmeister zwischen dem zweiten und dritten Knopfe auf ihrem treuen Busen zu bergen pflegen. Vor einem Vierteljahrhundert schien es nämlich, als bestände das ganze Vermögen der Menschen in Kassenscheinen und Banknoten, die meistens thalerweise – zu hundert in ein Bündel geschnürt – „ohne Gewähr, daher bei Empfang zu zählen“ – die Erde überschwemmten.
Dann kam die Zeit der „wilden Scheine“ – nicht so geheißen, weil man bei ihrem Anblick wild wurde, sondern weil sie sich nicht unter ein einheitliches Gesetz bändigen ließen – und die Zeit der Coupons, die, auf die unmöglichsten echten und unechten Brüche lautend, mit nie gehörten Zahlstätten, ein unterhaltendes Farbenspektrum und eine sehr gute Uebung in der Geographie Deutschlands bildeten.
Auf diesen bunten morschen, zusammengeflickten Zetteln mit Wappen und Devisen, auf diesen langen umränderten, zerrissenen Streifen mit vollgekritzeltem Rücken und verwischten Ziffern lagerte im friedlichen Verein der Schmutz der Märkte von Reuß-Greiz-Lobenstein und der neugebauten Chausseen der Kreiskasse von Bomst. Mit Lupe und Hilfsbüchern mußte man sich bei der kleinsten Zahlung Sicherheit verschaffen, ob das, was man erhielt, einen Werth hatte, ob es noch nicht fällig oder bereits verfallen oder abgerufen oder herabgesetzt war, in welchem Theil des Reiches seine Zahlstätte lag, und mußte Verzeichnisse, sogenannte Bordereaux anfertigen, um die widerhaarigen Summen zusammenzubringen. Wie gut hat es unsere Generation mit dem blanken Golde, mit den einfachen festen, gleichartigen Reichsbanknoten gegen das schmutzige übelriechende Gezettel jener noch gar nicht fernen Zeit!
Das ist nun alles anders geworden. Der allermodernste Mensch– ob arm oder reich ist in diesem Punkte gleich – hat überhaupt kein Geld mehr im Hause. Das Depositen- und Checkwesen, welches in England schon seit Jahrzehnten den schwerfälligen Geldverkehr völlig abgelöst hat, fängt an, sich auch bei uns einzubürgern. Wie die Fürsten und „Hohen Herren“ kein Geld, sondern ihren Sekretär, Kammerdiener, Kurier um sich haben, der alle Ausgaben für sie leistet und ihre Finanzen verwaltet, so gewöhnt sich auch hier zu Lande nach und nach der Besitzende daran, eine Kassenführerin zu besitzen: seine Bank! Zu Hause hat man nur das Allernöthigste in Baarem – es verlohnt keinen Geldschrank mehr, man hat sein Checkbuch. Die Diebe sind ganz unglücklich über diese Reform. Wie ich höre, sollen sie eine Petition an den Reichstag um Aufhebung des Depositen- und Checkverkehrs vorbereiten und ihr Gesuch damit begründen, daß derselbe sie in ihrem Gewerbebetriebe beeinträchtige.
Die Sorge, wie man sein großes Geld aufhebt, notabene wenn man welches aufzuheben hat, wäre also aus dem Sinn; es erübrigt die Frage nur bezüglich des Kleingeldes. In England bezahlt man schon ganz kleine Rechnungsbeträge durch einen Check, der dann auf die krümmsten Beträge lautend von Hand zu Hand weitergeht, bis er an die Zahlstelle gelangt und verschwindet. Doch man kann selbst dort das Tramwaybillet nicht mit einer Anweisung auf die Bank begleichen, und so ist die kleine Münze für die Ausgaben der Stunde nicht ganz ausgeschlossen. Aber diese gilt als so nebensächlich, daß man sich nicht die Mühe giebt, einen besonderen Behälter für sie herzurichten. Der Engländer und Franzose trägt sein Geld in der Westen- oder Seitentasche. Wie Fürst Bibinnof in der Posse „Die Nachbarinnen“ zieht er die Goldstücke mit einem nachlässigen Griff des zweiten und dritten Fingers heraus. Auf der Reise kann man oft die Herren der Erde von jenseits des Kanals und des Oceans beobachten, wie sie mit der großen Hand in die rechte Tasche des Beinkleids fahren und dem Wirthe oder Kaufmann eine ganze Sammlung von Gold, Kupfer und Silber, eine Auswahl aller Münzsorten, deren Vaterland sie durchflogen, in der muldenförmig gehöhlten Rechten zur Auswahl vorhalten. Dieses dem fremdesten Menschen entgegengebrachte Vertrauen ist so überwältigend für einen Deutschen, daß es sicher niemals mißbraucht wird. In Wirklichkeit ist es nicht so weit her damit, denn der Engländer und Amerikaner, der den Kontinent bereist, ist meistens viel reicher, als es hier zu Lande Sitte ist, und die Preise sind so klein im Verhältniß zu denen, die er von zu Hause gewohnt ist, daß er mit einem gewissen bedauernden Lächeln auf die armen Deutschen sieht, die sich sorgfältig ihr Guthaben aus dem Füllhorn seines Handtellers herausklauben.
Der Deutsche hat viel zu viel Respekt vor dem Gelde, um es so unachtsamer Weise in der Tasche zu tragen. Er hält es für eine Versündigung, mit ihm achtlos umzugehen, und so führt er einen wenn auch nicht feuer-, doch diebessicheren Miniaturgeldschrank bei sich – den Beutel, die Börse, das Portemonnaie.
Der alte mit der Schnur zugebundene Lederbeutel hat sich, wie manche Nationaltracht und Sitte, aus den Städten nach dem flachen konservativen Lande geflüchtet, aber in der Metamorphose zur Ledertasche mit blankem Stahlbügel ist er aufs neue zu Ehren gekommen. Die Marktfrau, der Pferdebahnkontroleur, die Verkäufer am Milchwagen – sie alle haben diese Patronentasche an der Seite, deren Inhalt so viel Heil und Unheil schon über die Welt gebracht hat. Eines aber ist aus der Blüthezeit der Beutel geblieben, das praktische Wort des unpraktischen Jago: „thue Geld in deinen Beutel!“
Dem Beutel folgte die Börse. Sie florirte in der Zeit der perlengestickten Klingelzüge und Serviettenbänder – in der Zeit, in der man noch nicht zu 9/10 angefangene Kunstwerke vom Laden als „eigene“ Handarbeiten verehrte. Sie hat bekanntlich wie ihre Schwester „der Giftbaum“ zwei Seiten. Sie hat eine gefällige behäbige Form und es dauert immer so hübsch lange, bis man sie aus der Tasche herausgezogen, die Ringe zurückgeschoben und das passende Geldstück aus dem schmalen Mundstück herausgesucht hat. Bis ein Bettler seine Gabe erhalten, kann er verhungert sein. Damals überwog auch noch das Kupfer, welches heute eigentlich nur in der Gestalt von Cuivre poli salonfähig ist. Der Dreier, der übergroße dicke Bierpfennig, das goldglänzende Zwei- und Einpfennigstück – „Du alte Kupferherrlichkeit, wohin bist du verschwunden?“
Verschwunden mit der in ihren Formen so festgegründeten, gegen jede Neuerung argwöhnischen Zeit, welche eher das Umwerfen von Thronen ins Auge faßte, als die kleinste Abänderung in der eingewohnten Hausordnung. Die neue Zeit brachte das Portemonnaie, das in seinem geschlossenen schneidigen Wesen in schnellstem Tempo fast zur Alleinherrschaft gelangt ist. Wenn ein neuer Heinrich IV. den Wunsch ausgesprochen hätte, daß jeder seiner Unterthanen ein Portemonnaie in der Tasche haben solle, so wäre dieser kühne Wunsch ihm schon heute erreicht. Die Industrie hat sich des Artikels in einer großartigen Weise bemächtigt und man ist in Stand gesetzt, bereits für wenige Pfennige ein Fabrikat aus Leder und Stahl sich einzuthun, dessen Schloß gewöhnlich viel zu solide ist für den winzigen Inhalt. Eine erstaunliche Mannigfaltigkeit herrscht in Form und Stoff und Größe. Von der großen unbiegsamen Ledertasche mit Abtheilungen für die verschiedenen Münzen bis zum Perlmutterschälchen in Miniaturausgabe mit Crême-Atlasfältchen. Von den unzerreißbaren aus einem Stück bis zu denen, die in Stücke reißen, sobald man nur
Verschiedene: Die Gartenlaube (1888). Leipzig: Ernst Keil, 1888, Seite 746. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1888)_746.jpg&oldid=- (Version vom 24.3.2018)