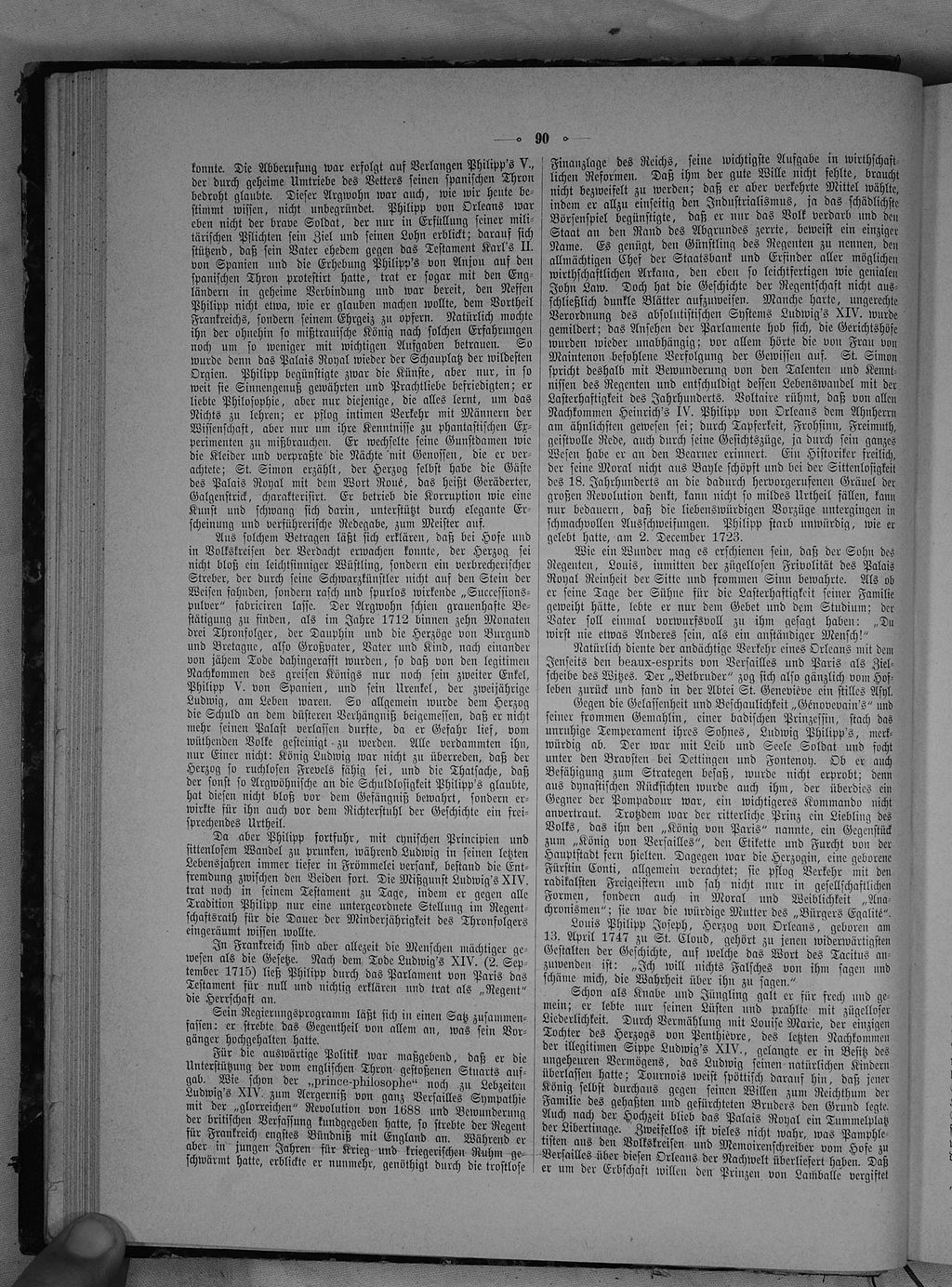| Verschiedene: Die Gartenlaube (1888) | |
|
|
konnte. Die Abberufung war erfolgt auf Verlangen Philipp’s V., der durch geheime Umtriebe des Vetters seinen spanischen Thron bedroht glaubte. Dieser Argwohn war auch, wie wir heute bestimmt wissen, nicht unbegründet. Philipp von Orleans war eben nicht der brave Soldat, der nur in Erfüllung seiner militärischen Pflichten sein Ziel und seinen Lohn erblickt; darauf sich stützend, daß sein Vater ehedem gegen das Testament Karl’s II. von Spanien und die Erhebung Philipp’s von Anjou auf den spanischen Thron protestirt hatte, trat er sogar mit den Engländern in geheime Verbindung und war bereit, den Neffen Philipp nicht etwa, wie er glauben machen wollte, dem Vortheil Frankreichs, sondern seinem Ehrgeiz zu opfern. Natürlich mochte ihn der ohnehin so mißtrauische König nach solchen Erfahrungen noch um so weniger mit wichtigen Aufgaben betrauen. So wurde denn das Palais Royal wieder der Schauplatz der wildesten Orgien. Philipp begünstigte zwar die Künste, aber nur, in so weit sie Sinnengenuß gewährten und Prachtliebe befriedigten, er liebte Philosophie, aber nur diejenige, die alles lernt, um das Nichts zu lehren; er pflog intimen Verkehr mit Männern der Wissenschaft, aber nur um ihre Kenntnisse zu phantastischen Experimenten zu mißbrauchen. Er wechselte seine Gunstdamen wie die Kleider und verpraßte die Nächte mit Genossen, die er verachtete; St. Simon erzählt, der Herzog selbst habe die Gäste des Palais Royal mit dem Wort Roué, das heißt Geräderter, Galgenstrick, charakterisirt. Er betrieb die Korruption wie eine Kunst und schwang sich darin, unterstützt durch elegante Erscheinung und verführerische Redegabe, zum Meister auf.
Aus solchem Betragen läßt sich erklären, daß bei Hofe und in Volkskreisen der Verdacht erwachen konnte, der Herzog sei nicht bloß ein leichtsinniger Wüstling, sondern ein verbrecherischer Streber, der durch seine Schwarzkünstler nicht auf den Stein der Weisen fahnden, sondern rasch und spurlos wirkende „Successionspulver“ fabriciren lasse. Der Argwohn schien grauenhafte Bestätigung zu finden, als im Jahre 1712 binnen zehn Monaten drei Thronfolger, der Dauphin und die Herzöge von Burgund und Bretagne, also Großvater, Vater und Kind, nach einander von jähem Tode dahingerafft wurden, so daß von den legitimen Nachkommen des greisen Königs nur noch sein zweiter Enkel, Philipp V. von Spanien, und sein Urenkel, der zweijährige Ludwig, am Leben waren. So allgemein wurde dem Herzog die Schuld an dem düsteren Verhängniß beigemessen, daß er nicht mehr seinen Palast verlassen durfte, da er Gefahr lief, vom wüthenden Volke gesteinigt zu werden. Alle verdammten ihn, nur Einer nicht: König Ludwig war nicht zu überreden, daß der Herzog so ruchlosen Frevels fähig sei, und die Thatsache, daß der sonst so Argwöhnische an die Schuldlosigkeit Philipp’s glaubte, hat diesen nicht bloß vor dem Gefängniß bewahrt, sondern erwirkte für ihn auch vor dem Richterstuhl der Geschichte ein freisprechendes Urtheil.
Da aber Philipp fortfuhr, mit cynischen Principien und sittenlosem Wandel zu prunken, während Ludwig in seinen letzten Lebensjahren immer tiefer in Frömmelei versank, bestand die Entfremdung zwischen den Beiden fort. Die Mißgunst Ludwig’s XIV. trat noch in seinem Testament zu Tage, indem er gegen alle Tradition Philipp nur eine untergeordnete Stellung im Regentschaftsrath für die Dauer der Minderjährigkeit des Thronfolgers eingeräumt wissen wollte.
In Frankreich sind aber allezeit die Menschen mächtiger gewesen als die Gesetze. Nach dem Tode Ludwig’s XIV. (2. September 1715) ließ Philipp durch das Parlament von Paris das Testament für null und nichtig erklären und trat als „Regent“ die Herrschaft an.
Sein Regierungsprogramm läßt sich in einen Satz zusammenfassen: er strebte das Gegentheil von allem an, was sein Vorgänger hochgehalten hatte.
Für die auswärtige Politik war maßgebend, daß er die Unterstützung der vom englischen Thron gestoßenen Stuarts aufgab. Wie schon der „prince-philosophe“ noch zu Lebzeiten Ludwig’s XIV. zum Aergerniß von ganz Versailles Sympathie mit der „glorreichen“ Revolution von 1688 und Bewunderung der britischen Verfassung kundgegeben hatte, so strebte der Regent für Frankreich engstes Bündniß mit England an. Während er aber in jungen Jahren für Krieg und kriegerischen Ruhm geschwärmt hatte, erblickte er nunmehr, genöthigt durch die trostlose Finanzlage des Reichs, seine wichtigste Aufgabe in wirthschaftlichen Reformen. Daß ihm der gute Wille nicht fehlte, braucht nicht bezweifelt zu werden; daß er aber verkehrte Mittel wählte, indem er allzu einseitig den Industrialismus, ja das schädlichste Börsenspiel begünstigte, daß er nur das Volk verdarb und den Staat an den Rand des Abgrundes zerrte, beweist ein einziger Name. Es genügt, den Günstling des Regenten zu nennen, den allmächtigen Chef der Staatsbank und Erfinder aller möglichen wirthschaftlichen Arkana, den eben so leichtfertigen wie genialen John Law. Doch hat die Geschichte der Regentschaft nicht ausschließlich dunkle Blätter aufzuweisen. Manche harte, ungerechte Verordnung des absolutistischen Systems Ludwig’s XIV. wurde gemildert; das Ansehen der Parlamente hob sich, die Gerichtshöfe wurden wieder unabhängig; vor allem hörte die von Frau von Maintenon befohlene Verfolgung der Gewissen auf. St. Simon spricht deshalb mit Bewunderung von den Talenten und Kenntnissen des Regenten und entschuldigt dessen Lebenswandel mit der Lafterhaftigkeit des Jahrhunderts. Voltaire rühmt, daß von allen Nachkommen Heinrichs IV. Philipp von Orleans dem Ahnherrn am ähnlichsten gewesen sei; durch Tapferkeit, Frohsinn, Freimuth, geistvolle Rede, auch durch seine Gesichtszüge, ja durch sein ganzes Wesen habe er an den Bearner erinnert. Ein Historiker freilich, der seine Moral nicht aus Bayle schöpft und bei der Sittenlosigkeit des 18. Jahrhunderts an die dadurch hervorgerufenen Gräuel der großen Revolution denkt, kann nicht so mildes Urtheil fällen, kann nur bedauern, daß die liebenswürdigen Vorzüge untergingen in schmachvollen Ausschweifungen. Philipp starb unwürdig, wie er gelebt hatte, am 2. December 1723.
Wie ein Wunder mag es erschienen sein, daß der Sohn des Regenten, Louis, inmitten der zügellosen Frivolität des Palais Royal Reinheit der Sitte und frommen Sinn bewahrte. Als ob er seine Tage der Sühne für die Lasterhaftigkeit seiner Familie geweiht hätte, lebte er nur dem Gebet und dem Studium; der Vater soll einmal vorwurfsvoll zu ihm gesagt haben: „Du wirst nie etwas Anderes sein, als ein anständiger Mensch!“
Natürlich diente der andächtige Verkehr eines Orleans mit dem Jenseits den beaux-esprits von Versailles und Paris als Zielscheibe des Witzes. Der „Betbruder“ zog sich also gänzlich vom Hofleben zurück und fand in der Abtei St. Geneviève ein stilles Asyl.
Gegen die Gelassenheit und Beschaulichkeit „Génovevains“ und seiner frommen Gemahlin, einer badischen Prinzessin, stach das unruhige Temperament ihres Sohnes, Ludwig Philipp’s, merkwürdig ab. Der war mit Leib und Seele Soldat und focht unter den Bravsten bei Dettingen und Fontenoy. Ob er auch Befähigung zum Strategen besaß, wurde nicht erprobt; denn aus dynastischen Rücksichten wurde auch ihm, der überdies ein Gegner der Pompadour war, ein wichtigeres Kommando nicht anvertraut. Trotzdem war der ritterliche Prinz ein Liebling des Volks, das ihn den „König von Paris“ nannte, ein Gegenstück zum „König von Versailles“, den Etikette und Furcht von der Hauptstadt fern hielten. Dagegen war die Herzogin, eine geborene Fürstin Conti, allgemein verachtet; sie pflog Verkehr mit den radikalsten Freigeistern und sah nicht nur in gesellschaftlichen Formen, sondern auch in Moral und Weiblichkeit „Anachronismen“; sie war die würdige Mutter des „Bürgers Egalité“.
Louis Philipp Joseph, Herzog von Orleans, geboren am 13. April 1747 zu St. Cloud, gehört zu jenen widerwärtigsten Gestalten der Geschichte, auf welche das Wort des Tacitus anzuwendete ist: „Ich will nichts Falsches von ihm sagen und schäme mich, die Wahrheit über ihn zu sagen.“
Schon als Knabe und Jüngling galt er für frech und gemein; er lebte nur seinen Lüsten und prahlte mit zügelloser Liederlichkeit. Durch Vermählung mit Louise Marie, der einzigen Tochter des Herzogs von Penthièvre, des letzten Nachkommen der illegitimen Sippe Ludwig’s XIV., gelangte er in Besitz des ungeheuren Vermögens, das Ludwig seinen natürlichen Kindern überlassen hatte; Tournois weist spöttisch darauf hin, daß jener König selbst durchaus gegen seinen Willen zum Reichthum der Familie des gehaßten und gefürchteten Bruders den Grund legte. Auch nach der Hochzeit blieb das Palais Royal ein Tummelplatz der Libertinage. Zweifellos ist vieles nicht wahr, was Pamphletisten aus den Volkskreisen und Memoirenschreiber vom Hofe zu Versailles über diesen Orleans der Nachwelt überliefert haben. Daß er um der Erbschaft willen den Prinzen von Lamballe vergiftet
Verschiedene: Die Gartenlaube (1888). Leipzig: Ernst Keil, 1888, Seite 90. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1888)_090.jpg&oldid=- (Version vom 24.3.2018)