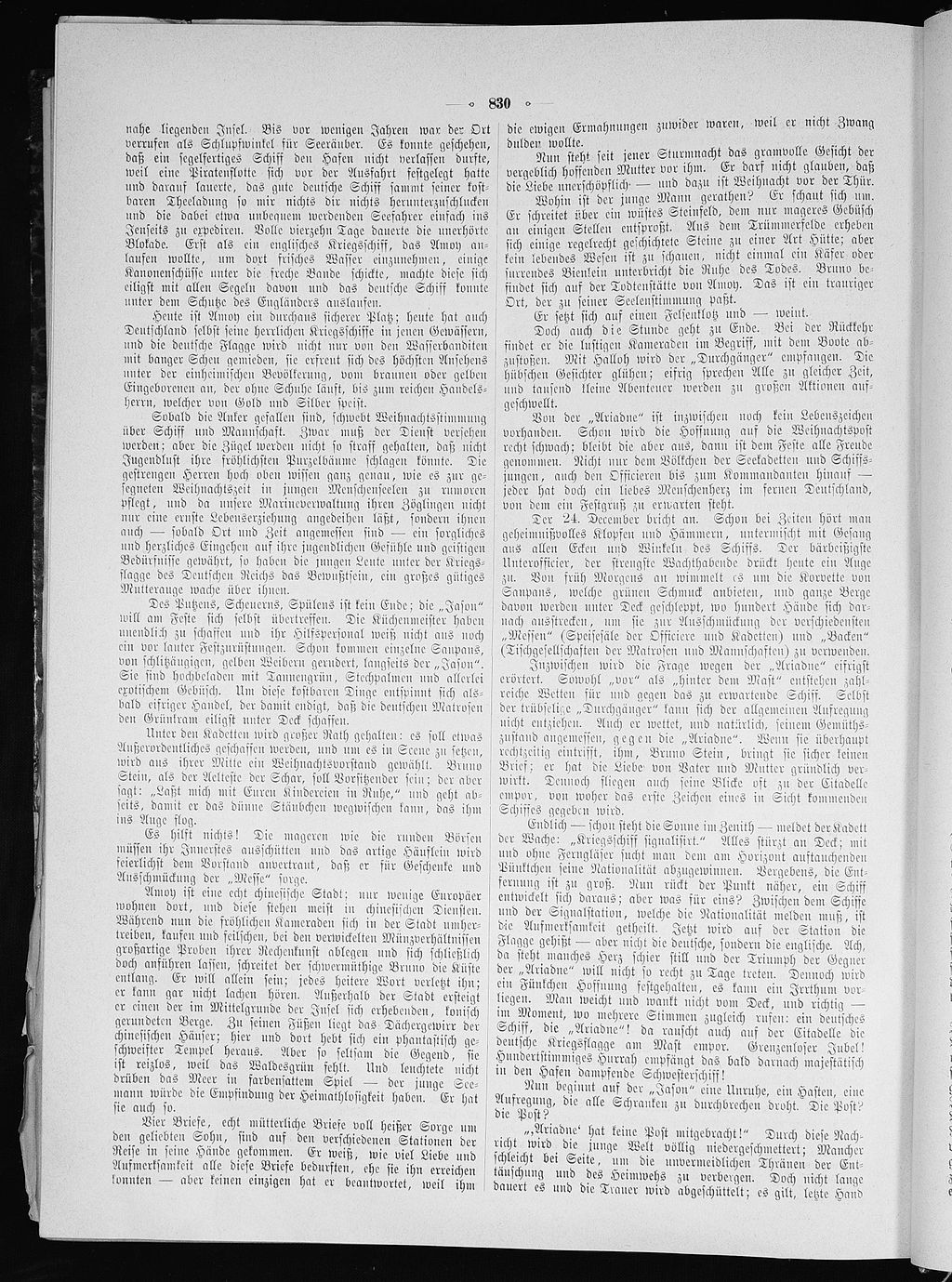| Verschiedene: Die Gartenlaube (1887) | |
|
|
nahe liegenden Insel. Bis vor wenigen Jahren war der Ort verrufen als Schlupfwinkel für Seeräuber. Es konnte geschehen, daß ein segelfertiges Schiff den Hafen nicht verlassen durfte, weil eine Piratenflotte sich vor der Ausfahrt festgelegt hatte und darauf lauerte, das gute deutsche Schiff sammt seiner kostbaren Theeladung so mir nichts dir nichts herunterzuschlucken und die dabei etwa unbequem werdenden Seefahrer einfach ins Jenseits zu expediren. Volle vierzehn Tage dauerte die unerhörte Blokade. Erst als ein englisches Kriegsschiff, das Amoy anlaufen wollte, um dort frisches Wasser einzunehmen, einige Kanonenschüsse unter die freche Bande schickte, machte diese sich eiligst mit allen Segeln davon und das deutsche Schiff konnte unter dem Schutze des Engländers auslaufen.
Heute ist Amoy ein durchaus sicherer Platz; heute hat auch Deutschland selbst seine herrlichen Kriegsschiffe in jenen Gewässern, und die deutsche Flagge wird nicht nur von den Wasserbanditen mit banger Scheu gemieden, sie erfreut sich des höchsten Ansehens unter der einheimischen Bevölkerung, vom braunen oder gelben Eingeborenen an, der ohne Schuhe läuft, bis zum reichen Handelsherrn, welcher von Gold und Silber speist.
Sobald die Anker gefallen sind, schwebt Weihnachtsstimmung über Schiff und Mannschaft. Zwar muß der Dienst versehen werden; aber die Zügel werden nicht so straff gehalten, daß nicht Jugendlust ihre fröhlichsten Purzelbäume schlagen könnte. Die gestrengen Herren hoch oben wissen ganz genau, wie es zur gesegneten Weihnachtszeit in jungen Menschenseelen zu rumoren pflegt, und da unsere Marineverwaltung ihren Zöglingen nicht nur eine ernste Lebenserziehung angedeihen läßt, sondern ihnen auch – sobald Ort und Zeit angemessen sind – ein sorgliches und herzliches Eingehen auf ihre jugendlichen Gefühle und geistigen Bedürfnisse gewährt, so haben die jungen Leute unter der Kriegsflagge des Deutschen Reichs das Bewußtsein, ein großes gütiges Mutterauge wache über ihnen.
Des Putzens, Scheuerns, Spülens ist kein Ende; die „Jason“ will am Feste sich selbst übertreffen. Die Küchenmeister haben unendlich zu schaffen und ihr Hilfspersonal weiß nicht aus noch ein vor lauter Festzurüstungen. Schon kommen einzelne Sanpans, von schlitzäugigen, gelben Weibern gerudert, langseits der „Jason“. Sie sind hochbeladen mit Tannengrün, Stechpalmen und allerlei exotischem Gebüsch. Um diese kostbaren Dinge entspinnt sich alsbald eifriger Handel, der damit endigt, daß die deutschen Matrosen den Grünkram eiligst unter Deck schaffen.
Unter den Kadetten wird großer Rath gehalten: es soll etwas Außerordentliches geschaffen werden, und um es in Scene zu setzen, wird aus ihrer Mitte ein Weihnachtsvorstand gewählt. Bruno Stein, als der Aelteste der Schar, soll Vorsitzender sein; der aber sagt: „Laßt mich mit Euren Kindereien in Ruhe,“ und geht abseits, damit er das dünne Stäubchen wegwischen kann, das ihm ins Auge flog.
Es hilft nichts! Die mageren wie die runden Börsen müssen ihr Innerstes ausschütten und das artige Häuflein wird feierlichst dem Vorstand anvertraut, daß er für Geschenke und Ausschmückung der „Messe“ sorge.
Amoy ist eine echt chinesische Stadt; nur wenige Europäer wohnen dort, und diese stehen meist in chinesischen Diensten. Während nun die fröhlichen Kameraden sich in der Stadt umhertreiben, kaufen und feilschen, bei den verwickelten Münzverhältnissen großartige Proben ihrer Rechenkunst ablegen und sich schließlich doch anführen lassen, schreitet der schwermüthige Bruno die Küste entlang. Er will allein sein; jedes heitere Wort verletzt ihn; er kann gar nicht lachen hören. Außerhalb der Stadt ersteigt er einen der im Mittelgrunde der Insel sich erhebenden, konisch gerundeten Berge. Zu seinen Füßen liegt das Dächergewirr der chinesischen Häuser; hier und dort hebt sich ein phantastisch geschweifter Tempel heraus. Aber so seltsam die Gegend, sie ist reizlos, weil das Waldesgrün fehlt. Und leuchtete nicht drüben das Meer in farbensattem Spiel – der junge Seemann würde die Empfindung der Heimathlosigkeit haben. Er hat sie auch so.
Vier Briefe, echt mütterliche Briefe voll heißer Sorge um den geliebten Sohn, sind auf den verschiedenen Stationen der Reise in seine Hände gekommen. Er weiß, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit alle diese Briefe bedurften, ehe sie ihn erreichen konnten – aber keinen einzigen hat er beantwortet, weil ihm die ewigen Ermahnungen zuwider waren, weil er nicht Zwang dulden wollte.
Nun steht seit jener Sturmnacht das gramvolle Gesicht der vergeblich hoffenden Mutter vor ihm. Er darf nicht glauben, daß die Liebe unerschöpflich – und dazu ist Weihnacht vor der Thür.
Wohin ist der junge Mann gerathen? Er schaut sich um. Er schreitet über ein wüstes Steinfeld, dem nur mageres Gebüsch an einigen Stellen entsproßt. Aus dem Trümmerfelde erheben sich einige regelrecht geschichtete Steine zu einer Art Hütte; aber kein lebendes Wesen ist zu schauen, nicht einmal ein Käfer oder surrendes Bienlein unterbricht die Ruhe des Todes. Bruno befindet sich auf der Todtenstätte von Amoy. Das ist ein trauriger Ort, der zu seiner Seelenstimmung paßt.
Er setzt sich auf einen Felsenklotz und – weint.
Doch auch die Stunde geht zu Ende. Bei der Rückkehr findet er die lustigen Kameraden im Begriff, mit dem Boote abzustoßen. Mit Halloh wird der „Durchgänger“ empfangen. Die hübschen Gesichter glühen; eifrig sprechen Alle zu gleicher Zeit, und tausend kleine Abenteuer werden zu großen Aktionen aufgeschwellt.
Von der „Ariadne“ ist inzwischen noch kein Lebenszeichen vorhanden. Schon wird die Hoffnung auf die Weihnachtspost recht schwach; bleibt die aber aus, dann ist dem Feste alle Freude genommen. Nicht nur dem Völkchen der Seekadetten und Schiffsjungen, auch den Officieren bis zum Kommandanten hinauf – jeder hat doch ein liebes Menschenherz im fernen Deutschland, von dem ein Festgruß zu erwarten steht.
Der 24. December bricht an. Schon bei Zeiten hört man geheimnißvolles Klopfen und Hämmern, untermischt mit Gesang aus allen Ecken und Winkeln des Schiffs. Der bärbeißigste Unterofficier, der strengste Wachthabende drückt heute ein Auge zu. Von früh Morgens an wimmelt es um die Korvette von Sanpans, welche grünen Schmuck anbieten, und ganze Berge davon werden unter Deck geschleppt, wo hundert Hände sich darnach ausstrecken, um sie zur Ausschmückung der verschiedensten „Messen“ (Speisesäle der Officiere und Kadetten) und „Backen“ (Tischgesellschaften der Matrosen und Mannschaften) zu verwenden.
Inzwischen wird die Frage wegen der „Ariadne“ eifrigst erörtert. Sowohl „vor“ als „hinter dem Mast“ entstehen zahlreiche Wetten für und gegen das zu erwartende Schiff. Selbst der trübselige „Durchgänger“ kann sich der allgemeinen Aufregung nicht entziehen. Auch er wettet, und natürlich, seinem Gemüthszustand angemessen, gegen die „Ariadne“. Wenn sie überhaupt rechtzeitig eintrifft, ihm, Bruno Stein, bringt sie sicher keinen Brief; er hat die Liebe von Vater und Mutter gründlich verwirkt. Dennoch fliegen auch seine Blicke oft zu der Citadelle empor, von woher das erste Zeichen eines in Sicht kommenden Schiffes gegeben wird.
Endlich – schon steht die Sonne im Zenith – meldet der Kadett der Wache: „Kriegsschiff signalisirt.“ Alles stürzt an Deck; mit und ohne Ferngläser sucht man dem am Horizont auftauchenden Pünktchen seine Nationalität abzugewinnen. Vergebens, die Entfernung ist zu groß. Nun rückt der Punkt näher, ein Schiff entwickelt sich daraus; aber was für eins? Zwischen dem Schiffe und der Signalstation, welche die Nationalität melden muß, ist die Aufmerksamkeit getheilt. Jetzt wird auf der Station die Flagge gehißt – aber nicht die deutsche, sondern die englische. Ach, da steht manches Herz schier still und der Triumph der Gegner der „Ariadne“ will nicht so recht zu Tage treten. Dennoch wird ein Fünkchen Hoffnung festgehalten, es kann ein Irrthum vorliegen. Man weicht und wankt nicht vom Deck, und richtig – im Moment, wo mehrere Stimmen zugleich rufen: ein deutsches Schiff, die „Ariadne“! da rauscht auch auf der Citadelle die deutsche Kriegsflagge am Mast empor. Grenzenloser Jubel! Hundertstimmiges Hurrah empfängt das bald darnach majestätisch in den Hafen dampfende Schwesterschiff!
Nun beginnt auf der „Jason“ eine Unruhe, ein Hasten, eine Aufregung, die alle Schranken zu durchbrechen droht. Die Post? die Post?
„,Ariadne‘ hat keine Post mitgebracht!“ Durch diese Nachricht wird die junge Welt völlig niedergeschmettert; Mancher schleicht bei Seite, um die unvermeidlichen Thränen der Enttäuschung und des Heimwehs zu verbergen. Doch nicht lange dauert es und die Trauer wird abgeschüttelt; es gilt, letzte Hand
Verschiedene: Die Gartenlaube (1887). Leipzig: Ernst Keil, 1887, Seite 830. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1887)_830.jpg&oldid=- (Version vom 24.2.2024)