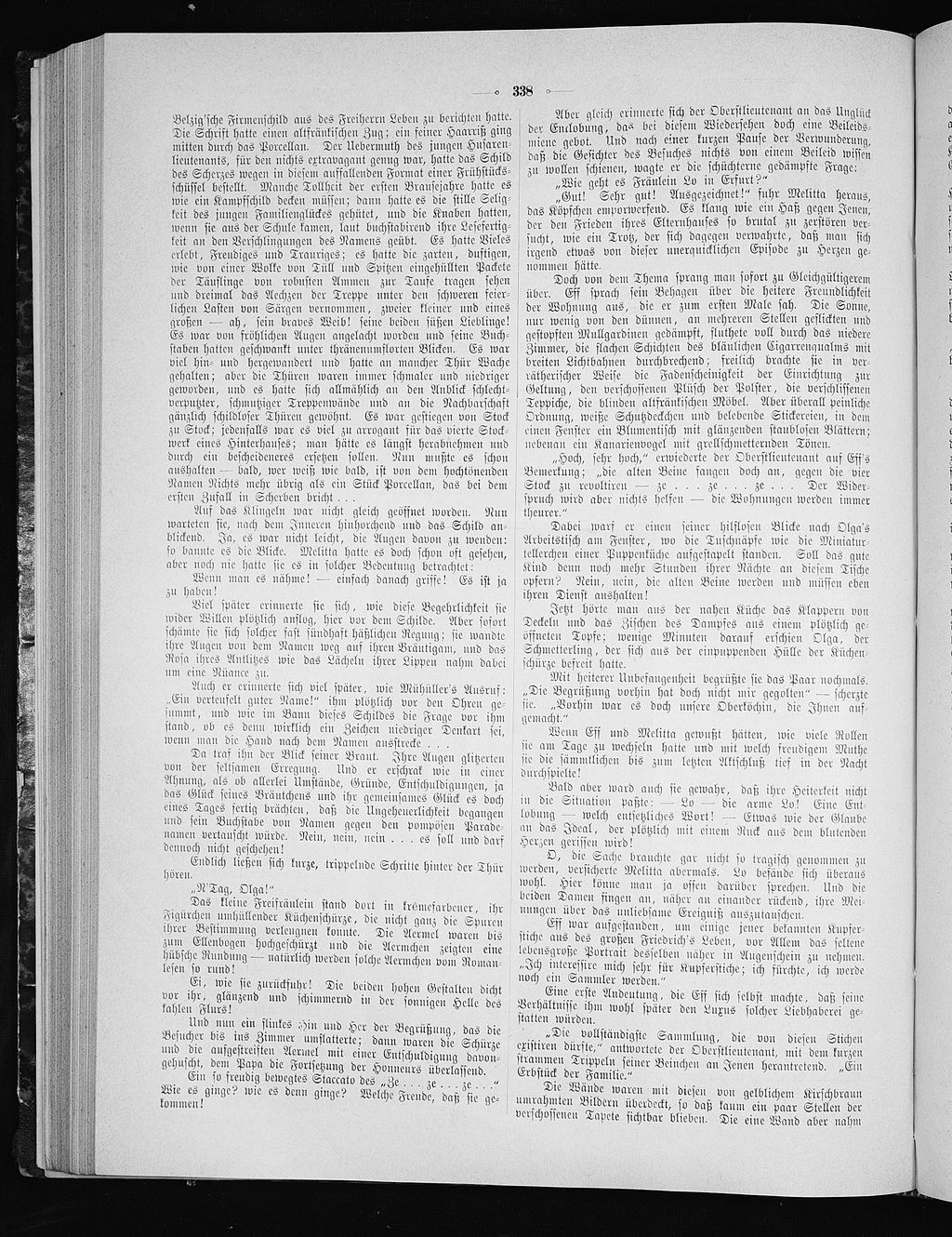| Verschiedene: Die Gartenlaube (1887) | |
|
|
Belzig’sche Firmenschild aus des Freiherrn Leben zu beachten hatte. Die Schrift hatte einen altfränkischen Zug, ein feiner Haarriß ging mitten durch das Porcellan. Der Uebermuth des jungen Husarenlieutenants, für den nichts extravagant genug war, hatte das Schild des Scherzes wegen in diesem auffallenden Format einer Frühstücksschüssel bestellt. Manche Tollheit der ersten Brausejahre hatte es wie ein Kampfschild decken müssen; dann hatte es die stille Seligkeit des jungen Familienglückes gehütet, und die Knaben hatten, wenn sie aus der Schule kamen, laut buchstabirend ihre Lesefertigkeit an den Verschlingungen des Namens geübt. Es hatte Vieles erlebt, Freudiges und Trauriges; es hatte die zarten, duftigen, wie von einer Wolke von Tüll und Spitzen eingehüllten Packete der Täuflinge von robusten Ammen zur Taufe tragen sehen und dreimal das Aechzen der Treppe unter den schweren feierlichen Lasten von Särgen vernommen, zweier kleiner und eines großen – ah, sein braves Weib! seine beiden süßen Lieblinge! Es war von fröhlichen Augen angelacht worden und seine Buchstaben hatten geschwankt unter thränenumflorten Blicken. Es war viel hin- und hergewandert und hatte an mancher Thür Wache gehalten, aber die Thüren waren immer schmaler und niedriger geworden, und es hatte sich allmählich an den Anblick schlechtverputzter, schmutziger Treppenwände und an die Nachbarschaft gänzlich schildloser Thüren gewöhnt. Es war gestiegen von Stock zu Stock, jedenfalls war es viel zu arrogant für das vierte Stockwerk eines Hinterhauses, man hätte es längst herabnehmen und durch ein bescheideneres ersetzen sollen. Nun mußte es schon aushalten – bald, wer weiß wie bald, ist von dem hochtönenden Namen Nichts mehr übrig als ein Stück Porcellan, das bei dem ersten Zufall in Scherben bricht …
Auf das Klingeln war nicht gleich geöffnet worden. Nun warteten sie, nach dem Inneren hinhorchend und das Schild anblickend. Ja, es war nicht leicht, die Augen davon zu wenden: so bannte es die Blicke. Melitta hatte es doch schon oft gesehen, aber noch nie hatte sie es in solcher Bedeutung betrachtet:
Wenn man es nähme! – einfach danach griffe! Es ist ja zu haben!
Viel später erinnerte sie sich, wie diese Begehrlichkeit sie wider Willen plötzlich anflog, hier vor dem Schilde. Aber sofort schämte sie sich solcher fast sündhaft häßlichen Regung, sie wandte ihre Augen von dem Namen weg auf ihren Bräutigam, und das Rosa ihres Antlitzes wie das Lächeln ihrer Lippen nahm dabei um eine Nüance zu.
Auch er erinnerte sich viel später, wie Mühüller’s Ausruf: „Ein verteufelt guter Name!“ ihm plötzlich vor den Ohren gesummt, und wie im Bann dieses Schildes die Frage vor ihm stand, ob es denn wirklich ein Zeichen niedriger Denkart sei, wenn man die Hand nach dem Namen ausstrecke …
Da traf ihn der Blick seiner Braut. Ihre Augen glitzerten von der seltsamen Erregung. Und er erschrak wie in einer Ahnung, als ob allerlei Umstände, Gründe, Entschuldigungen, ja das Glück seines Bräutchens und ihr gemeinsames Glück es doch eines Tages fertig brächten, daß die Ungeheuerlichkeit begangen und sein Buchstabe von Namen gegen den pompösen Paradenamen vertauscht würde. Nein, nein, nein … es soll und darf dennoch nicht geschehen!
Endlich ließen sich kurze, trippelnde Schritte hinter der Thür hören.
„N’Tag, Olga!“
Das kleine Freifräulein stand dort in krêmefarbener, ihr Figürchen umhüllender Küchenschürze, die nicht ganz die Spuren ihrer Bestimmung verleugnen konnte. Die Aermel waren bis zum Ellenbogen hochgeschürzt und die Aermchen zeigten eine hübsche Rundung – natürlich werden solche Aermchen vom Romanlesen so rund!
Ei, wie sie zurückfuhr! Die beiden hohen Gestalten dicht vor ihr, glänzend und schimmernd in der sonnigen Helle des kahlen Flurs!
Und nun ein flinkes Hin und Her der Begrüßung, das die Besucher bis ins Zimmer umflatterte; dann waren die Schürze und die aufgestreiften Aermel mit einer Entschuldigung davongehuscht, dem Papa die Fortsetzung der Honneurs überlassend.
Ein so freudig bewegtes Staccato des „Ze … ze … ze …“ Wie es ginge? wie es denn ginge? Welche Freude, daß sie gekommen!
Aber gleich erinnerte sich der Oberstlieutenant an das Unglück der Entlobung, das bei diesem Wiedersehen doch eine Beileidsmiene gebot. Und nach einer kurzen Pause der Verwunderung, daß die Gesichter des Besuches nichts von einem Beileid wissen zu wollen schienen, wagte er die schüchterne gedämpfte Frage:
„Wie geht es Fräulein Lo in Erfurt?“
„Gut! Sehr gut! Ausgezeichnet!“ fuhr Melitta heraus, das Köpfchen emporwerfend. Es klang wie ein Haß gegen Jenen, der den Frieden ihres Elternhauses so brutal zu zerstören versucht, wie ein Trotz, der sich dagegen verwahrte, daß man sich irgend etwas von dieser unerquicklichen Episode zu Herzen genommen hätte.
Doch von dem Thema sprang man sofort zu Gleichgültigerem über. Eff sprach sein Behagen über die heitere Freundlichkeit der Wohnung aus, die er zum ersten Male sah. Die Sonne, nur wenig von den dünnen, an mehreren Stellen geflickten und gestopften Mullgardinen gedämpft, fluthete voll durch das niedere Zimmer, die flachen Schichten des bläulichen Cigarrenqualms mit breiten Lichtbahnen durchbrechend, freilich brachte sie in verrätherischer Weise die Fadenscheinigkeit der Einrichtung zur Geltung, den verschossenen Plüsch der Polster, die verschlissenen Teppiche, die blinden altfränkischen Möbel. Aber überall peinliche Ordnung, weiße Schutzdeckchen und belebende Stickereien, in dem einen Fenster ein Blumentisch mit glänzenden staublosen Blättern; nebenan ein Kanarienvogel mit grellschmetternden Tönen.
„Hoch, sehr hoch,“ erwiederte der Oberstlieutenant auf Eff’s Bemerkung, „die alten Beine fangen doch an, gegen die vier Stock zu revoltiren – ze … ze … ze … Der Widerspruch wird aber nichts helfen – die Wohnungen werden immer theurer.“
Dabei warf er einen seiner hilflosen Blicke nach Olga’s Arbeitstisch am Fenster, wo die Tuschnäpfe wie die Miniaturtellerchen einer Puppenküche aufgestapelt standen. Soll das gute Kind denn noch mehr Stunden ihrer Nächte an diesem Tische opfern? Nein, nein, die alten Beine werden und müssen eben ihren Dienst aushalten!
Jetzt hörte man aus der nahen Küche das Klappern von Deckeln und das Zischen des Dampfes aus einem plötzlich geöffneten Topfe, wenige Minuten darauf erschien Olga, der Schmetterling, der sich aus der einpuppenden Hülle der Küchenschürze befreit hatte.
Mit heiterer Unbefangenheit begrüßte sie das Paar nochmals. „Die Begrüßung vorhin hat doch nicht mir gegolten“ – scherzte sie. „Vorhin war es doch unsere Oberköchin, die Ihnen aufgemacht.“
Wenn Eff und Melitta gewußt hätten, wie viele Rollen sie am Tage zu wechseln hatte und mit welch freudigem Muthe sie die sämmtlichen bis zum letzten Aktschluß tief in der Nacht durchspielte!
Bald aber ward auch sie gewahr, daß ihre Heiterkeit nicht in die Situation paßte. – Lo – die arme Lo! Eine Entlobung – welch entsetzliches Wort! – Etwas wie der Glaube an das Ideal, der plötzlich mit einem Ruck aus dem blutenden Herzen gerissen wird!
O, die Sache brauchte gar nicht so tragisch genommen werden, versicherte Melitta abermals. Lo befände sich überaus wohl. Hier könne man ja offen darüber sprechen. Und die beiden Damen fingen an, näher an einander rückend, ihre Meinungen über das unliebsame Ereigniß auszutauschen.
Eff war aufgestanden, um einige jener bekannten Kupferstiche aus des großen Friedrich’s Leben, vor Allem das seltene lebensgroße Portrait desselben näher in Augenschein zu nehmen. „Ich interessire mich sehr für Kupferstiche; ich fürchte, ich werde noch ein Sammler werden.“
Eine erste Andeutung, die Eff sich selbst machte, daß seine Verhältnisse ihm wohl später den Luxus solcher Liebhaberei gestatten würden.
„Die vollständigste Sammlung, die von diesen Stichen existiren dürfte,“ antwortete der Oberstlieutenant, mit dem kurzen strammen Trippeln seiner Beinchen an Jenen herantretend. „Ein Erbstück der Familie.“
Die Wände waren mit diesen von gelblichem Kirschbraun umrahmten Bildern überdeckt, so daß kaum ein paar Stellen der verschossenen Tapete sichtbar blieben. Die eine Wand aber nahm
Verschiedene: Die Gartenlaube (1887). Leipzig: Ernst Keil, 1887, Seite 338. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1887)_338.jpg&oldid=- (Version vom 19.11.2023)