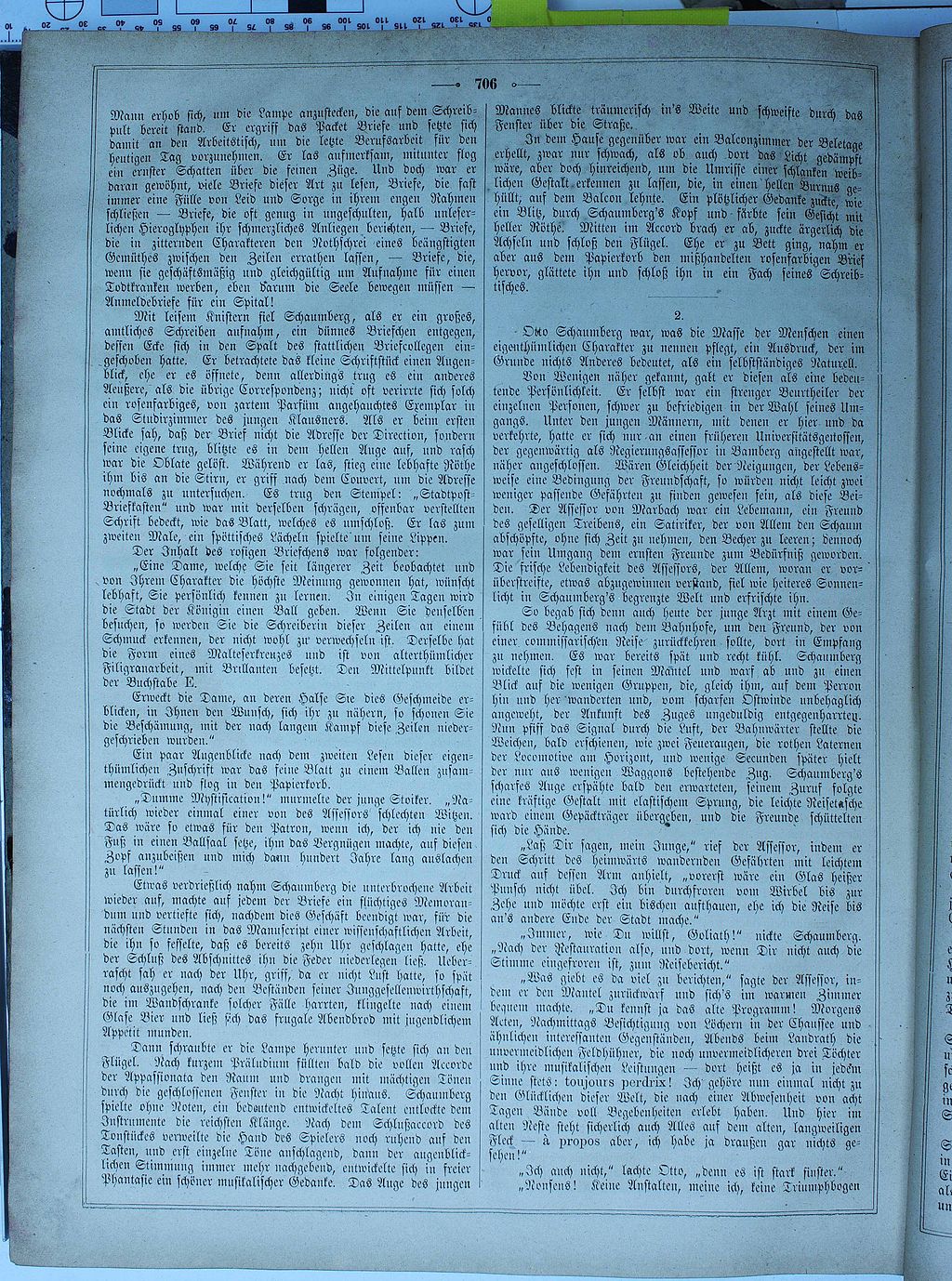| verschiedene: Die Gartenlaube (1868) | |
|
|
Mann erhob sich, um die Lampe anzustecken, die auf dem Schreibpult bereit stand. Er ergriff das Packet Briefe und setzte sich damit an den Arbeitstisch, um die letzte Berufsarbeit für den heutigen Tag vorzunehmen. Er las aufmerksam, mitunter flog ein ernster Schatten über die feinen Züge. Und doch war er daran gewöhnt, viele Briefe dieser Art zu lesen, Briefe, die fast immer eine Fülle von Leid und Sorge in ihrem engen Rahmen schließen – Briefe, die oft genug in ungeschulten, halb unleserlichen Hieroglyphen ihr schmerzliches Anliegen berichten, – Briefe, die in zitternden Charakteren den Nothschrei eines beängstigten Gemüthes zwischen den Zeilen errathen lassen, – Briefe, die, wenn sie geschäftsmäßig und gleichgültig um Aufnahme für einen Todtkranken werben, eben darum die Seele bewegen müssen – Anmeldebriefe für ein Spital!
Mit leisem Knistern fiel Schaumberg, als er ein großes, amtliches Schreiben aufnahm, ein dünnes Briefchen entgegen, dessen Ecke sich in den Spalt des stattlichen Briefcollegen ein, geschoben hatte. Er betrachtete das kleine Schriftstück einen Augenblick, ehe er es öffnete, denn allerdings trug es ein anderes Aeußere, als die übrige Correspondenz; nicht oft verirrte sich solch ein rosenfarbiges, von zartem Parfüm angehauchtes Exemplar in das Studirzimmer des jungen Klausners. Als er beim ersten Blicke sah, daß der Brief nicht die Adresse der Direction, sondern seine eigene trug, blitzte es in dem hellen Auge auf, und rasch war die Oblate gelöst. Während er las, stieg eine lebhafte Röthe ihm bis an die Stirn, er griff nach dem Couvert, um die Adresse nochmals zu untersuchen. Es trug den Stempel: „Stadtpost-Briefkasten“ und war mit derselben schrägen, offenbar verstellten Schrift bedeckt, wie das Blatt, welches es umschloß. Er las zum zweiten Male, ein spöttisches Lächeln spielte um seine Lippen.
Der Inhalt des rosigen Briefchens war folgender:
„Eine Dame, welche Sie seit längerer Zeit beobachtet und von Ihrem Charakter die höchste Meinung gewonnen hat, wünscht lebhaft, Sie persönlich kennen zu lernen. In einigen Tagen wird die Stadt der Königin einen Ball geben. Wenn Sie denselben besuchen, so werden Sie die Schreiberin dieser Zeilen an einem Schmuck erkennen, der nicht wohl zu verwechseln ist. Derselbe hat die Form eines Malteserkreuzes und ist von alterthümlicher Filigranarbeit, mit Brillanten besetzt. Den Mittelpunkt bildet der Buchstabe E.
Erweckt die Dame, an deren Halse Sie dies Geschmeide erblicken, in Ihnen den Wunsch, sich ihr zu nähern, so schonen Sie die Beschämung, mit der nach langem Kampf diese Zeilen niedergeschrieben wurden.“
Ein paar Augenblicke nach dem zweiten Lesen dieser eigenthümlichen Zuschrift war das feine Blatt zu einem Ballen zusammengedrückt und flog in den Papierkorb.
„Dumme Mystification!“ murmelte der junge Stoiker. „Natürlich wieder einmal einer von des Assessors schlechten Witzen. Das wäre so etwas für den Patron, wenn ich, der ich nie den Fuß in einen Ballsaal setze, ihm das Vergnügen machte, auf diesen Zopf anzubeißen und mich dann hundert Jahre lang auslachen zu lassen!“
Etwas verdrießlich nahm Schaumberg die unterbrochene Arbeit wieder auf, machte auf jedem der Briefe ein flüchtiges Memorandum und vertiefte sich, nachdem dies Geschäft beendigt war, für die nächsten Stunden in das Manuscript einer wissenschaftlichen Arbeit, die ihn so fesselte, daß es bereits zehn Uhr geschlagen hatte, ehe der Schluß des Abschnittes ihn die Feder niederlegen ließ. Ueberrascht sah er nach der Uhr, griff, da er nicht Lust hatte, so spät noch auszugehen, nach den Beständen seiner Junggesellenwirthschaft, die im Wandschranke solcher Fälle harrten, klingelte nach einem Glase Bier und ließ sich das frugale Abendbrod mit jugendlichem Appetit munden.
Dann schraubte er die Lampe herunter und setzte sich an den Flügel. Nach kurzem Präludium füllten bald die vollen Accorde der Appassionata den Raum und drangen mit mächtigen Tönen durch die geschlossenen Fenster in die Nacht hinaus. Schaumberg spielte ohne Noten, ein bedeutend entwickeltes Talent entlockte dem Instrumente die reichsten Klänge. Nach dem Schlußaccord des Tonstückes verweilte die Hand des Spielers noch ruhend auf den Tasten, und erst einzelne Töne anschlagend, dann der augenblicklichen Stimmung immer mehr nachgebend, entwickelte sich in freier Phantasie ein schöner musikalischer Gedanke. Das Auge des jungen Mannes blickte träumerisch in’s Weite und schweifte durch das Fenster über die Straße.
In dem Hause gegenüber war ein Balconzimmer der Beletage erhellt, zwar nur schwach, als ob auch dort das Licht gedämpft wäre, aber doch hinreichend, um die Umrisse einer schlanken weiblichen Gestalt erkennen zu lassen, die, in einen hellen Burnus gehüllt, auf dem Balcon lehnte. Ein plötzlicher Gedanke zuckte, wie ein Blitz, durch Schaumberg’s Kopf und färbte sein Gesicht mit heller Röthe. Mitten im Accord brach er ab, zuckte ärgerlich die Achseln und schloß den Flügel. Ehe er zu Bett ging, nahm er aber aus dem Papierkorb den mißhandelten rosenfarbigen Brief hervor, glättete ihn und schloß ihn in ein Fach seines Schreibtisches.
Otto Schaumberg war, was die Masse der Menschen einen eigenthümlichen Charakter zu nennen pflegt, ein Ausdruck, der im Grunde nichts Anderes bedeutet, als ein selbstständiges Naturell.
Von Wenigen näher gekannt, galt er diesen als eine bedeutende Persönlichkeit. Er selbst war ein strenger Beurtheiler der einzelnen Personen, schwer zu befriedigen in der Wahl seines Umgangs. Unter den jungen Männern, mit denen er hier und da verkehrte, hatte er sich nur an einen früheren Universitätsgenossen, der gegenwärtig als Regierungsassessor in Bamberg angestellt war, näher angeschlossen. Wären Gleichheit der Neigungen, der Lebensweise eine Bedingung der Freundschaft, so würden nicht leicht zwei weniger passende Gefährten zu finden gewesen sein, als diese Beiden. Der Assessor von Marbach war ein Lebemann, ein Freund des geselligen Treibens, ein Satiriker, der von Allem den Schaum abschöpfte, ohne sich Zeit zu nehmen, den Becher zu leeren; dennoch war sein Umgang dem ernsten Freunde zum Bedürfniß geworden. Die frische Lebendigkeit des Assessors, der Allem, woran er vorüberstreifte, etwas abzugewinnen verstand, fiel wie heiteres Sonnenlicht in Schaumberg’s begrenzte Welt und erfrischte ihn.
So begab sich denn auch heute der junge Arzt mit einem Gefühl des Behagens nach dem Bahnhofe, um den Freund, der von einer commissarischen Reise zurückkehren sollte, dort in Empfang zu nehmen. Es war bereits spät und recht kühl. Schaumberg wickelte sich fest in seinen Mantel und warf ab und zu einen Blick auf die wenigen Gruppen, die, gleich ihm, auf dem Perron hin und her wanderten und, vom scharfen Ostwinde unbehaglich angeweht, der Ankunft des Zuges ungeduldig entgegenharrten. Nun pfiff das Signal durch die Luft, der Bahnwärter stellte die Weichen, bald erschienen, wie zwei Feueraugen, die rothen Laternen der Locomotive am Horizont, und wenige Secunden später hielt der nur aus wenigen Waggons bestehende Zug. Schaumberg’s scharfes Auge erspähte bald den erwarteten, seinem Zuruf folgte eine kräftige Gestalt mit elastischem Sprung, die leichte Reisetasche ward einem Gepäckträger übergeben, und die Freunde schüttelten sich die Hände.
„Laß Dir sagen, mein Junge,“ rief der Assessor, indem er den Schritt des heimwärts wandernden Gefährten mit leichtem Druck auf dessen Arm anhielt, „vorerst wäre ein Glas heißer Punsch nicht übel. Ich bin durchfroren vom Wirbel bis zur Zehe und möchte erst ein bischen aufthauen, ehe ich die Reise bis an’s andere Ende der Stadt mache.“
„Immer, wie Du willst, Goliath!“ nickte Schaumberg. „Nach der Restauration also, und dort, wenn Dir nicht auch die Stimme eingefroren ist, zum Reisebericht.“
„Was giebt es da viel zu berichten,“ sagte der Assessor, indem er den Mantel zurückwarf und sich’s im warmen Zimmer bequem machte. „Du kennst ja das alte Programm! Morgens Acten, Nachmittags Besichtigung von Löchern in der Chaussee und ähnlichen interessanten Gegenständen, Abends beim Landrath die unvermeidlichen Feldhühner, die noch unvermeidlicheren drei Töchter und ihre musikalischen Leistungen – dort heißt es ja in jedem Sinne stets: toujours perdrix! Ich gehöre nun einmal nicht zu den Glücklichen dieser Welt, die nach einer Abwesenheit von acht Tagen Bände voll Begebenheiten erlebt haben. Und hier im alten Neste steht sicherlich auch Alles auf dem alten, langweiligen Fleck – á propos aber, ich habe ja draußen gar nichts gesehen!“
„Ich auch nicht,“ lachte Otto, „denn es ist stark finster.“
„Nonsens! Keine Anstalten, meine ich, keine Triumphbogen
verschiedene: Die Gartenlaube (1868). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1868, Seite 706. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1868)_706.jpg&oldid=- (Version vom 15.9.2022)