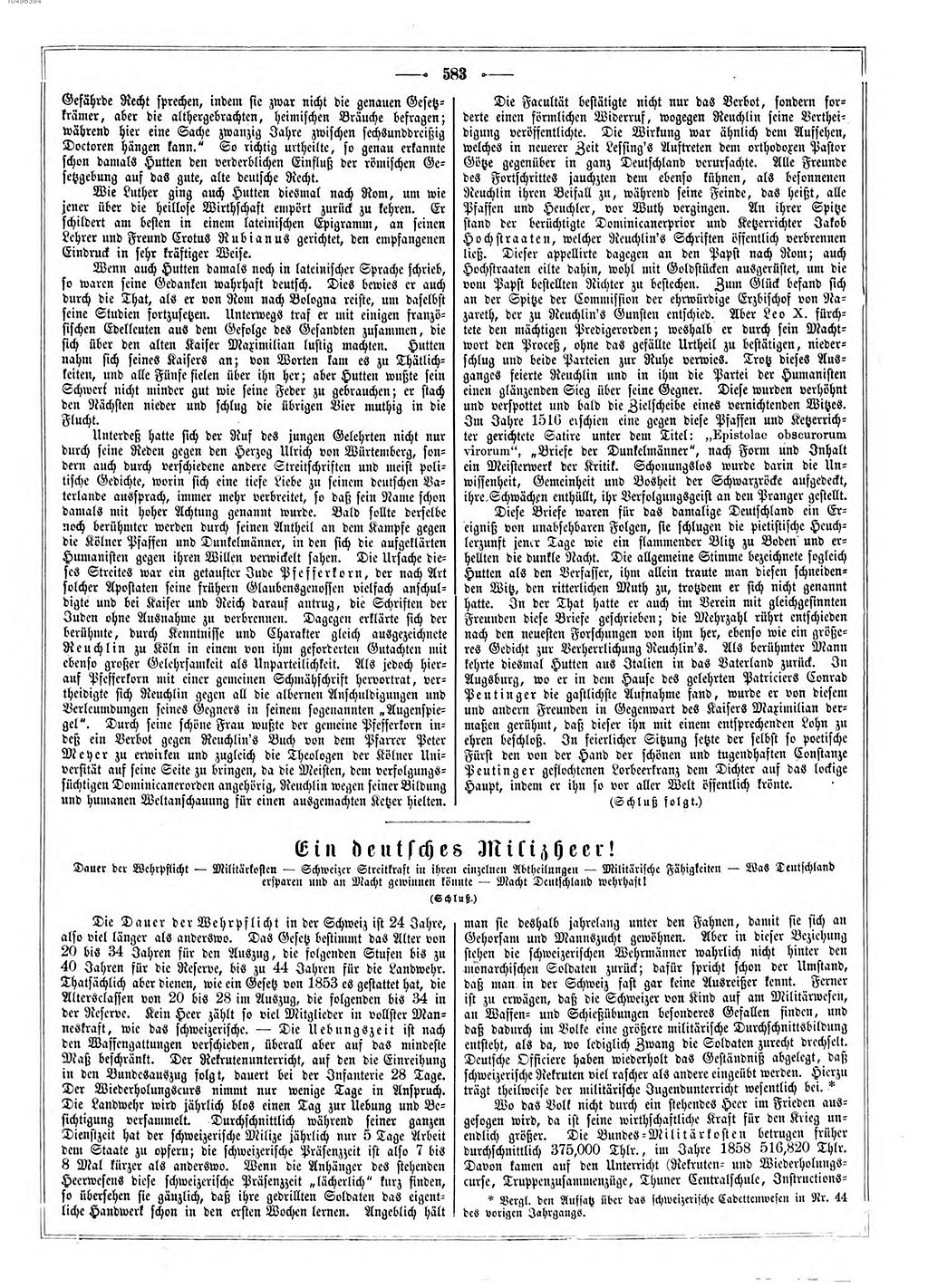| verschiedene: Die Gartenlaube (1860) | |
|
|
Gefährde Recht sprechen, indem sie zwar nicht die genauen Gesetzkrämer, aber die althergebrachten, heimischen Bräuche befragen; während hier eine Sache zwanzig Jahre zwischen sechsunddreißig Doctoren hangen kann.“ So richtig urtheilte, so genau erkannte schon damals Hutten den verderblichen Einfluß der römischen Gesetzgebung auf das gute, alte deutsche Recht.
Wie Luther ging auch Hutten diesmal nach Rom, um wie jener über die heillose Wirthschaft empört zurück zu kehren. Er schildert am besten in einem lateinischen Epigramm, an seinen Lehrer und Freund Crotus Rubianus gerichtet, den empfangenen Eindruck in sehr kräftiger Weise.
Wenn auch Hutten damals noch in lateinischer Sprache schrieb, so waren seine Gedanken wahrhaft deutsch. Dies bewies er auch durch die That, als er von Rom nach Bologna reiste, um daselbst seine Studien fortzusetzen. Unterwegs traf er mit einigen französischen Edelleuten aus dem Gefolge des Gesandten zusammen, die sich über den alten Kaiser Maximilian lustig machten. Hutten nahm sich seines Kaisers an; von Worten kam es zu Thätlichkeiten, und alle Fünfe fielen über ihn her; aber Hutten wußte sein Schwert nicht minder gut wie seine Feder zu gebrauchen; er stach den Nächsten nieder und schlug die übrigen Vier muthig in die Flucht.
Unterdeß hatte sich der Ruf des jungen Gelehrten nicht nur durch seine Reden gegen den Herzog Ulrich von Würtemberg, sondern auch durch verschiedene andere Streitschriften und meist politische Gedichte, worin sich eine tiefe Liebe zu seinem deutschen Vaterlande aussprach, immer mehr verbreitet, so daß sein Name schon damals mit hoher Achtung genannt wurde. Bald sollte derselbe noch berühmter werden durch seinen Antheil an dem Kampfe gegen die Kölner Pfaffen und Dunkelmänner, in den sich die aufgeklärten Humanisten gegen ihren Willen verwickelt sahen. Die Ursache dieses Streites war ein getaufter Jude Pfefferkorn, der nach Art solcher Apostaten seine frühern Glaubensgenossen vielfach anschuldigte und bei Kaiser und Reich darauf antrug, die Schriften der Juden ohne Ausnahme zu verbrennen. Dagegen erklärte sich der berühmte, durch Kenntnisse und Charakter gleich ausgezeichnete Reuchlin zu Köln in einem von ihm geforderten Gutachten mit ebenso großer Gelehrsamkeit als Unparteilichkeit. Als jedoch hierauf Pfefferkorn mit einer gemeinen Schmähschrift hervortrat, vertheidigte sich Reuchlin gegen all die albernen Anschuldigungen und Verleumdungen seines Gegners in seinem sogenannten „Augenspiegel“. Durch seine schöne Frau wußte der gemeine Pfefferkorn indeß ein Verbot gegen Reuchlin’s Buch von dem Pfarrer Peter Meyer zu erwirken und zugleich die Theologen der Kölner Universität auf seine Seite zu bringen, da die Meisten, dem verfolgungssüchtigen Dominicanerorden angehörig, Reuchlin wegen seiner Bildung und humanen Weltanschauung für einen ausgemachten Ketzer hielten.
Die Facultät bestätigte nicht nur das Verbot, sondern forderte einen förmlichen Widerruf, wogegen Reuchlin seine Vertheidigung veröffentlichte. Die Wirkung war ähnlich dem Aufsehen, welches in neuerer Zeit Lessing’s Auftreten dem orthodoxen Pastor Götze gegenüber in ganz Deutschland verursachte. Alle Freunde des Fortschrittes jauchzten dem ebenso kühnen, als besonnenen Reuchlin ihren Beifall zu, während seine Feinde, das heißt, alle Pfaffen und Heuchler, vor Wuth vergingen. An ihrer Spitze stand der berüchtigte Dominicanerprior und Ketzerrichter Jakob Hochstraaten, welcher Reuchlin’s Schriften öffentlich verbrennen ließ. Dieser appellirte dagegen an den Papst nach Rom; auch Hochstraaten eilte dahin, wohl mit Goldstücken ausgerüstet, um die vom Papst bestellten Richter zu bestechen. Zum Glück befand sich an der Spitze der Commission der ehrwürdige Erzbischof von Nazareth, der zu Reuchlin’s Gunsten entschied. Aber Leo X. fürchtete den mächtigen Predigerorden; weshalb er durch sein Machtwort den Proceß, ohne das gefällte Urtheil zu bestätigen, niederschlug und beide Parteien zur Ruhe verwies. Trotz dieses Ausganges feierte Reuchlin und in ihm die Partei der Humanisten einen glänzenden Sieg über seine Gegner. Diese wurden verhöhnt und verspottet und bald die Zielscheibe eines vernichtenden Witzes. Im Jahre 1516 erschien eine gegen diese Pfaffen und Ketzerrichter gerichtete Satire unter dem Titel: „Epistolae obscurorum virorum“, „Briefe der Dunkelmänner“, nach Form und Inhalt ein Meisterwerk der Kritik. Schonungslos wurde darin die Unwissenheit, Gemeinheit und Bosheit der Schwarzröcke aufgedeckt, ihre Schwächen enthüllt, ihr Verfolgungsgeist an den Pranger gestellt.
Diese Briefe waren für das damalige Deutschland ein Ereigniß von unabsehbaren Folgen, sie schlugen die pietistische Heuchlerzunft jener Tage wie ein flammender Blitz zu Boden und erhellten die dunkle Nacht. Die allgemeine Stimme bezeichnete sogleich Hutten als den Verfasser, ihm allein traute man diesen schneidenden Witz, den ritterlichen Muth zu, trotzdem er sich nicht genannt hatte. In der That hatte er auch im Verein mit gleichgesinnten Freunden diese Briefe geschrieben; die Mehrzahl rührt entschieden nach den neuesten Forschungen von ihm her, ebenso wie ein größeres Gedicht zur Verherrlichung Reuchlin’s. Als berühmter Mann kehrte diesmal Hutten aus Italien in das Vaterland zurück. In Augsburg, wo er in dem Hause des gelehrten Patriciers Conrad Peutinger die gastlichste Aufnahme fand, wurde er von diesem und andern Freunden in Gegenwart des Kaisers Maximilian dermaßen gerühmt, daß dieser ihn mit einem entsprechenden Lohn zu ehren beschloß. In feierlicher Sitzung setzte der selbst so poetische Fürst den von der Hand der schönen und tugendhaften Constanze Peutinger geflochtenen Lorbeerkranz dem Dichter auf das lockige Haupt, indem er ihn so vor aller Welt öffentlich krönte.
Die Dauer der Wehrpflicht in der Schweiz ist 24 Jahre, also viel länger als anderswo. Das Gesetz bestimmt das Alter von 20 bis 34 Jahren für den Auszug, die folgenden Stufen bis zu 40 Jahren für die Reserve, bis zu 44 Jahren für die Landwehr. Thatsächlich aber dienen, wie ein Gesetz von 1853 es gestattet hat, die Altersclassen von 20 bis 28 im Auszug, die folgenden bis 34 in der Reserve. Kein Heer zählt so viel Mitglieder in vollster Manneskraft, wie das schweizerische. – Die Uebungszeit ist nach den Waffengattungen verschieden, überall aber auf das mindeste Maß beschränkt. Der Rekrutenunterricht, auf den die Einreihung in den Bundesauszug folgt, dauert bei der Infanterie 28 Tage. Der Wiederholungscurs nimmt nur wenige Tage in Anspruch. Die Landwehr wird jährlich blos einen Tag zur Uebung und Besichtigung versammelt. Durchschnittlich während seiner ganzen Dienstzeit hat der schweizerische Milize jährlich nur 5 Tage Arbeit dem Staate zu opfern; die schweizerische Präsenzzeit ist also 7 bis 8 Mal kürzer als anderswo. Wenn die Anhänger des stehenden Heerwesens diese schweizerische Präsenzzeit „lächerlich“ kurz finden, so übersehen sie gänzlich, daß ihre gedrillten Soldaten das eigentliche Handwerk schon in den ersten Wochen lernen. Angeblich hält man sie deshalb jahrelang unter den Fahnen, damit sie sich an Gehorsam und Mannszucht gewöhnen. Aber in dieser Beziehung stehen die schweizerischen Wehrmänner wahrlich nicht hinter den monarchischen Soldaten zurück; dafür spricht schon der Umstand, daß man in der Schweiz fast gar keine Ausreißer kennt. Ferner ist zu erwägen, daß die Schweizer von Kind auf am Militärwesen, an Waffen- und Schießübungen besonderes Gefallen finden, und daß dadurch im Volke eine größere militärische Durchschnittsbildung entsteht, als da, wo lediglich Zwang die Soldaten zurecht drechselt. Deutsche Officiere haben wiederholt das Geständniß abgelegt, daß schweizerische Rekruten viel rascher als andere eingeübt werden. Hierzu trägt theilweise der militärische Jugendunterricht wesentlich bei. [1]
Wo das Volk nicht durch ein stehendes Heer im Frieden ausgesogen wird, da ist seine wirthschaftliche Kraft für den Krieg unendlich größer. Die Bundes-Militärkosten betrugen früher durchschnittlich 375,000 Thlr., im Jahre 1858 516,820 Thlr. Davon kamen auf den Unterricht (Rekruten- und Wiederholungscurse, Truppenzusammenzüge, Thuner Centralschule, Instructionspersonal)
- ↑ Vergl. den Aufsatz über das schweizerische Cadettenwesen in Nr. 44 des vorigen Jahrgangs.
verschiedene: Die Gartenlaube (1860). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1860, Seite 583. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1860)_583.jpg&oldid=- (Version vom 15.9.2022)