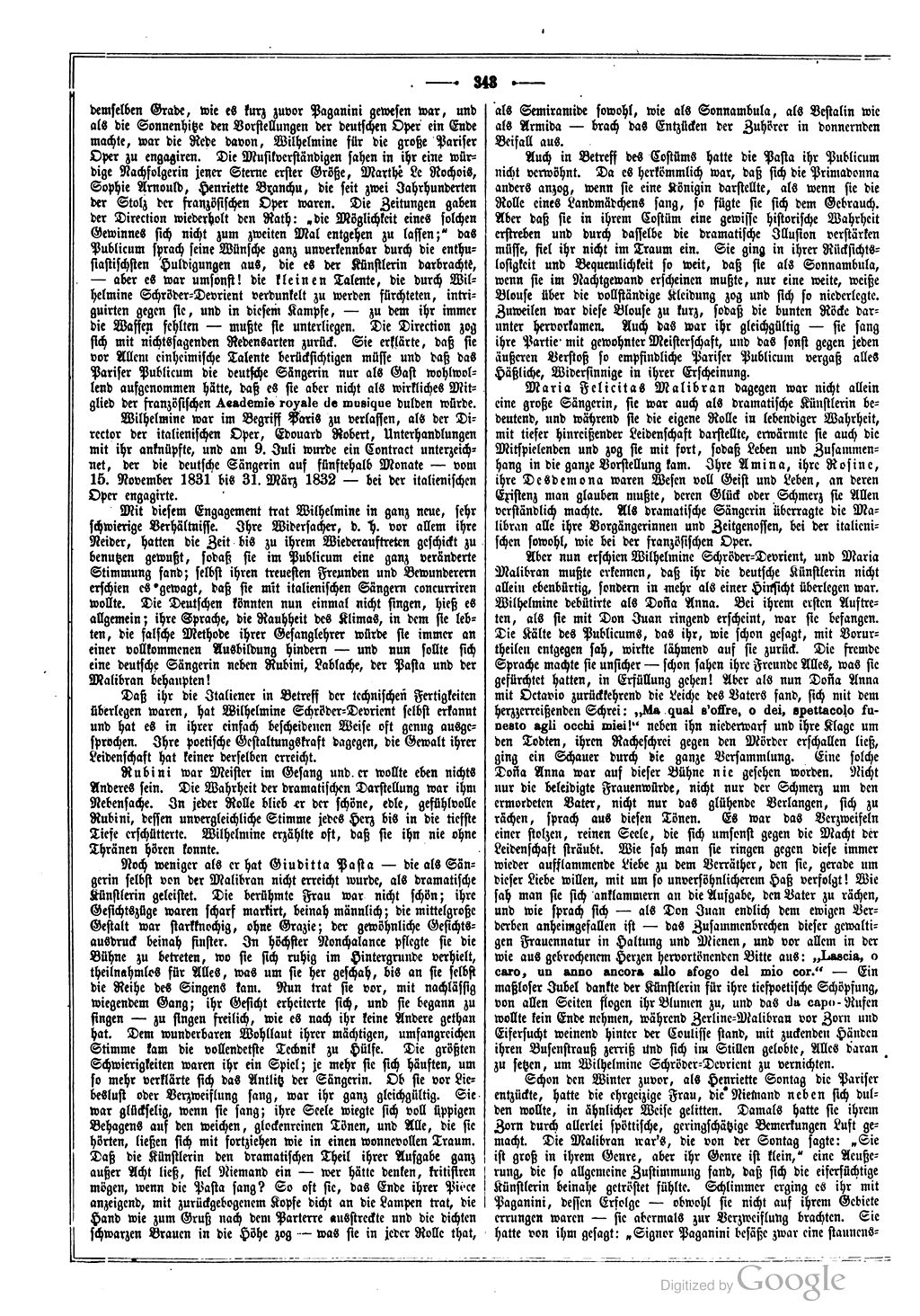| verschiedene: Die Gartenlaube (1860) | |
|
|
demselben Grade, wie es kurz zuvor Paganini gewesen war, und als die Sonnenhitze den Vorstellungen der deutschen Oper ein Ende machte, war die Rede davon, Wilhelmine für die große Pariser Oper zu engagiren. Die Musikverständigen sahen in ihr eine würdige Nachfolgerin jener Sterne erster Größe, Marthe Le Rochois, Sophie Arnould, Henriette Branchu, die seit zwei Jahrhunderten der Stolz der französischen Oper waren. Die Zeitungen gaben der Direction wiederholt den Rath: „die Möglichkeit eines solchen Gewinnes sich nicht zum zweiten Mal entgehen zu lassen;“ das Publicum sprach seine Wünsche ganz unverkennbar durch die enthusiastischsten Huldigungen aus, die es der Künstlerin darbrachte, – aber es war umsonst! die kleinen Talente, die durch Wilhelmine Schröder-Devrient verdunkelt zu werden fürchteten, intriguirten gegen sie, und in diesem Kampfe, – zu dem ihr immer die Waffen fehlten – mußte sie unterliegen. Die Direction zog sich mit nichtssagenden Redensarten zurück. Sie erklärte, daß sie vor Allem einheimische Talente berücksichtigen müsse und daß das Pariser Publicum die deutsche Sängerin nur als Gast wohlwollend aufgenommen hätte, daß es sie aber nicht als wirkliches Mitglied der französischen Academie royale de musique dulden würde.
Wilhelmine war im Begriff Paris zu verlassen, als der Director der italienischen Oper, Edouard Robert, Unterhandlungen mit ihr anknüpfte, und am 9. Juli wurde ein Contract unterzeichnet, der die deutsche Sängerin auf fünftehalb Monate – vom 15. November 1831 bis 31. März 1832 – bei der italienischen Oper engagirte.
Mit diesem Engagement trat Wilhelmine in ganz neue, sehr schwierige Verhältnisse. Ihre Widersacher, d. h. vor allem ihre Neider, hatten die Zeit bis zu ihrem Wiederauftreten geschickt zu benutzen gewußt, sodaß sie im Publicum eine ganz veränderte Stimmung fand; selbst ihren treuesten Freunden und Bewunderern erschien es gewagt, daß sie mit italienischen Sängern concurriren wollte. Die Deutschen könnten nun einmal nicht singen, hieß es allgemein; ihre Sprache, die Rauhheit des Klimas, in dem sie lebten, die falsche Methode ihrer Gesanglehrer würde sie immer an einer vollkommenen Ausbildung hindern – und nun sollte sich eine deutsche Sängerin neben Rubini, Lablache, der Pasta und der Malibran behaupten!
Daß ihr die Italiener in Betreff der technischen Fertigkeiten überlegen waren, hat Wilhelmine Schröder-Devrient selbst erkannt und hat es in ihrer einfach bescheidenen Weise oft genug ausgesprochen. Ihre poetische Gestaltungskraft dagegen, die Gewalt ihrer Leidenschaft hat keiner derselben erreicht.
Rubini war Meister im Gesang und er wollte eben nichts Anderes sein. Die Wahrheit der dramatischen Darstellung war ihm Nebensache. In jeder Rolle blieb er der schöne, edle, gefühlvolle Rubini, dessen unvergleichliche Stimme jedes Herz bis in die tiefste Tiefe erschütterte. Wilhelmine erzählte oft, daß sie ihn nie ohne Thränen hören konnte.
Noch weniger als er hat Giuditta Pasta – die als Sängerin selbst von der Malibran nicht erreicht wurde, als dramatische Künstlerin geleistet. Die berühmte Frau war nicht schön; ihre Gesichtszüge waren scharf markirt, beinah männlich; die mittelgroße Gestalt war starkknochig, ohne Grazie; der gewöhnliche Gesichtsausdruck beinah finster. In höchster Nonchalance pflegte sie die Bühne zu betreten, wo sie sich ruhig im Hintergrunde verhielt, theilnahmlos für Alles, was um sie her geschah, bis an sie selbst die Reihe des Singens kam. Nun trat sie vor, mit nachlässig wiegendem Gang; ihr Gesicht erheiterte sich, und sie begann zu singen – zu singen freilich, wie es nach ihr keine Andere gethan hat. Dem wunderbaren Wohllaut ihrer mächtigen, umfangreichen Stimme kam die vollendetste Tecknik zu Hülfe. Die größten Schwierigkeiten waren ihr ein Spiel; je mehr sie sich häuften, um so mehr verklärte sich das Antlitz der Sängerin. Ob sie vor Liebeslust oder Verzweiflung sang, war ihr ganz gleichgültig. Sie war glückselig, wenn sie sang; ihre Seele wiegte sich voll üppigen Behagens auf den weichen, glockenreinen Tönen, und Alle, die sie hörten, ließen sich mit fortziehen wie in einen wonnevollen Traum. Daß die Künstlerin den dramatischen Theil ihrer Aufgabe ganz außer Acht ließ, fiel Niemand ein – wer hätte denken, kritisiren mögen, wenn die Pasta sang? So oft sie, das Ende ihrer Pièce anzeigend, mit zurückgebogenem Kopfe dicht an die Lampen trat, die Hand wie zum Gruß nach dem Parterre ausstreckte und die dichten schwarzen Brauen in die Höhe zog – was sie in jeder Rolle that, als Semiramide sowohl, wie als Sonnambula, als Vestalin wie als Armida – brach das Entzücken der Zuhörer in donnernden Beifall aus.
Auch in Betreff des Costüms hatte die Pasta ihr Publicum nicht verwöhnt. Da es herkömmlich war, daß sich die Primadonna anders anzog, wenn sie eine Königin darstellte, als wenn sie die Rolle eines Landmädchens sang, so fügte sie sich dem Gebrauch. Aber daß sie in ihrem Costüm eine gewisse historische Wahrheit erstreben und durch dasselbe die dramatische Illusion verstärken müsse, fiel ihr nicht im Traum ein. Sie ging in ihrer Rücksichtslosigkeit und Bequemlichkeit so weit, daß sie als Sonnambula, wenn sie im Nachtgewand erscheinen mußte, nur eine weite, weiße Blouse über die vollständige Kleidung zog und sich so niederlegte. Zuweilen war diese Blouse zu kurz, sodaß die bunten Röcke darunter hervorkamen. Auch das war ihr gleichgültig – sie sang ihre Partie mit gewohnter Meisterschaft, und das sonst gegen jeden äußeren Verstoß so empfindliche Pariser Publicum vergaß alles Häßliche, Widersinnige in ihrer Erscheinung.
Maria Felicitas Malibran dagegen war nicht allein eine große Sängerin, sie war auch als dramatische Künstlerin bedeutend, und während sie die eigene Rolle in lebendiger Wahrheit, mit tiefer hinreißender Leidenschaft darstellte, erwärmte sie auch die Mitspielenden und zog sie mit fort, sodaß Leben und Zusammenhang in die ganze Vorstellung kam. Ihre Amina, ihre Rosine, ihre Desdemona waren Wesen voll Geist und Leben, an deren Existenz man glauben mußte, deren Glück oder Schmerz sie Allen verständlich machte. Als dramatische Sängerin überragte die Malibran alle ihre Vorgängerinnen und Zeitgenossen, bei der italienischen sowohl, wie bei der französischen Oper.
Aber nun erschien Wilhelmine Schröder-Devrient, und Maria Malibran mußte erkennen, daß ihr die deutsche Künstlerin nicht allein ebenbürtig, sondern in mehr als einer Hinsicht überlegen war. Wilhelmine debütirte als Doña Anna. Bei ihrem ersten Auftreten, als sie mit Don Juan ringend erscheint, war sie befangen. Die Kälte des Publicums, das ihr, wie schon gesagt, mit Vorurtheilen entgegen sah, wirkte lähmend auf sie zurück. Die fremde Sprache machte sie unsicher – schon sahen ihre Freunde Alles, was sie gefürchtet hatten, in Erfüllung gehen! Aber als nun Doña Anna mit Octavio zurückkehrend die Leiche des Vaters fand, sich mit dem herzzerreißenden Schrei: „Ma qual s’offre, o dei, spettacolo funesto agli occhi miei!“ neben ihn niederwarf und ihre Klage um den Todten, ihren Racheschrei gegen den Mörder erschallen ließ, ging ein Schauer durch die ganze Versammlung. Eine solche Doña Anna war auf dieser Bühne nie gesehen worden. Nicht nur die beleidigte Frauenwürde, nicht nur der Schmerz um den ermordeten Vater, nicht nur das glühende Verlangen, sich zu rächen, sprach aus diesen Tönen. Es war das Verzweifeln einer stolzen, reinen Seele, die sich umsonst gegen die Macht der Leidenschaft sträubt. Wie sah man sie ringen gegen diese immer wieder aufflammende Liebe zu dem Verräther, den sie, gerade um dieser Liebe willen, mit um so unversöhnlicherem Haß verfolgt! Wie sah man sie sich anklammern an die Aufgabe, den Vater zu rächen, und wie sprach sich – als Don Juan endlich dem ewigen Verderben anheimgefallen ist – das Zusammenbrechen dieser gewaltigen Frauennatur in Haltung und Mienen, und vor allem in der wie aus gebrochenem Herzen hervortönenden Bitte aus: „Lascia, o caro, un anno ancora allo sfogo del mio cor.“ – Ein maßloser Jubel dankte der Künstlerin für ihre tiefpoetische Schöpfung, von allen Seiten flogen ihr Blumen zu, und das da capo-Rufen wollte kein Ende nehmen, während Zerline-Malibran vor Zorn und Eifersucht weinend hinter der Coulisse stand, mit zuckenden Händen ihren Busenstrauß zerriß und sich im Stillen gelobte, Alles daran zu setzen, um Wilhelmine Schröder-Devrient zu vernichten.
Schon den Winter zuvor, als Henriette Sontag die Pariser entzückte, hatte die ehrgeizige Frau, die Niemand neben sich dulden wollte, in ähnlicher Weise gelitten. Damals hatte sie ihrem Zorn durch allerlei spöttische, geringschätzige Bemerkungen Luft gemacht. Die Malibran war’s, die von der Sontag sagte: „Sie ist groß in ihrem Genre, aber ihr Genre ist klein,“ eine Aeußerung, die so allgemeine Zustimmung fand, daß sich die eifersüchtige Künstlerin beinahe getröstet fühlte. Schlimmer erging es ihr mit Paganini, dessen Erfolge – obwohl sie nicht auf ihrem Gebiete errungen waren – sie abermals zur Verzweiflung brachten. Sie hatte von ihm gesagt: „Signor Paganini besäße zwar eine staunenswürdige
verschiedene: Die Gartenlaube (1860). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1860, Seite 343. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1860)_343.jpg&oldid=- (Version vom 20.8.2021)