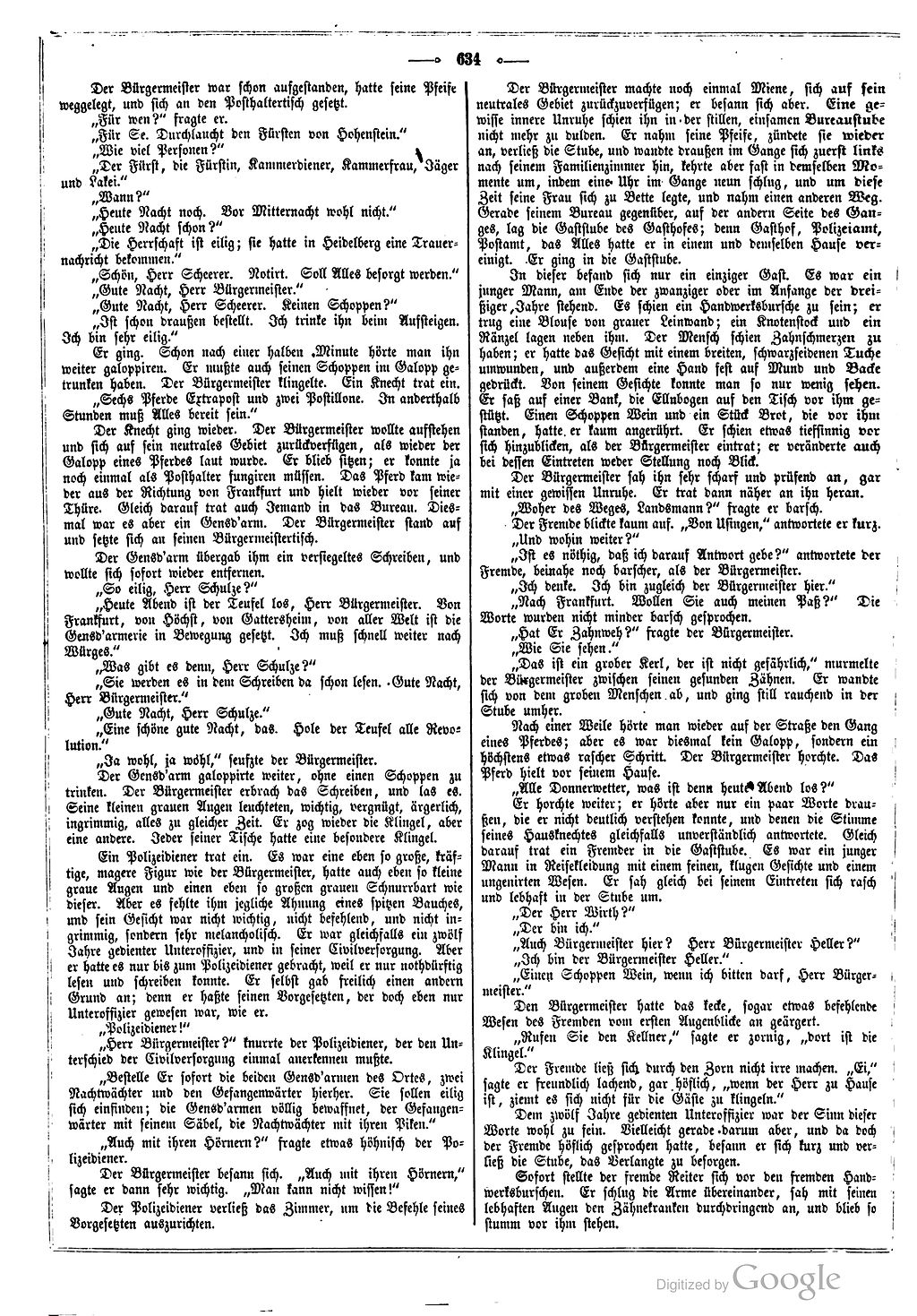| verschiedene: Die Gartenlaube (1856) | |
|
|
Der Bürgermeister war schon aufgestanden, hatte seine Pfeife weggelegt, und sich an den Posthaltertisch gesetzt.
„Für wen?“ fragte er.
„Für Se. Durchlaucht den Fürsten von Hohenstein.“
„Wie viel Personen?“
„Der Fürst, die Fürstin, Kammerdiener, Kammerfrau, Jäger und Lakei.“
„Wann?“
„Heute Nacht noch. Vor Mitternacht wohl nicht.“
„Heute Nacht schon?“
„Die Herrschaft ist eilig; sie hatte in Heidelberg eine Trauernachricht bekommen.“
„Schön, Herr Scheerer. Notirt. Soll Alles besorgt werden.“
„Gute Nacht, Herr Bürgermeister.“ „Gute Nacht, Herr Scheerer. Keinen Schoppen?“
„Ist schon draußen bestellt. Ich trinke ihn beim Aufsteigen.
Ich bin sehr eilig.“
Er ging. Schon nach einer halben Minute hörte man ihn weiter galoppiren. Er mußte auch seinen Schoppen im Galopp getrunken haben. Der Bürgermeister klingelte. Ein Knecht trat ein.
„Sechs Pferde Extrapost und zwei Postillone. In anderthalb Stunden muß Alles bereit sein.“
Der Knecht ging wieder. Der Bürgermeister wollte aufstehen und sich auf sein neutrales Gebiet zurückverfügen, als wieder der Galopp eines Pferdes laut wurde. Er blieb sitzen; er konnte ja noch einmal als Posthalter fungiren müssen. Das Pferd kam wieder aus der Richtung von Frankfurt und hielt wieder vor seiner Thüre. Gleich darauf trat auch Jemand in das Bureau. Diesmal war es aber ein Gensd’arm. Der Bürgermeister stand auf und setzte sich an seinen Bürgermeistertisch.
Der Gensd’arm übergab ihm ein versiegeltes Schreiben, und wollte sich sofort wieder entfernen.
„So eilig, Herr Schulze?“
„Heute Abend ist der Teufel los, Herr Bürgermeister. Von Frankfurt, von Höchst, von Gattersheim, von aller Welt ist die Gensd’armerie in Bewegung gesetzt. Ich muß schnell weiter nach Würges.“
„Was gibt es denn, Herr Schulze?“
„Sie werden es in dem Schreiben da schon lesen. Gute Nacht, Herr Bürgermeister.“ „Gute Nacht, Herr Schulze.“
„Eine schöne gute Nacht, das. Hole der Teufel alle Revolution.“
„Ja wohl, ja wohl,“ seufzte der Bürgermeister.
Der Gensd’arm galoppirte weiter, ohne einen Schoppen zu trinken. Der Bürgermeister erbrach das Schreiben, und las es. Seine kleinen grauen Augen leuchteten, wichtig, vergnügt, ärgerlich, ingrimmig, alles zu gleicher Zeit. Er zog wieder die Klingel, aber eine andere. Jeder seiner Tische hatte eine besondere Klingel.
Ein Polizeidiener trat ein. Es war eine eben so große, kräftige, magere Figur wie der Bürgermeister, hatte auch eben so kleine graue Augen und einen eben so großen grauen Schnurrbart wie dieser. Aber es fehlte ihm jegliche Ahnung eines spitzen Bauches, und sein Gesicht war nicht wichtig, nicht befehlend, und nicht ingrimmig, sondern sehr melancholisch. Er war gleichfalls ein zwölf Jahre gedienter Unteroffizier, und in seiner Civilversorgung. Aber er hatte es nur bis zum Polizeidiener gebracht, weil er nur nothdürftig lesen und schreiben konnte. Er selbst gab freilich einen andern Grund an; denn er haßte seinen Vorgesetzten, der doch eben nur Unteroffizier gewesen war, wie er.
„Polizeidiener!“
„Herr Bürgermeister?“ knurrte der Polizeidiener, der den Unterschied der Civilversorgung einmal anerkennen mußte.
„Bestelle Er sofort die beiden Gensd’armen des Ortes, zwei Nachtwächter und den Gefangenwärter hierher. Sie sollen eilig sich einfinden; die Gensd’armen völlig bewaffnet, der Gefangenwärter mit seinem Säbel, die Nachtwächter mit ihren Piken.“
„Auch mit ihren Hörnern?“ fragte etwas höhnisch der Polizeidiener.
Der Bürgermeister besann sich. „Auch mit ihren Hörnern,“ sagte er dann sehr wichtig. „Man kann nicht wissen!“
Der Polizeidiener verließ das Zimmer, um die Befehle seines Vorgesetzten auszurichten.
Der Bürgermeister machte noch einmal Miene, sich auf sein neutrales Gebiet zurückzuverfügen; er besann sich aber. Eine gewisse innere Unruhe schien ihn in der stillen, einsamen Bureaustube nicht mehr zu dulden. Er nahm seine Pfeife, zündete sie wieder an, verließ die Stube, und wandte draußen im Gange sich zuerst links nach seinem Familienzimmer hin, kehrte aber fast in demselben Momente um, indem eine Uhr im Gange neun schlug, und um diese Zeit seine Frau sich zu Bette legte, und nahm einen anderen Weg. Gerade seinem Bureau gegenüber, auf der andern Seite des Ganges, lag die Gaststube des Gasthofes; denn Gasthof, Polizeiamt, Postamt, das Alles hatte er in einem und demselben Hause vereinigt. Er ging in die Gaststube.
In dieser befand sich nur ein einziger Gast. Es war ein junger Mann, am Ende der zwanziger oder im Anfange der dreißiger Jahre stehend. Es schien ein Handwerksbursche zu sein; er trug eine Blouse von grauer Leinwand; ein Knotenstock und ein Ränzel lagen neben ihm. Der Mensch schien Zahnschmerzen zu haben; er hatte das Gesicht mit einem breiten, schwarzseidenen Tuche umwunden, und außerdem eine Hand fest auf Mund und Backe gedrückt. Von seinem Gesichte konnte man so nur wenig sehen. Er saß auf einer Bank, die Ellnbogen auf den Tisch vor ihm gestützt. Einen Schoppen Wein und ein Stück Brot, die vor ihn, standen, hatte, er kaum angerührt. Er schien etwas tiefsinnig vor sich hinzublicken, als der Bürgermeister eintrat; er veränderte auch bei dessen Eintreten weder Stellung noch Blick.
Der Bürgermeister sah ihn sehr scharf und prüfend an, gar mit einer gewissen Unruhe. Er trat dann näher an ihn heran.
„Woher des Weges, Landsmann?“ fragte er barsch.
Der Fremde blickte kaum auf. „Von Usingen,“ antwortete er kurz.
„Und wohin weiter?“
„Ist es nöthig, daß ich darauf Antwort gebe?“ antwortete der Fremde, beinahe noch barscher, als der Bürgermeister.
„Ich denke. Ich bin zugleich der Bürgermeister hier.“
„Nach Frankfurt. Wollen Sie auch meinen Paß?“ Die Worte wurden nicht minder barsch gesprochen.
„Hat Er Zahnweh?“ fragte der Bürgermeister.
„Wie Sie sehen.“
„Das ist ein grober Kerl, der ist nicht gefährlich,“ murmelte der Bürgermeister zwischen seinen gesunden Zähnen. Er wandte sich von dem groben Menschen ab, und ging still rauchend in der Stube umher.
Nach einer Weile hörte man wieder auf der Straße den Gang eines Pferdes; aber es war diesmal kein Galopp, sondern ein höchstens etwas rascher Schritt. Der Bürgermeister horchte. Das Pferd hielt vor seinem Hause.
„Alle Donnerwetter, was ist denn heute Abend los?“
Er horchte weiter; er hörte aber nur ein paar Worte draußen, die er nicht deutlich verstehen konnte, und denen die Stimme seines Hausknechtes gleichfalls unverständlich antwortete. Gleich darauf trat ein Fremder in die Gaststube. Es war ein junger Mann in Reisekleidung mit einem feinen, klugen Gesichte und einem ungenirten Wesen. Er sah gleich bei seinem Eintreten sich rasch und lebhaft in der Stube um.
„Der Herr Wirth?“
„Der bin ich.“
„Auch Bürgermeister hier? Herr Bürgermeister Heller?“
„Ich bin der Bürgermeister Heller.“ .
„Einen Schoppen Wein, wenn ich bitten darf, Herr Bürgermeister.“
Den Bürgermeister hatte das kecke, sogar etwas befehlende Wesen des Fremden vom ersten Augenblicke an geärgert.
„Rufen Sie den Kellner,“ sagte er zornig, „dort ist die Klingel.“
Der Fremde ließ sich durch den Zorn nicht irre machen. „Ei,“ sagte er freundlich lachend, gar höflich, „wenn der Herr zu Hause ist, ziemt es sich nicht für die Gäste zu klingeln.“
Dem zwölf Jahre gedienten Unteroffizier war der Sinn dieser Worte wohl zu fein. Vielleicht gerade darum aber, und da doch der Fremde höflich gesprochen hatte, besann er sich kurz und verließ die Stube, das Verlangte zu besorgen.
Sofort stellte der fremde Reiter sich vor den fremden Handwerksburschen. Er schlug die Arme übereinander, sah mit seinen lebhaften Augen den Zähnekranken durchdringend an, und blieb so stumm vor ihm stehen.
verschiedene: Die Gartenlaube (1856). Ernst Keil, Leipzig 1856, Seite 634. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1856)_634.jpg&oldid=- (Version vom 12.5.2018)